

Der fünfte Mörder (Alexander-Gerlach-Reihe 7) Der fünfte Mörder (Alexander-Gerlach-Reihe 7) - eBook-Ausgabe
Ein Fall für Alexander Gerlach
„Das Werk ist stilsicher und souverän erzählt (…) Hochspannung ist (…) garantiert.“ - Oberösterreichische Nachrichten
Der fünfte Mörder (Alexander-Gerlach-Reihe 7) — Inhalt
Das Gesicht des Bösen
Beinahe wäre Kriminaloberrat Gerlach Opfer eines Bombenanschlags geworden: Vor seinen Augen explodiert der Geländewagen eines bulgarischen Zuhälters. Wenig später ereignen sich weitere rätselhafte Morde, und Gerlach kommt der Verdacht, es könne sich ein Bandenkrieg anbahnen. Als er zu ermitteln beginnt, wird er von oberster Stelle zurückgepfiffen. Ausgerechnet jetzt hat der Heidelberger Kripochef gute Gründe, sich ernsthafte Sorgen um seine pubertierenden Töchter zu machen, und zu allem Übel nimmt auch sein Liebesleben eine unvorhergesehene Wendung.
Leseprobe zu „Der fünfte Mörder (Alexander-Gerlach-Reihe 7)“
1
Terror!, war mein erster Gedanke in der Stille nach der Explosion. Der Dschihad hat Heidelberg erreicht!
Ich stand keine zwanzig Schritte von dem soeben in die Luft geflogenen Wagen entfernt und hatte das Atmen vergessen. Noch bevor die letzten Trümmer zu Boden geprasselt waren, ging irgendwo eine Alarmsirene los. In meinen Ohren hallte die Detonation nach.
Jemand hatte geschrien. Eine Frau. Sie stand unmittelbar neben mir, an einem Zigarettenautomaten. Nicht mehr ganz jung, registrierte mein Polizistenhirn automatisch, zierlich, neckische, weißblonde [...]
1
Terror!, war mein erster Gedanke in der Stille nach der Explosion. Der Dschihad hat Heidelberg erreicht!
Ich stand keine zwanzig Schritte von dem soeben in die Luft geflogenen Wagen entfernt und hatte das Atmen vergessen. Noch bevor die letzten Trümmer zu Boden geprasselt waren, ging irgendwo eine Alarmsirene los. In meinen Ohren hallte die Detonation nach.
Jemand hatte geschrien. Eine Frau. Sie stand unmittelbar neben mir, an einem Zigarettenautomaten. Nicht mehr ganz jung, registrierte mein Polizistenhirn automatisch, zierlich, neckische, weißblonde Strubbelfrisur. Ihre Augen waren groß vor Schreck, und sie war so blass, wie ich mich fühlte. Am linken Nasenflügel blitzte ein Steinchen im Sonnenlicht. Die Rechte hatte sie vor den Mund geschlagen. Handtasche und Portemonnaie lagen am Boden, darum herum ein wenig Kleingeld verstreut.
Die Alarmsirene jaulte, dass es in den Ohren gellte.
Gott sei Dank schien niemand verletzt zu sein, oder gar tot, soweit ich es überblicken konnte. Auch mir war offenbar nichts passiert–abgesehen von dem mächtigen Schrecken. Ich fühlte keinen Schmerz, entdeckte kein Blut an mir. Da war nur diese Starre, der Druck auf der Lunge, die dumpfe Beklemmung, die mir das Atmen schwer machte. Ich hob einen Fuß, versuchte einen Schritt. Noch einen. Meine Beine funktionierten vorschriftsmäßig.
Als hätte ein unsichtbarer Regisseur das Kommando gegeben, wurden an den umliegenden Häusern plötzlich Fenster aufgerissen, die Menschen auf den Bürgersteigen bewegten sich wieder, Autos bremsten, deren Fahrer sich nicht an dem inzwischen brennenden Wagen vorbei trauten, eine Straßenbahn, die etwa fünfzig Meter stadtauswärts im Verkehr stecken geblieben war, bimmelte vorwurfsvoll.
Ich musste etwas tun. Schließlich war ich Polizist und hatte den Überblick zu bewahren, Ruhe zu verbreiten, zu helfen, zu retten. Aber was? Hier gab es ja nichts zu retten. Niemand lag am Boden. Niemand schien in dem explodierten Wagen zu sitzen. Und ich hatte nicht einmal einen Feuerlöscher. Oder doch? Natürlich! In meinem Peugeot, neben dessen offener Fahrertür ich eben noch gestanden hatte, musste einer sein. Irgendwo, seit Ewigkeiten unbenutzt. Unter dem Fahrersitz?
Ich fand das rote Ding sofort, zerrte es heraus, etwas fiel zu Boden, ich ließ es liegen und rannte zu dem dunklen Geländewagen, aus dem die Flammen mit jeder Sekunde höher schlugen. Porsche Cayenne, notierte ich, Farbe: schwarz, dunkel getönte Scheiben.
Es knisterte und knackte und prasselte. Offenbar konnte ich inzwischen auch wieder hören. Die Geräusche waren in die Welt zurückgekehrt. Und die Gerüche. Es stank nach verbranntem Plastik und verschmortem Gummi.
Unbegreiflicherweise schien wirklich kein Mensch zu Schaden gekommen zu sein, obwohl die Neuenheimer Brückenstraße viel befahren, die Gehwege auf beiden Seiten jetzt, am Samstagvormittag, voller Passanten waren.
Ich zerrte den Sicherungsstift von meinem kleinen, so erbärmlich kleinen Feuerlöscher, drückte die rote Taste. Etwas Weißes zischte heraus. Zu schwach, zu dünn, viel zu wenig. Schon Sekunden später zischte nichts mehr, die Flammen schlugen höher als zuvor, mein Gesicht glühte von der Hitze. Die Bombe schien unter dem hinteren Teil des Wagens gesessen zu haben. Vermutlich genau unter dem Tank.
Jemand rief mir etwas zu. Ein älterer, stämmiger Mann mit Kugelglatze. Zehn, zwölf Meter von mir entfernt. Näher wagte er sich nicht heran.
„Weg da!“, brüllte er und gestikulierte wild. „Die Kiste kann jeden Moment in die Luft gehen!“
Er hatte recht. Ich wich zurück. Stieß gegen ein Auto, das hinter dem Cayenne parkte, kam ins Straucheln. Der Feuerlöscher glitt mir aus der Hand, kullerte irgendwohin.
„Ganz schön mutig“, meinte der aufgeregte Mann und hieb mir kräftig auf die Schulter. „Also, ich hätte mich das nicht getraut, mein Gott!“
Er steckte in einem verschossenen, viel zu bunten Trainingsanzug, war einen Kopf kleiner als ich und hatte die Gesichtsfarbe eines Babys, dem man zu viele Karotten gefüttert hat.
„Mein Feuerlöscher ist zu klein“, stellte ich überflüssigerweise fest und wunderte mich, dass meine Stimme fast normal klang.
„Wenn Sie vorhin nicht umgekehrt wären…“, stieß der Mann keuchend hervor, während er unverwandt den brennenden und qualmenden Cayenne beobachtete. „Ich muss schon sagen!“
Die nervtötende Alarmsirene heulte immer noch. Sie kam mir sogar noch lauter vor als vorhin. Konnten Sirenen mit der Zeit lauter werden?
„Was?“, fragte ich verwirrt.
„Na, da!“ Er wies auf meinen etwas entfernt am Straßenrand parkenden Peugeot, dessen Fahrertür immer noch offen stand. „Hätte böse ins Auge gehen können, wenn Sie vorhin nicht umgekehrt wären! Erinnern Sie sich denn nicht? Sie sind noch mal zu Ihrem Auto zurück, und das dürfte Ihnen wohl das Leben gerettet haben.“
Endlich verstand ich, was er meinte. Mir wurde kalt. Ich war aus meinem Wagen gestiegen–wann? vor einer Minute, vor zweien, vor zehn?–und hatte mich auf den Weg gemacht. Zum Geldautomaten in der kleinen Bankfiliale, vor deren Schaufenstern ich momentan etwas hilflos herumstand und deren Alarmanlage immer noch plärrte, obwohl doch offensichtlich nichts beschädigt war. Keine der großen Scheiben hatte auch nur einen Sprung. Dahinter bunte Werbung. Günstige Baukredite. Unverzichtbare Versicherungen. Sensationelle Tagesgeldzinsen nur noch bis zum Ende des Monats.
Richtig, ein wenig Bargeld hatte ich schnell holen wollen, fürs Wochenende. Am Vorabend war ich wegen dieses Toten im Neckar nicht mehr dazu gekommen. Bevor ich hier angehalten hatte, war ich in Theresas und meinem Liebesnest gewesen, nur zwei Ecken entfernt, und hatte endlich den Duschkopf zum Entkalken in Essigreiniger gestellt. Das hatte ich schon seit Ewigkeiten vorgehabt, aber immer wieder vergessen. Und auf dem Heimweg hatte ich rasch noch ein paar Scheine aus dem Automaten ziehen wollen.
Überraschenderweise hatte ich sofort einen Parkplatz gefunden. Auf halbem Weg vom Auto zur Bank war mir eingefallen, dass meine Brieftasche noch auf dem Beifahrersitz lag. So hatte ich noch einmal kehrtgemacht, mich einen Idioten geschimpft und wieder einmal gefragt, ob ich auch früher schon so schusselig gewesen war oder ob das die ersten Anzeichen von Altersdemenz waren. Und als ich mich in meinen Wagen beugte, um das Vergessene zu holen, war der Cayenne in die Luft geflogen.
Ja, buchstäblich in die Luft geflogen.
Die Erde hatte gebebt bei der Explosion.
Und meine Vergesslichkeit hatte mir wohl tatsächlich das Leben gerettet. Hätte ich meine Brieftasche nicht im Wagen liegen lassen, dann wäre ich jetzt vermutlich tot.
Warum musste diese dämliche Alarmanlage nur so einen Höllenlärm machen? Man konnte ja keinen klaren Gedanken fassen bei diesem Geheule!
Mir war ein wenig schwindlig. Ich war es nicht gewohnt, an einem sonnigen Samstagvormittag mit knapper Not dem Tod von der Schippe zu springen. Wir hatten Ende April, und nach einem ungewöhnlich langen und kalten Winter war in den letzten Tagen mit Macht der Frühling ausgebrochen.
Bis eben war die Luft noch voller Fliederduft und guter Laune gewesen.
Jetzt stank sie nach verbranntem Cayenne.
Die Feuerwehr! Weshalb war mir das nicht früher eingefallen? Ich zückte mein Handy, drückte die entsprechenden Tasten. Der Bombenanschlag war unserer Leitstelle schon bekannt, die Feuerwehr längst auf dem Weg. Ich hörte auch schon die Signalhörner in der Ferne.
Das immer noch heftig lodernde Wrack parkte nicht vor der Bank, sondern vor einem Nachbarhaus, einem frisch renovierten und sehr gepflegten Altbau, in dessen Erdgeschoss sich eine Apotheke befand. Die Bank dagegen residierte in einem phantasielosen, zitronengelben Fünfziger-Jahre-Kasten.
Bei der Apotheke hatte es–im Gegensatz zur Bank–erheblichen Sachschaden gegeben. Hinter gesprungenen Schaufensterscheiben sah ich bleiche, zu Tode erschrockene Gesichter.
Die Martinshörner kamen rasch näher.
„Mann, hat das vielleicht gescheppert!“, stellte der Glatzkopf neben mir zugleich fassungslos und befriedigt fest. „Na ja, man hat ja praktisch darauf gewartet, dass hier mal was passiert.“
Er sprach mit dem Akzent eines Menschen, der aus Norddeutschland stammt, aber schon seit Jahrzehnten im Süden lebt. Trotz des beißenden Brandgeruchs stellte ich fest, dass sein Trainingsanzug lange keine Waschmaschine mehr von innen gesehen hatte.
„Ey, was ist das denn für’ne Scheiße?“, schimpfte ein junger Mann, der plötzlich neben mir aufgetaucht war, mit greller Stimme. „Wer macht denn so eine Scheiße, ey?“
„Das ist Ihr Wagen?“ Mit einem Mal war ich wieder in der Gegenwart angekommen.
Der junge Mann war größer als ich, schlaksig und muskulös zugleich und im Augenblick etwas blass um die Nase. Wie viele Großgewachsene versuchte er sich kleiner zu machen, indem er den Rücken beugte und den Kopf nach vorne neigte. Er trug einen hellgrauen Anzug und schwarze Halbschuhe aus einem jener Läden, in deren Schaufenstern die Preisschildchen immer so liegen, dass man sie nicht entziffern kann.
„War meine Karre, muss man ja wohl sagen“, zeterte er. „Zahlt bei so was eigentlich die Versicherung?“
Der Besitzer des Cayenne war dunkelhaarig und rollte das R, als stammte er aus dem Osten. Ansonsten war sein Deutsch nahezu akzentfrei. Auch seine kräftigen Hände waren dunkel behaart, an der Rechten protzte ein Siegelring. Und wenn er nicht gerade dabei zusah, wie sein geliebtes Auto sich in einen rußigen Schrotthaufen verwandelte, war er vermutlich gut gebräunt im Gesicht. Seine goldene Armbanduhr war gewiss mehr wert als mein altes Auto.
„Ah!“, rief der Glatzkopf erfreut. „Die Bullerei ist auch schon da!“
Gleich zwei Streifenwagen bremsten. Die Kollegen hatten sich offenbar während der Fahrt per Funk abgesprochen. Einer stellte sich etwa fünfzig Meter nördlich vom Ort der Explosion quer, der zweite ein Stück weiter südlich. Die Kollegen sprangen aus ihren Wagen und begannen, mit energischen Bewegungen den sich stauenden Verkehr weiterzuwinken, um Raum für die anrückende Feuerwehr zu schaffen. Und die kam auch schon. Der Jeep mit dem Einsatzleiter vorneweg, gefolgt von zwei schweren Gerätewagen.
Die Martinshörner erstarben, und sofort hörte man wieder das nervenzermürbende Gejaule der Alarmanlage. Türen sprangen auf, Männer in schweren Monturen begannen, ohne Hast und Aufregung das zu tun, was sie schon tausendmal getan hatten.
„Also, echt, Mann!“ Der junge Mann im teuren Anzug trat mit dem Fuß auf wie ein trotziges Kind. „Diese dreimal verfickten Drecksäue!“
Ich hielt ihm meinen Dienstausweis unter die Nase.
„Gerlach, Kriminalpolizei“, erklärte ich dem verdutzten Angebertypen. „Können wir uns irgendwo unterhalten, wo es ein bisschen ruhiger ist?“
Zwei uniformierte Kollegen kamen auf mich zugelaufen. Ein älterer, bulliger Mann und eine schmale, vielleicht dreißigjährige und offensichtlich gut trainierte Frau.
„Sie?“, fragte der Mann keuchend. „Was macht denn der Kripochef persönlich hier? Und wie sind Sie überhaupt so schnell hergekommen?“
Ich berichtete den beiden in knappen Worten, was in den letzten Minuten geschehen war.
„Wenn das mal kein Anschlag auf Sie gewesen ist, Herr Kriminaloberrat!“, stieß die Kollegin mit runden Augen hervor.
„Wie kommen Sie denn auf so was?“
Noch während ich sprach, wurde mir bewusst, dass ihre Befürchtung nicht völlig unberechtigt war. In Sekundenschnelle ging ich die letzten Wochen und Monate durch. Wen hatte ich ins Gefängnis gebracht? Wer hatte mir gedroht, Verwünschungen ausgestoßen? Es fiel mir niemand ein. Als Täter kam natürlich auch jemand in Frage, den ich längst vergessen hatte. Der vor Jahren Rache geschworen hatte und vielleicht erst seit Kurzem wieder auf freiem Fuß war. Als Kripobeamter macht man sich eine Menge Feinde über die Jahre.
Zwei behelmte Männer näherten sich dem brennenden Cayenne–den man inzwischen kaum noch als solchen erkannte– mit großen Feuerlöschern in den Händen. Schaum schoss ins Feuer. Tausendmal mehr Schaum als vorhin aus meinem Spielzeug.
Und dann war es auch schon vorbei.
Das Feuer war aus.
Nur die Alarmanlage der Bank schien niemals wieder verstummen zu wollen.
2
„Worauf haben Sie gewartet?“, fragte ich den immer noch schwitzenden Glatzkopf.
„Was?“ Verständnislos sah er mich an. „Wie?“
„Sie sagten eben, Sie hätten praktisch damit gerechnet, dass hier mal etwas passiert.“
„Ach, das.“ Er wandte den Blick ab. Machte eine fahrige Bewegung zur Straße hin. „In letzter Zeit hat sich hier so ein komischer Kerl rumgetrieben. Mir war im ersten Moment klar, der führt nichts Gutes im Schilde, so…“ Er schluckte. „Na ja, wie der ausgesehen hat.“
„Wie genau hat er denn ausgesehen?“
„Irgendwie südlich.“ Er hob die gut gepolsterten Schultern. „Ich habe ihn für einen Araber gehalten, ehrlich gesagt, und von denen kommt ja zurzeit nicht viel Gutes, nicht wahr? Jung ist er gewesen. Zwanzig, maximal fünfundzwanzig. Und schlank und nicht besonders groß. Dunkelhaarig, sagte ich das schon? Und so einen stechenden Blick hat der gehabt, ist einem durch und durch gegangen.“
„Wann haben Sie den jungen Mann zum ersten Mal hier gesehen? Und wann zuletzt?“
„Zum ersten Mal…“ Er dachte nach, ohne den Blick von dem immer noch qualmenden Wrack zu wenden. „Anfang der Woche dürfte das gewesen sein. Montag oder Dienstag.“ Endlich sah er mir ins Gesicht. „Und zuletzt? Vor einer halben Stunde vielleicht. Vorhin ist er jedenfalls noch da gewesen, da bin ich mir sicher. Jetzt ist er natürlich verschwunden.“
Unwillkürlich sahen wir uns beide um, aber ein Mann, auf den die Beschreibung passte, war nirgendwo zu entdecken.
„Wo hat er gestanden?“
„Immer da drüben.“ Mein Gesprächspartner deutete auf die Ecke der Bank, wo sich der Eingang befand und die Schröderstraße in die Brückenstraße mündete.
„Und was hat er gemacht?“
„Na, geguckt.“
„Wohin?“
„Da rüber!“ Eine ungeduldige Handbewegung zur gegenüberliegenden Straßenseite hin. „Der baldowert was aus, habe ich mir schon am ersten Tag gedacht. Hat nicht viel gefehlt, und ich hätte die Polizei gerufen. Hab ich dann aber doch lieber gelassen. Man weiß ja, wie das ist mit den Ausländern.“
Aus irgendeinem Grund, und nicht nur wegen seines Körpergeruchs, war mir der Mann unsympathisch. Deshalb klang es vermutlich nicht allzu freundlich, als ich fragte: „Wie ist es denn so mit den Ausländern?“
„Na ja, am Ende steht man als ausländerfeindlich da. Und deshalb habe ich dann doch nicht angerufen. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir den Salat.“
Die Löscharbeiten waren beendet, die Feuerwehrleute schon dabei, ihre Gerätschaften zusammenzupacken. Ich pickte mir den Ranghöchsten meiner immer zahlreicher werdenden uniformierten Kollegen heraus, einen Polizeihauptmeister mit Eselsgesicht, und gab einige Anweisungen.
„Das Wrack absperren, damit keiner anfängt, hier Souvenirs zu sammeln. Zeugen identifizieren. Niemand geht hier weg, bevor seine Personalien aufgenommen sind und gegebenenfalls seine Aussage notiert ist. Ich erwarte später eine Liste von Ihnen mit sämtlichen Namen und allen Fahrzeugen, die in der Straße parken. Außerdem lassen Sie in den umliegenden Häusern an jeder Tür klingeln und fragen, ob jemand zufällig aus dem Fenster gesehen und etwas beobachtet hat. Und, ach ja, fordern Sie die Spurensicherung an und einen Brandsachverständigen.“
Der überrumpelte Kollege, so viel Verantwortung sichtlich nicht gewohnt, nickte betroffen zu jedem meiner Sätze.
„Wird gemacht“, stammelte er. „Sie können sich auf mich verlassen, Herr Kriminaloberrat.“
Vermutlich hatte er die Hälfte schon wieder vergessen.
„Da können Sie gleich bei mir anfangen“, erklärte der Glatzkopf fröhlich. „Ich habe zwar nichts gesehen, aber umso mehr gehört. Ich wohne nämlich zwei Stockwerke über der Bank. Ehrlich gesagt, ich dachte, das Haus stürzt ein!“
Große Dieselmotoren wurden angelassen. Die Feuerwehr rückte ab. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass die Alarmsirene schon seit Sekunden schwieg. Der schwarz uniformierte Mitarbeiter eines privaten Wachdienstes, der sie ausgeschaltet hatte, kletterte eben wieder in seinen ebenfalls schwarzen Kleinwagen. Ich lief zu ihm, packte ihn am Ärmel.
„Bei der Bank ist alles in Ordnung?“, fragte ich.
Er strahlte mich mit sonnigem Lächeln an. „In bester Ordnung sogar. Waren nur die Glasbruchsensoren an den Scheiben, die den Alarm ausgelöst haben.“
Er nickte mir freundlich zu und fuhr davon.
Auch ein erster Pressefotograf war inzwischen aufgetaucht und schoss aus allen denkbaren Perspektiven Fotos vom sensationellen Event-„Bombenanschlag in Heidelberg“. Ich sah die Schlagzeilen schon vor mir. „Al-Qaida jetzt auch in der Kurpfalz?“
Mitdenkende Kollegen hatten inzwischen die Straße mit Flatterband abgesperrt, wodurch natürlich auch der Straßenbahnverkehr zum Erliegen gekommen war. Aber daran war im Moment nichts zu ändern. Die Fahrer der Wagen, die nicht weiterkamen, versuchten zu wenden, was den meisten auch gelang. Allmählich kehrte wieder so etwas wie Ordnung und vor allem Ruhe ein.
Ein Kastenwagen mit dem Emblem eines lokalen Fernsehsenders auf der Tür hielt mit quietschenden Bremsen unmittelbar vor der Absperrung. Ein Hüne mit dunklen Flecken unter den Achseln kletterte heraus, wuchtete sich eine Kamera auf die Schulter und begann zu filmen, was es noch zu filmen gab.
„Wo ist eigentlich der Geschädigte geblieben?“ Ich sah mich um. Der Angeber mit der goldenen Armbanduhr war verschwunden.
„Da lang.“ Die durchtrainierte Kollegin deutete auf ein kleines Restaurant auf der gegenüberliegenden Straßenseite, über dessen Tür in altertümlich geschwungenen, hellblauen Neonbuchstaben „Bella Napoli“ stand.
„Sie kommen bitte mit.“ Ich gab der Frau einen Wink. „Den Herrn sehen wir uns mal ein bisschen genauer an.“
Während ich, gefolgt von der jungen Kollegin, die Straße überquerte, zückte ich mein Handy und wählte Sven Balkes Nummer. Er war in der Nähe des Fundorts unserer Wasserleiche unterwegs, erfuhr ich, und half einigen Kollegen beim Absuchen der Neckarufer. Sie hofften, dort etwas zu finden, das uns Anhaltspunkte zur Identität des Toten oder seines Mörders liefern könnte.
Zwei angetrunkene Angler hatten die Leiche des zwischen dreißig und vierzig Jahre alten Mannes am Vorabend entdeckt, westlich von Edingen, etwa zehn Kilometer flussabwärts von Heidelberg. Der Tote war unbekleidet gewesen und hatte nach Meinung des Arztes schon einige Tage im Wasser gelegen. Nun wurden im Neckar–wie in jedem Fluss–hin und wieder Leichen angeschwemmt. Was uns allerdings alarmiert hatte: Diese hatte ein Einschussloch in der Stirn. Der Mann, den wir auf Grund seines muskulösen Körpers und großflächiger Tätowierungen eher den unteren Gesellschaftsschichten zurechneten, war an einem Schuss aus kurzer Entfernung gestorben, genau zwischen die Augenbrauen. An seinen Handgelenken hatten meine Spurenspezialisten zudem blaue Fasern gefunden, die vermutlich von einem Kunststoffseil stammten, wie man es in jedem Baumarkt für wenige Euro kaufen kann.
Bei meiner Ersten Kriminalhauptkommissarin Klara Vangelis hatte ich mehr Glück als bei Sven Balke. Trotz Samstag war sie in der Direktion und versuchte, unseren unbekannten Toten anhand der aktuellen Such- und Vermisstenmeldungen zu identifizieren. Ich bat sie, die Wasserleiche fürs Erste Leiche sein zu lassen und schleunigst herzukommen. Ich brauchte hier dringend jemanden mit Erfahrung und Überblick.
Im Inneren des Bella Napoli duftete es nach guter italienischer Küche, obwohl noch keiner der adrett mit Blümchen und rosafarbenen Kerzen dekorierten Tische besetzt war. Der stämmige Wirt mit silbergrauem, kurz geschnittenem Haar kam mir mit freundlich-verstörter Miene und auf einen schwarzen Stock gestützt entgegengehumpelt. Sein linkes Kniegelenk schien steif zu sein. Auf den ersten Blick wirkte er nicht wie ein Neapolitaner, sondern eher wie ein knorriger Bauer aus den tiefsten Abruzzen. Sein Körper war eckig, das Gesicht markant, über dem Mund ein buschiger, ebenfalls ergrauter Schnauzbart. An der Theke langweilten sich zwei ausgesucht attraktive Bedienungen, eine hochgewachsene Rothaarige und eine Dunkle mit blau-schwarz schimmerndem Haar. Den Besitzer des Cayenne entdeckte ich nicht.
„Sehrrr schlimme Sache!“, knarrte der Wirt und reichte mir eine kurze und außerordentlich kräftige Hand. „Sie Polizei?“
Ich ließ ihn meinen Ausweis sehen und stellte mich vor. Die Zähne, die er beim breiten Lächeln entblößte, sahen schlecht aus.
„Ich Anton“, erklärte er mit devoter Verbeugung und quetschte gleich noch einmal meine Hand. „Anton Schivkov. Kommen von Bulgarien.“
„Wo ist der junge Mann geblieben, der hier vor ein paar Minuten reingekommen ist?“
„Slavko gegangen hinten. Telefonieren. Junge Leut immer telefonieren, immer, nicht wahr?“
In einer Mischung aus ängstlicher Erwartung und Bitte um Nachsicht grinste er mich an. Bulgarien zählte offenbar zu den Ländern, wo man Vertretern der Staatsgewalt noch Respekt zollte.
„Ich möchte ihn sprechen“, erklärte ich streng. „Wenn möglich, gleich, bitte.“
Der alte Bulgare humpelte eilfertig davon und verschwand durch die Tür zur Küche.
Das Lokal war einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Warme Farben, viel helles Holz. Unaufdringliche Bilder an der Wand zeigten Fischerdörfer und Sonnenuntergänge am Meer. Mochte der Wirt auch vom Balkan stammen – nach den Gerüchen zu schließen, die aus der Küche drangen, war der Koch Italiener.
Inzwischen war es halb zwölf geworden, wie eine mit drei glutäugigen Grazien bemalte Uhr über der blitzsauberen Theke anzeigte. Ich fragte mich, ob die Fischerdörfer in Italien oder in Bulgarien lagen. Lag Bulgarien überhaupt am Meer? Gab es dort Fischer? Ich wusste so gut wie nichts über dieses Land, wurde mir bewusst, außer, dass es seit einigen Jahren irgendwie zur Europäischen Union gehörte und auch wieder nicht.
Aus der Küche hörte ich einen kurzen und heftigen Wortwechsel in einer unverständlichen Sprache, dann erschien der gehbehinderte Wirt wieder, gefolgt von dem Mann, den er Slavko genannt hatte. Der hielt sein Wichtigtuer-Handy noch in der Hand.
In meinem Rücken öffnete sich die Eingangstür. Eine weitere aufsehenerregende Dunkelhaarige stöckelte an mir vorbei, nickte dem Wirt zu und verschwand mit gesenktem Blick und wiegendem Modelschritt durch eine zweite Tür, die vermutlich ins Treppenhaus und zu den Toiletten führte.
Slavko hieß mit Nachnamen Dobrev und war um drei Ecken mit dem Wirt verwandt. Er lebte schon seit Jahren in Heidelberg, erzählte er bereitwillig, und war mit einer waschechten Handschuhsheimerin verheiratet.
Der Wirt hatte sich einen Stuhl genommen und gesetzt, das steife Bein von sich gestreckt. Nun beobachtete er seinen jungen Verwandten mit einer Miene, als würde er nicht zögern, ihn mit seinem Stock zu verprügeln, sollte er sich nicht anständig aufführen.
„Ich bin Deutscher, wissen Sie“, erklärte Slavko Dobrev stolz und versenkte sein Edelhandy in einer Tasche seiner teuren Anzugjacke.
„Was sind Sie von Beruf?“
„Alles Mögliche.“ Er wechselte einen Blick mit dem Wirt. Grinste. „Zurzeit helfe ich meinem Onkel mit dem Lokal.“
Und davon konnte man sich Joop-Anzüge leisten und ein Smartphone und eine Protzarmbanduhr und einen Porsche Cayenne, dachte ich.
Laut sagte ich: „Wer war das?“
„Wer war was?“
„Sie wissen, was ich meine.“
„Sie meinen, wer mein Auto…? Ich hab keinen blassen Schimmer. Ehrlich.“
„Mit wem haben Sie gerade telefoniert?“
Eine Spur zu zögernd hob er die Schultern.
„Mit meiner Frau. Wollt ihr sagen, was passiert ist, bevor sie es im Radio hört und sich Sorgen macht.“
„Sie haben vorhin eine Bemerkung gemacht, als wüssten Sie ganz genau, wer hinter dem Anschlag steckt.“
Nun begann Dobrev zu schwitzen.
„Der Schock“, brummt er unglücklich. „Da sagt man schnell mal was.“
„Herr Dobrev“, sagte ich förmlich, „Sie wissen ganz genau, wer hinter dem Anschlag steckt. Zumindest haben Sie einen Verdacht.“
„Einen Dreck weiß ich, fuck!“ Er schlug sich mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. „Ich bin hier das Opfer, Mann! Meine Karre war nagelneu, und jetzt ist sie Schrott! Siebzigtausend Mücken sind im Arsch, und ich hab keine Ahnung, ob mir irgendwann irgendeine Scheißversicherung auch nur einen Cent davon ersetzt!“
Bereitwillig zeigte er mir den Kfz-Schein und seinen Personalausweis. Der Cayenne war auf seinen Namen zugelassen und tatsächlich erst vier Monate alt. Zwischenzeitlich hatte eine weitere Bedienung das Lokal durchquert, dem Wirt zugenickt, Dobrev ignoriert und war nach hinten verschwunden. Demnächst würden vermutlich die ersten Gäste auftauchen. Ich notierte mir Namen und Anschrift der beiden Männer. Der Wirt wohnte in einem gemieteten Haus in Wieblingen im Westen von Heidelberg, sein merkwürdiger Neffe in einer Etagenwohnung in Handschuhsheim.
Ich gab Dobrev seine Papiere zurück.
„Wie lange hat der Cayenne da drüben gestanden, bevor es gekracht hat?“
„Paar Minuten“, murmelte Slavko unglücklich. „Bin beim Großmarkt gewesen, Gemüse kaufen und Fleisch und Fisch. Grad war ich fertig mit den letzten Kisten und komm wieder aus der Küche, und da–rums!“
„Da haben Sie ja ganz schön Glück gehabt!“
„Kann man wohl sagen, ja“, erwiderte er mit gesenktem Blick.
„Und Sie wissen wirklich nicht, wer hinter dem Anschlag steckt? Wer Sie unbedingt tot sehen möchte?“
„Nein. Weiß ich nicht.“
Es hatte keinen Sinn, hier weiterzubohren. So wandte ich mich wieder an den Wirt, dessen Blick an meinen Lippen klebte.
„Haben Sie vielleicht einen Verdacht, wer hinter dem Anschlag auf Ihren Neffen stecken könnte?“
„Nix weiß.“ Erschrocken schüttelte er den Kopf. „Ich gerne helfen, bitte glauben. Ich Polizei immer helfen. Deutsch Polizei gut!“ Er schenkte meiner Kollegin einen bewundernden Blick. „Und viel schöne Frrrau!“
Aus den Augenwinkeln bemerkte ich, wie sie ein wenig größer wurde und glücklich errötete.
„Fahren Sie auch hin und wieder mit dem Wagen Ihres Neffen? Könnte die Bombe Ihnen gegolten haben?“
Er zog eine ratlose Miene. „Warum tun? Ich friedliche Mensch. Slavko friedliche Mensch. Wir keine Feinde.“
„Konkurrenten vielleicht? Die Sie um den Erfolg Ihres Restaurants beneiden?“
Die Falten in seinem wettergegerbten Gesicht wurden noch tiefer. Anton Schivkov schüttelte betrübt das kantige Haupt.
„Wir Friede mit alle Menschen. Wir Gast in Deutschland. Deutschland gut. Wir keine Feinde. Deutschland gut.“
„Schon komisch“, meinte die Polizeimeisterin, als wir in die laue, immer noch ein wenig nach verbranntem Gummi stinkende Frühlingsluft hinaustraten.
„Was finden Sie komisch?“
„Wie viele Bedienungen der hat. So teuer ist das da doch gar nicht, dass der sich so viel Personal leisten kann.“
Ich blieb mitten auf der Straße stehen. „Ich verstehe nicht ganz…“
Eine Straßenbahn bimmelte mich an. Offenbar hatte man die Sperrung der Straße schon wieder teilweise aufgehoben, sodass die Straßenbahnen wieder durchkamen. Für den Autoverkehr war sie allerdings nach wie vor gesperrt. Ich ging ein paar Schritte weiter, um den Schienennahverkehr nicht weiter zu behindern.
„In der Zeit, die wir da drin gewesen sind, sind drei Bedienungen reingekommen, und eine hübscher als die andere. Und zwei sind ja vorher schon da gewesen.“
Mir kam ein böser Verdacht. Der Neffe mit der teuren Armbanduhr. Das Zuhälterauto mit den dunklen Scheiben…Wieder zog ich mein Handy heraus. Während ich auf das Rufzeichen wartete, registrierte ich, dass in der Zwischenzeit Klara Vangelis angekommen war. Wie üblich trug sie ein von eigener Hand maßgeschneidertes dunkles Kostüm. Ihre schwarzen Locken schimmerten im Sonnenlicht. Sie winkte mir kurz zu und sprach dann weiter mit dem Chef der Spurensicherung, der ihr mit großen Gesten etwas erklärte.
Sekunden später hatte ich den Chef des Sittendezernats am Ohr, Hauptkommissar Kollisch. Er war nicht amüsiert über die Störung seines Wochenendfriedens im Schrebergarten. Aber nachdem er gebührend geschimpft hatte, ließ er mit sich reden. Was blieb ihm übrig? Schließlich genehmigte ich seine Urlaubsanträge.
„Klar kennen wir die zwei Früchtchen“, maulte er. „Die Bulgaren haben wir schon eine ganze Weile auf dem Radar.“
„Das heißt, das Bella Napoli ist in Wirklichkeit ein getarntes Bordell und gar kein Restaurant?“
„So würd ich das nicht sagen. Man kann da ja essen, es wird gekocht und alles. Und der alte Schivkov kann natürlich Bedienungen einstellen, so viele er lustig ist. Was in den Zimmern darüber läuft, was seine Kellnerinnen in ihrer Freizeit machen, ist eine andere Geschichte.“
„Darf er als Bulgare hier überhaupt so ohne Weiteres ein Lokal eröffnen?“
„Der Mann ist Deutscher, Herr Gerlach.“
„Der Alte?“
„Nein, der Junge. Die Konzession läuft auf Dobrev. Aber auch wenn es anders wäre–Bulgarien gehört zur EU. Er müsste bloß das Frikadellenabitur machen.“
„Das was?“
Kollisch lachte gutmütig. „Ein vierstündiger Kurs. Grundlagen der Hygiene, bisschen Lebensmittelrecht, das ist alles. Dann können Sie loslegen und Ihr Gourmetrestaurant aufmachen.“
„Und die Mädchen wohnen alle in den Zimmern über dem Lokal? Wie viele sind das?“
„Mal vier, mal sechs, mal acht. Es schwankt.“
„Ich nehme an, die Damen stammen ebenfalls aus Bulgarien?“
„Das nehmen Sie richtig an. Normalerweise sind es Studentinnen, die sich hier ein, zwei Auslandssemester gönnen. Alles ganz legal und nicht zu beanstanden. Manche sieht man sogar hin und wieder an der Uni, habe ich mir sagen lassen. Nebenbei vögeln sie rum, was das Zeug hält, und verdienen sich für ihre Verhältnisse dumm und dämlich. Manche helfen auch ein bisschen im Lokal, und irgendwann verschwinden sie wieder. Dafür kommen andere. So geht der Ringelreihen schon seit Jahren.“
Die Kollegen von der Spurensicherung hatten inzwischen begonnen, das Wrack des Cayenne und seine nähere Umgebung zu untersuchen. Irgendwo begann eine Kirchturmuhr zu schlagen.
Zwölf Uhr. Mittag.
Meine Töchter fielen mir ein, die allein zu Hause saßen und sich vermutlich wunderten, wo ihr Vater wieder einmal blieb.
„Ist Ihnen etwas von Streitereien in Zuhälterkreisen bekannt?“, fragte ich meinen jetzt ein wenig freundlicher gestimmten Dezernatsleiter.
„Nicht, dass ich wüsste. Der Bulgare ist zu klein, als dass die anderen ihn ernst nehmen würden.“
„Wer sind momentan die anderen?“
Das rot-weiße Absperrband um den Cayenne flatterte fröhlich im Wind. Die drei Spurensicherer, von denen man wegen ihrer weißen Schutzanzüge nicht sagen konnte, ob es Männlein oder Weiblein waren, krochen um den Ort der Explosion herum und suchten Zentimeter für Zentimeter den Boden ab. Hin und wieder wurde etwas in ein Klarsichttütchen getan und sorgfältig in eine große, silberne Metallbox gesteckt.
„Bis vor ein paar Jahren haben die Russen den Ton angegeben“, sagte Kollisch. „Später haben sich die Rumänen breitgemacht, aber für die läuft es in letzter Zeit ja nicht so besonders. Momentan ist es eigentlich friedlich in der Szene.“
Ich sah Kollegen, teils in Zivil, teils in Uniform, mit Notizblöcken bewaffnet die Passanten befragen, Personalien feststellen, Aussagen notieren. Auf Klara Vangelis war Verlass. Sie war meine beste und zuverlässigste Mitarbeiterin, die jederzeit klaglos auch an Wochenenden Dienst tat, obwohl sie seit Januar verheiratet war.
Ich verabschiedete mich von Kollisch und wählte, da ich das Handy schon einmal in der Hand hatte, meine eigene Nummer. Es tutete eine Weile, aber niemand nahm ab. Vermutlich schliefen meine Töchter noch und hatten meine Abwesenheit gar nicht bemerkt. Gestern Abend waren sie auf der Geburtstagsparty eines Klassenkameraden gewesen, dem zurzeit angesagtesten Jungen der ganzen Mittelstufe, wie ich ihrem aufgekratzten Getuschel bei den umständlichen und zeitraubenden Vorbereitungen entnommen hatte. Fast zwei Stunden hatten sie damit verbracht, sich aufzuhübschen, und als sie später duftend und gickelnd aufbrachen, sahen sie aus, als ginge es nicht zu einer Party, sondern auf eine schräge Modenschau.
Die Eltern des Geburtstagskinds hatten die Veranstaltung diskret im Auge behalten und ihre jugendlichen Gäste spät nachts sogar nach Hause chauffiert. Nach dem Lärm zu schließen, den meine Mädchen bei ihrer Heimkehr produzierten, musste es eine gelungene Party gewesen sein. Mir graute ein wenig vor den drohenden Berichten, wer sich jüngst in wen verliebt oder mit wem schon wieder zerstritten hatte.
Ich steckte das Handy ein und ging zu meinen Spurenspezialisten hinüber. „Und?“, fragte ich den Chef der Gruppe.
Er hob die Achseln. „Hab’s grad schon der Frau Vangelis erklärt. Der Sprengsatz hat direkt unterm Tank gesessen. Großes Glück, dass der Cayenne ein Diesel gewesen ist und kein Benziner. Sonst würd’s hier ganz anders aussehen. Schade um das schöne Auto.“
„Das Werk ist stilsicher und souverän erzählt (…) Hochspannung ist (…) garantiert.“
Wolfgang Burger ist ein Muss (...)
Burger steht für spannende und gefühlvolle Geschichten mit Grips und Witz.
Burger gelingt die Wanderung auf dem schmalen Grat zwischen augenzwinkernder Beziehungskiste, Psychothriller und Spannungsroman. Gerlach ist etwas Besonderes in der Landschaft deutscher Krimikommissare.
Wolfgang Burger schreibt spannende Psychoklassiker, randvoll von subtiler Ironie.
›Der fünfte Mörder‹ ist somit ein klug konstruierter Kriminalroman, bei dem nicht die Stadt Heidelberg die Hauptrolle übernimmt, sondern die Kripo um Alleinerzieher Gerlach, der sich zu allem überfluss auch noch mit seinen pubertierenden Zwillingstöchtern herumschlagen muss.








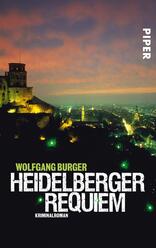


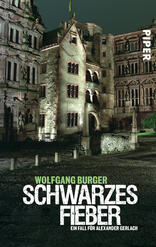
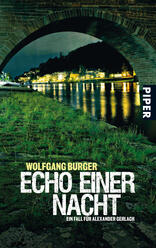













DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.