
Highway to Hellas - eBook-Ausgabe
Roman
„Auf humorvolle Weise wird in dem Schmöker, der sich als leichte Urlaubslektüre eignet, mit Vorurteilen und Länderklischees gespielt.“ - Griechenland Zeitung
Highway to Hellas — Inhalt
Paladiki steht unter Schock: Die Deutschen kommen, um zu schnüffeln! Jörg Geissner - unfreiwilliger Neu-Single und Vollblutspießer - soll die korrekte Verwendung eines Kredits überprüfen. Doch angekommen auf Paladiki beginnt für den Banker eine Odyssee. Angeführt von dem gewitzten Gigolo Panos führen die Inselbewohner den Deutschen an der Nase herum. Geissner muss gegen ihre Schikanen kämpfen wie gegen die Köpfe der Hydra. Doch schließlich kommt er den Einheimischen näher und ihm wird klar: Der Ausgang seiner Reise entscheidet über die Zukunft der Insel. Geissner muss sich die Frage stellen, wem gegenüber er sich wirklich verantwortlich fühlt: Seiner Bank oder den Menschen von Paladiki ...
Leseprobe zu „Highway to Hellas“
1
Die Fähre vibrierte. Jörg Geissner kam sich vor wie in einem Spaceshuttle, das soeben Cape Canaveral verlassen hatte. Seiner Einschätzung nach lag das einzig und allein an der Achse, welche die Schiffsschraube antrieb. Wenn solch eine Antriebswelle auch nur eine winzige Unwucht hatte, dann übertrug sich das auf den gesamten Rumpf und das Schiff begann zu zittern. Das hatte er einmal in einem populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, in dem es um Sollbruchstellen gegangen war. Das Fatale ist, erinnerte er sich, dass sich an solch einem Fehler im [...]
1
Die Fähre vibrierte. Jörg Geissner kam sich vor wie in einem Spaceshuttle, das soeben Cape Canaveral verlassen hatte. Seiner Einschätzung nach lag das einzig und allein an der Achse, welche die Schiffsschraube antrieb. Wenn solch eine Antriebswelle auch nur eine winzige Unwucht hatte, dann übertrug sich das auf den gesamten Rumpf und das Schiff begann zu zittern. Das hatte er einmal in einem populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, in dem es um Sollbruchstellen gegangen war. Das Fatale ist, erinnerte er sich, dass sich an solch einem Fehler im Nachhinein absolut nichts mehr ändern lässt. Es gibt Dinge, die entscheiden sich ganz am Anfang, im Grundsätzlichen. Wenn da gepfuscht wird, krankt das große Ganze. Dann vibriert die komplette Fähre. Wobei, diese Fähre vibrierte nicht nur, sie dröhnte regelrecht, und das ununterbrochen.
Geissner saß auf einem orangefarbenen Sessel, dessen Polster offenbar schon viel Flüssiges gesehen hatten. Der mehrsprachige Deckplan, der an zentraler Stelle neben den Treppen aushing und den Geissner ausführlich studiert hatte, zeigte in einem vielfarbigen Querschnitt den gesamten Aufbau des Schiffes. Ihm hatte Geissner entnommen, dass es sich bei den Sesseln um sogenannte Pullmansitze handelte. Die Sitzreihen waren in dem etwa zehn mal zehn Meter großen Passagierraum fast so dicht hintereinander montiert wie in dem Condor-Flugzeug, mit dem er am Vorabend nach Santorin geflogen war. Wie schon im Flieger stieß Geissner – knapp zwei Meter groß – mit seinen Knien an den Vordersitz.
In einer deutschen Werft wäre so etwas nicht passiert, dachte er, während er dem unablässigen Dröhnen lauschte. Die besten Schiffsmotoren wurden schließlich nach wie vor in Deutschland gebaut. Gut, die Asiaten holten auf, aber die Nase vorn hatten immer noch die Deutschen. Diese Fähre war wieder mal ein kleiner Beweis. Auf dem Deckplan war nämlich ebenfalls zu lesen, dass die Fähre 1996 in Korea gebaut worden war. Es mochte ihm nicht in den Kopf gehen, dass ein Land wie Griechenland, das doch eigentlich traditionell eine große Seefahrernation war, heute sogar in dieser Branche zu großen Teilen vom Ausland abhängig war. Selbst den Chinesen hatten sie bedeutende Werften und Häfen, allen voran Piräus, überlassen! Der Gedanke machte Geissner ein wenig Angst.
Wie lange war er bereits auf diesem Schiff? Eine Stunde? Zwei? Das permanente Dröhnen schien ihm das Zeitgefühl zu rauben. Er blickte auf sein Handy: Sie hatten Santorin vor nicht einmal einer halben Stunde verlassen. Geissner seufzte. Wohl zum hundertsten Mal fragte er sich, wie er diese Reise überstehen sollte. Er hatte von Beginn an mit dem Schlimmsten gerechnet, und nun war alles noch viel schlimmer. Obwohl er nicht mit dem Auto reiste, hatte er die Fähre durch die Garage betreten müssen, in welche zuvor die Autos eingerollt waren. Als er durch die große Luke gegangen war, war ihm das Innere der Fähre wie die Vorhölle vorgekommen. Der ursprünglich blau lackierte Boden war mit Öl verschmiert, die Abgase der Fahrzeuge hatten bei ihm Würgereiz ausgelöst. Offenbar hatte das Autodeck keine ausreichende Lüftung. Es gab auch keine Beschilderung, die den Aufgang zum Passagierdeck auswies. Die Autos und Lkws waren so dicht geparkt, dass er an einigen Stellen nicht zwischen ihnen hatte hindurchgehen können und hatte umdrehen müssen, um einen anderen Weg durch das Labyrinth zu suchen. Als er endlich eine Tür gefunden hatte, hinter der eine Treppe in die Höhe führte, war ihm ein dunkelhäutiger Mann mit ölverschmiertem Overall entgegengekommen, hatte ihm den Durchgang verwehrt und ihn wieder in die andere Richtung geschickt. Gefangen in dem stinkenden Labyrinth, hatte Geissner Schweißausbrüche bekommen, und der Würgereiz hatte sich in akute Atemnot verwandelt. Auch wenn Geissner es niemals zugegeben hätte: Er hatte kurz vor einer Panikattacke gestanden. Als er endlich den Eingang zum Passagierbereich gefunden gehabt hatte, hatte er seinen Augen kaum glauben können – eine silbern schimmernde Rolltreppe führte aus der Hölle des Autodecks nach oben in den Passagierbereich. Natürlich hatte die Rolltreppe erwartungsgemäß nicht funktioniert, und er hatte seinen blauen Rollkoffer und seine Aktentasche die Metallstufen hinaufschleppen müssen. Immerhin war ihm dort oben die Luft bedeutend frischer und kühler vorgekommen, und seine Panik hatte ein wenig nachgelassen.
Geissner ließ seinen Blick durch den Passagierraum schweifen. Er blieb an der königsblauen Auslegeware hängen, die dem Interieur wohl ein maritimes Ambiente verleihen sollte. Doch ähnlich wie die Sitze wies auch der Teppich viele unappetitliche Flecken auf. Obwohl Geissner das Autodeck gerammelt voll vorgekommen war, war der Passagierraum vergleichsweise leer, die meisten der Pullmansitze waren verwaist. Vor ihm saß eine Familie, die Chips aus einer absurd großen Tüte aß und den Boden unter ihren Sitzen vollkrümelte. Das waren sie also, die Nachfahren der einst so großen Seefahrernation. Blasse, Chips essende Gestalten mit dicklichen Kindern. Wären das die Argonauten gewesen, sie wären keine hundert Meter weit gekommen.
Geissner sinnierte oft und gern auf diese Weise. Er wusste, dass andere Menschen das nicht taten, es womöglich sogar seltsam fanden. Geissner jedoch war davon überzeugt, dass gerade die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, sein größtes Kapital in seinem Job war. Neben seinem Interesse für Zahlen und Technik natürlich. Als Kreditmanager musste man sich seiner Ansicht nach möglichst umfassend bilden und auf dem Laufenden sein, ähnlich wie ein Politiker oder ein, ja durchaus, Geheimagent. Schon als Zwölfjähriger hatte er James-Bond-Filme und Yps-Hefte mit ihren Gimmicks geliebt. Er hatte fast sein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben. Als er elf gewesen war, hatte er sich einen tragbaren Kassettenrekorder gekauft, den er mit in die Kinos genommen hatte. Als er vierzehn gewesen war, hatte er alle James-Bond-Filme von Dr. No bis Moonraker auf Kassette aufgenommen. Und noch heute hörte er sie sich ab und an gerne zum Einschlafen an.
Inzwischen bezog er sein technisches Wissen jedoch in erster Linie aus der einzigen Zeitschrift, die er seit Jahren abonniert hatte: das P. M. Magazin, Peter Moosleitners interessantes Magazin. Die meisten Artikel darin fand er tatsächlich interessant. Außerdem mochte er, dass der Name des Magazins seinem Inhalt entsprach, im Gegensatz zu den meisten anderen journalistischen Erzeugnissen. Was, bitte sehr, hatte er Britta einmal gefragt, hat zum Beispiel Der Spiegel mit einem Spiegel zu tun? Oder der Stern mit einem Stern? Wenn bereits beim Titel derart geflunkert wurde, dann konnte doch der Inhalt nur unseriöser Quatsch sein. Britta hatte ihn amüsiert angesehen und ihm einen Kuss gegeben.
Das Dröhnen der Fähre, so schien es Geissner, hatte in den letzten Minuten noch einmal zugenommen. Um sich abzulenken, öffnete er seinen Aktenkoffer und holte die neueste Ausgabe des P. M. hervor. Ein reicher Unternehmer erklärte in einem Artikel über aufblasbare Raumstationen, dass die herkömmlichen Modelle zu schwer, unflexibel und sehr teuer seien. Geissner hätte gerne mehr erfahren, doch die hinter ihm sitzenden spanischen Touristen unterhielten sich in einer Lautstärke, die sogar das Dröhnen übertönte. So konnte sich ja niemand konzentrieren. Ständig stand einer von ihnen auf, um neue Getränke oder Snacks von der kleinen schmuddeligen Bar zu holen. Geissner räusperte sich einige Male geräuschvoll, doch es half nichts – die Spanier beachteten ihn nicht.
Schließlich gab Geissner es auf und beschloss, aufs Außendeck zu flüchten. Umständlich fädelte er sich aus der Reihe der orangefarbenen Sitze und ging zu einer lackierten Stahltür mit Bullauge, die ins Freie führte. Die Federung der Tür war enorm hart eingestellt, er musste alle Kraft aufwenden, um sie aufzustemmen, was mit Rollkoffer und Aktentasche kein einfaches Unterfangen war. Draußen schlug ihm der Wind hart ins Gesicht. Er atmete tief die Seeluft ein. Sie schmeckte salzig und roch fischig. Außer ihm stand nur eine uralte Greisin an Deck, die ihm aufgrund ihrer wie mumifiziert wirkenden Gesichtshaut schon im Flieger aufgefallen war. Sie lächelte zufrieden vor sich hin und blickte auf die Wellen. Ihr Lächeln erinnerte ihn an das Lachen eines Totenkopfes. Ab und an schien sie im Fahrtwind zu schnuppern, wobei ein weicher Ausdruck in ihr Gesicht trat. Geissner fragte sich, was die alte Frau so erfreute. Seitlich, im Dunst am Horizont, konnte Geissner eine kleine Inselgruppe ausmachen. Die felsigen Silhouetten schienen unbewachsen zu sein. Genauso karg wie Santorin, erinnerte sich Geissner, wo er nach zweieinhalbstündigem Flug und einem öligen Abendessen die gestrige Nacht in einem maroden Hotel zugebracht hatte. Er begriff nicht, warum so viele Deutsche die Ägäis abgöttisch liebten, ihre Urlaube hier verbrachten und, wie die alte Frau, offenbar ein sehr emotionales Verhältnis zu ihr hatten. Geissner blinzelte hinüber zu den kleinen karstigen Inseln. Er konnte beim besten Willen nichts erkennen, was derart positive Emotionen auslösen oder rechtfertigen würde. Die Inseln waren völlig kahl und dunstverhangen. Wahrscheinlich unbewohnt.
Geissner beugte sich über die Reling und sah in die Tiefe. Das Wasser direkt unter ihm, am Rumpf der Fähre, war kobaltblau. Eine schöne, erhabene Farbe, zugegeben. Hob man jedoch den Blick und ließ ihn über die Wasseroberfläche gleiten, wurde das Blau immer blasser, bis es sich irgendwann in dem Schleier am Horizont auflöste. Egal wohin Geissner blickte, er sah nichts als eine lebensfeindliche Einöde am – mit Verlaub – Arsch der Welt. Oder besser: Arsch von Europa. Geissner verzog die Lippen zu einem dünnen Grinsen. Ja. Genau. Arsch von Europa. Das passte. Nicht einmal einen Fisch hatte er bisher gesehen.
Er schielte zu der alten Dame hinüber, die mit geschlossenen Augen den Kopf in die Sonne hielt und noch immer lächelte. Sie strahlte eine starke, ganz und gar glückliche Energie aus. Geissner war genervt. Er empfand ihr offensichtliches Wohlbehagen als aufdringlich und ausgestellt. Er wandte sich ab und ging eine kleine steile Treppe hinauf. Sein blauer Rollkoffer verkeilte sich mehrfach in dem Geländer.
Endlich oben angekommen, befand er sich nicht wie erwartet auf dem Oberdeck, sondern stand vor einer Tür, die in die erste Klasse führte. Obwohl er nur ein Ticket für die zweite Klasse besaß, trat er ein und setzte sich auf einen der Plätze. Ihm fiel auf, dass der Raum scheinbar die gleiche Größe und Ausstattung besaß wie der Pullmansitzbereich unten in der zweiten Klasse, nur dass hier die Polsterbespannung nicht orangefarben, sondern blau war. Auch der Abstand zwischen den Sitzen war der gleiche. Bis auf die unterschiedliche Farbe sah auch die Bespannung identisch aus, abgenutzt und schäbig. Das war also die erste Klasse. Sicher doppelt so teuer wie die zweite, dachte Geissner und schüttelte den Kopf über diese Unverfrorenheit der Griechen.
Kaum hatte er sich gesetzt, stand plötzlich ein etwa zehnjähriger Junge vor ihm und starrte ihn an. Der Bub war allem Anschein nach griechischer Abstammung, hatte schwarzes Haar und trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Get my balls“. Er war geradewegs auf Geissner zugekommen, frontal, direkt von vorn. Das fand Geissner ausgesprochen dreist. Woher kam diese Selbstsicherheit und Nonchalance? Der Knirps war vermutlich noch in der Grundschule, schätzte er, sofern die in Griechenland überhaupt noch in Betrieb waren.
Der Junge fragte ihn etwas auf Griechisch. Geissner verstand nichts außer dem Wort „Basketball“. Er hasste es, von Fremden angesprochen zu werden, noch dazu in einer fremden Sprache. Wenn sie dann auch noch die dämliche Basketballfrage stellten, verzweifelte er. Nur weil er zwei Meter und drei Zentimeter groß war, hieß das noch lange nicht, dass er zwangsläufig Basketball spielte. Denn das musste es doch sein, was dieser Dreikäsehoch, der ihn ungeniert anlächelte, wissen wollte. Unwirsch winkte Geissner ab und tat so, als müsste er dringend telefonieren. Der Junge blickte ihn ratlos an.
Geissner machte mit der flachen Hand beschwichtigende Bewegungen in seine Richtung, hielt sich das Smartphone ans Ohr und drehte sich weg. „Hallo?“, rief er einer imaginären Person zu. „Erwerben Sie sämtliche festverzinslichen Wertpapiere! … Wie bitte? Nein, ich spreche von Wertpapieren, nicht von Fonds!“ Geissner lugte mit einem Auge zu dem Jungen. Dieser stand immer noch regungslos da und verfolgte Geissners sonderbares Verhalten. „Kommunalobligationen!“, bellte Geissner in sein Smartphone, um das Dröhnen zu übertönen. Gleichzeitig ließ er dramatisch die Schlösser seiner Aktentasche aufschnappen und kramte in den Papieren. „Dadurch werden KÖRPERSCHAFTEN abgesichert! Das kann doch nicht so schwer sein!“
Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Junge sich entfernte. Der Ordnung halber telefonierte er noch etwas weiter. In Gedanken überschlug er, wie oft es ihm im Leben schon passiert war, dass ihn jemand für einen Basketballspieler gehalten hatte. Überhaupt war seine Größe oft Anlass für Verlegenheitswitze auf Partys oder in Gesellschaften. „Und? Ist die Luft da oben gut?“, oder: „War dein Vater Leuchtturmwärter?“ Geissner ließ sich nie etwas anmerken, doch insgeheim ärgerte er sich darüber. Er hatte sich seine Körpergröße schließlich nicht ausgesucht. Ungefähr mit vierzehn war er enorm in die Höhe geschossen und hatte alle überragt. Dadurch hatte er stets das Gefühl gehabt, ein wenig anders zu sein als die anderen. Hinzu kam, dass er schon in der Schule wegen seiner Größe gehänselt wurde. Bohnenstange, Lulatsch, langes Elend – das waren nur ein paar der Spitznamen, die er von Klassenkameraden verpasst bekommen hatte. Manchmal fragte er sich, ob er es aufgrund seiner Körperlänge damals schwerer gehabt hatte als andere, vor allem mit den Mädchen.
Mit etwa sechzehn Jahren war er in ein Mädchen aus der Parallelklasse verliebt gewesen. Sie hieß Sabine, hatte kurze blonde Haare und volle Lippen. Sie war in der Oberstufe auf Geissners Schule gewechselt und hatte von Beginn an enormen Eindruck auf ihn gemacht.
Eines Morgens, die Schüler strömten gerade ins Schulgebäude, stand der Schuldirektor am Haupteingang. Vielleicht erwartete er einen Lieferanten oder einen Handwerker – wer weiß schon, was Schuldirektoren tun. Geissner wollte gerade das Gebäude betreten, als Sabine direkt vor seiner Nase am Direktor vorbeilief und der Träger ihrer Schultasche riss. Die Tasche fiel zu Boden.
„Scheiße!“, fluchte Sabine.
„Na, na, na! Was du in den Mund nimmst, nehm ich ja nicht mal in die Hand!“, sagte der Direktor zu ihr.
Langsam hob sie den Kopf, lächelte den Direktor an und antwortete: „Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher.“
Der Direktor lief puterrot an, und Geissner konnte eine Erektion nicht verhindern. Von da an wollte er Sabine näher kennenlernen.
Sie fuhr im Sommer immer mit dem Fahrrad in die Schule. Eines Mittags fasste Geissner sich ein Herz und wartete bei den Fahrradständern auf sie. Als Sabine kam, das Trägershirt am Bauch zu einem Knoten gebunden, sodass ihre nackte Taille zu sehen war, sammelte er all seinen Mut und fragte sie, ob sie ein Eis mit ihm essen gehen wolle. Er würde sie auch einladen. Erst sah sie ihn völlig perplex an. Dann fragte sie ihn, ob er spinne. Offenbar wollte sie nicht mit ihm gesehen werden oder hielt ihn für zu langweilig, um Zeit mit ihr verbringen zu dürfen. Eine andere Erklärung für Sabines Verhalten hatte er damals nicht gehabt. Und heute im Grunde auch nicht.
„Gut, bei Peak minus zehn abstoßen. Bis dann!“, beendete Geissner sein fiktives Telefonat und schloss seine Aktentasche.
Es hatte ganze zwei Jahre gedauert, bis er sich getraut hatte, wieder mit einem Mädchen zu sprechen. Um genau zu sein, hatte sie ihn angesprochen. Es war Britta gewesen. Seine Britta. Was war nur schiefgelaufen mit ihnen beiden? Er hatte sich solche Mühe mit ihr gegeben, von Anfang an, dreiundzwanzig Jahre lang. Dann, vor einem knappen halben Jahr, war ihnen ihre Liebe abhandengekommen, und sie hatte sich von ihm getrennt, ganz plötzlich. Sie hatte ihn als „Stalker“ beschimpft, weil er ab und zu bei ihr angerufen hatte – gut, manchmal mehrmals am Tag – und weil sie herausgefunden hatte, dass er ihr Handy übers Internet hatte orten lassen. Aber probierte so etwas nicht jeder einmal aus?
Er lehnte sich zurück und betrachtete sein Gesicht im spiegelnden Display seines Handys, das er noch immer in der Hand hielt. Im Grunde habe er ein sympathisches Gesicht, hatte Britta ihm einmal gesagt. Kein schönes, aber ein sympathisches. Zwar sehe er ein bisschen aus wie eine Maus – spitze Nase, fliehendes Kinn –, dafür habe er leuchtende Augen und ein nettes Lächeln, das er allerdings zu selten zeige. Sein Vater hingegen hatte ihn früher immer spöttisch „eine graue Maus mit technischer Begabung“ genannt. Geissner steckte das Handy in die Innentasche seines Jacketts. Heute hatten er und sein Vater kaum noch Kontakt. Sie schickten sich zum Geburtstag Postkarten, damit sie nicht miteinander sprechen mussten. Es störte ihn nicht. Er hatte nie die Nähe seines Vaters gesucht oder danach gestrebt, ihm ähnlich zu sein. In Geissners Augen war sein Vater sein Leben lang zu emotional und unvorsichtig gewesen, vor allem mit Frauen.
Inzwischen war sein Vater pensioniert und verbrachte die meiste Zeit zu Hause. Dem Drängen von Geissners Mutter, er solle sich doch ein Hobby oder ein Ehrenamt suchen, gab er nicht nach. Er saß entweder im Wohn- oder im Esszimmer, löste ununterbrochen Kreuzworträtsel und sprach so gut wie nie. Vermutlich war sein Schweigen die stumme Rache an seiner Frau dafür, dass sie ihn wie einen Hund an die Leine genommen hatte. Nicht zuletzt aufgrund dieser Entwicklung war Geissner aus Prinzip sehr vorsichtig, wenn er mit Frauen zu tun hatte. Er fand die meisten Damen launisch und unberechenbar.
Als Geissner dann das Abitur bestanden hatte, hatte sein Vater zu ihm gesagt: „Die Geissners sind Kaufleute, das liegt ihnen im Blut. Fang bei mir in der Fabrik an, da kannst du nichts falsch machen.“ Geissner hatte ihm geantwortet, dass er das vergessen könne, schließlich sei er nicht bescheuert. Die Fabrik sei immerhin so gut wie pleite. Als Geissner dann im Bankgewerbe gelandet war, hatte sein Vater gesagt: „Im Prinzip auch Kaufmann!“ Nach der Lehre in der Augsburger AVA-Bank war Geissner übernommen und von seinem Arbeitgeber zum Kreditmanager ausgebildet worden. Der Job hatte sich als Glücksfall erwiesen. Sein ganzes Wesen schien wie dafür geschaffen. Inzwischen war er zwanzig Jahre dabei und hatte sich während dieser Zeit nicht ein einziges Mal die Frage gestellt, ob er das Richtige tat. Britta hatte manchmal gesagt, er sei irgendwo in seiner Entwicklung stehen geblieben, weil er zwar pflichtbewusst sei, aber in keiner Weise nach Karriere, nach Verantwortung, nach Höherem strebe. In seinen Augen jedoch trug Jörg enorme Verantwortung: Er bestimmte, er ganz allein, welches Darlehen einem Kunden bewilligt wurde und welches nicht. Er allein bestimmte, ob sich jemand ein Haus bauen, eine Wohnung oder einen Geländewagen kaufen konnte. Aber auch größere Geschäfte überprüfte er. Ob mit dem Geld seiner Bank Firmen gegründet wurden, Patente in Serie gingen, Arbeitsplätze geschaffen wurden. Mit anderen Worten: Er entschied, ob Träume Wirklichkeit wurden oder nicht. Das Schicksal so vieler Menschen hing allein von ihm ab. Hopp oder top. Stillstand oder Fortschritt. Elend oder Aufbruch. Er hatte es in der Hand. Was für eine größere Verantwortung könnte es geben? Dabei nicht von allen geliebt zu werden konnte er gut aushalten. Die größten Konflikte gab es ohnehin nicht mit den Kunden, die ein Darlehen händeringend benötigten oder nicht zurückzahlen konnten, sondern mit den Kollegen in der Beratungsabteilung, die am liebsten jeden Kredit sofort bewilligen würden. Immer wieder beschwerten sie sich, Geissner vereitle ihnen ein Jahrhundertgeschäft, wenn er Kredite nicht freigab. Dabei überprüfte er anhand der Zahlen lediglich ganz nüchtern das Ausfallrisiko. Überstieg es die zulässige Toleranzgrenze, dann schob er einen Riegel vor, und aus der Sache wurde nichts. Da war er absolut unbestechlich. Seit Frau Dr. Merkels Spar-Appell aus dem Jahr 2008 nannte ihn sein Chef Herr Laichinger unter vier Augen deswegen gerne „Die schwäbische Hausfrau“, was Geissner keineswegs als Beleidigung auffasste, im Gegenteil.
Umso größer die Ironie, dachte er bitter, dass ausgerechnet seine Zuverlässigkeit ihm nun diesen Höllentrip eingebracht hatte.
2
Panagiotis Kritikakis saß vor seinem kleinen Minimarkt und rauchte eine Zigarette. Mit schräg gelegtem Kopf blickte er auf den Stapel internationaler Groschenromane, der vor dem kleinen Häuschen an der Hafenkante von Paladiki-Ort lag und den er schon lange einmal alphabetisch sortieren wollte. Doch seine Kunden – im Sommer überwiegend Touristen – brachten stets ein solch verheerendes Chaos in seinen Laden, dass er es immer wieder bleiben ließ. Nach drei Tagen wären die Bücher ohnehin wieder völlig durcheinander.
Langsam inhalierte er den Rauch seiner Zigarette. In den letzten Jahren hatte er sein Sortiment immer weiter aufgestockt. Neben Zeitschriften, Lebensmitteln und einer großen Auswahl an alkoholischen Erfrischungsgetränken gab es auch Bürobedarf, Tabakwaren, schöne, lustige oder frivole Postkarten, DVDs, Anglerbedarf, Gesellschaftsspiele, Reiseführer, CDs, gerahmte Gemälde, Kondome und weitere Drogerieerzeugnisse, Andenken aller Art, Sandalen, Tupperware, Flossen, Taucherbrillen und ausgesucht schöne Bademode für sie und ihn.
In seinem Shop war den ganzen Vormittag schon wenig los gewesen. Es war Anfang Juni, die Saison hatte gerade begonnen, und täglich stiegen neue Touristen von der Fähre. Panagiotis, der von allen nur Panos genannt wurde, war zuversichtlich, dass dieser Sommer ein guter werden würde. Die letzten beiden Jahre waren schwierig gewesen. Nicht so sehr für ihn als für die Insel insgesamt. Einige Hotels und Restaurants hatten das Ausbleiben der Sommergäste vom Festland nicht überlebt, und natürlich hatte auch er Einbußen gehabt. Viele Einwohner Paladikis, allen voran die Rentner und Familien, kauften weniger bei ihm, nachdem ihnen die Pensionen und Zuschüsse dramatisch gekürzt worden waren. Wie stark diese Einbußen waren, wusste er nicht genau. Er hatte noch nie Buch geführt, obwohl das neuerdings gesetzlich vorgeschrieben war. Doch die Gesetze scherten Panos nicht. Athen war weit weg, und auf Paladiki hatte man seit Menschengedenken eigene Gesetze. Sie regelten das Zusammenleben, das Erleben und das Ableben, wie Panos gerne sagte, und in besonders schwierigen Zeiten auch das Überleben auf der Insel. Davon abgesehen, wer sollte die Einhaltung dieser neuen Gesetze schon überwachen? Die Polizei? Die einzige Polizeistation im Umkreis von zweihundert Kilometern befand sich auf der regionalen Hauptinsel, mit dem Boot immerhin eine Dreiviertelstunde entfernt. Die drei dort stationierten Polizisten hatten bei den Inselbewohnern einen Ruf wie die Zöllner bei Jesus: korrupte Arschlöcher. Sollten die sich mal lieber um die echten Probleme kümmern, dachte Panos grimmig, als er aufstand, um sich ein Getränk aus dem Laden zu holen. Probleme gab es schließlich zuhauf, seitdem die EU-Troika, allen voran Deutschland, über sein Land bestimmte, als wäre Griechenland eine unmündige Kolonie. Und diese drei gottlosen Idioten steckten ihre ganze Kraft in den Schutz der bestehenden Besitzverhältnisse. Das bedeutete: Es wurde dem gedient, der ihnen am meisten Geld in das Umschlägchen, das „fakelaki“, steckte. Auch deswegen empfand Panos es als Zumutung, sich von der staatlichen Obrigkeit sagen zu lassen, was er zu tun oder zu lassen habe.
Ansonsten aber war Panos – trotz seines manchmal rauen Auftretens – ein friedfertiger Mensch. Er hatte ein freundliches Gesicht und lange Koteletten, die in Griechenland „favorites“ heißen, und er liebte seine kleine Insel Paladiki mit einer Inbrunst, die er nicht in Worte fassen konnte. Wahrscheinlich hatte das Ausmaß seiner Liebe auch damit zu tun, dass er als Fünfjähriger für acht Jahre nach Deutschland in eine Stadt namens Dortmund „verschleppt“ worden war, wie er es nannte. Im ersten Jahr, so schien es ihm im Rückblick, hatte es jeden Tag vierundzwanzig Stunden lang geregnet. Die folgenden Jahre war es nicht viel besser gewesen. Abartiges, jahrelanges Heimweh hatte ihn geplagt, und immer wenn seine Eltern mit ihm nach den Sommerferien, die sie bei seinem Großvater auf Paladiki verbracht hatten, wieder nach Deutschland hatten aufbrechen müssen, hatte sich Panos bis zur Besinnungslosigkeit widersetzt. Mit dreizehn hatten seine Eltern endlich ein Einsehen gehabt, und er hatte bei seinem Großvater auf Paladiki bleiben dürfen, einem stolzen, wenngleich melancholischen, weil früh verwitweten Mann, der eine kleine Bäckerei betrieben hatte. Seitdem hatte Panos Paladiki nur noch zweimal verlassen. Das erste Mal, als er zu einem Spiel seiner geliebten Fußballmannschaft AEK nach Athen gefahren war, um die weniger geliebten Fans der gegnerischen Mannschaft Panathinaikos ordentlich aufzumischen. Das zweite Mal hatte er seinem Bruder Kostas anlässlich dessen Hochzeit in Volos einen Besuch abgestattet. Damit war es aber auch genug gewesen. Wozu sollte er diesen Ort verlassen? Er liebte den Wind, die Kräuter und die umgefallenen Säulen am Fuß des kleinen Hügels neben der Reihe von Eukalyptusbäumen. Er verehrte die Zypressen, die Pinien und die kleine Tanne am Ortseingang, die ein georgischer Fremdenlegionär einst eigenhändig gepflanzt hatte. Außerdem das große Feld Minze im Hinterland, das er von seinem Großvater geerbt hatte und das im heißen Sommer 2003 zu einer Streitigkeit zwischen ihm und dem Betreiber der damals ansässigen und bereits im Jahr darauf wieder geschlossenen Bar Entaxi geführt hatte. Der Gastronom hatte immer frühmorgens, als er Panos noch in tiefem Schlaf wähnte, büschelweise Minzblätter stibitzt, um mit ihnen abends Cocktails für die Touristen zuzubereiten. Er hatte nicht eingesehen, wieso er beim Getränkehändler dafür hohe Geldbeträge zahlen sollte, wenn man die Minze umsonst pflücken konnte. Panos jedoch war stolz auf seine Minzwiese und sorgte regelmäßig durch eigenhändiges Düngen für ihr prächtiges Gedeihen. Er hatte den Barbesitzer aufgefordert, ihn an den Einnahmen aus den Cocktails zu beteiligen, und als Panos Druck gemacht hatte, hatte man sich schließlich darauf geeinigt, dass er jederzeit umsonst dort trinken dürfe.
Das konnte Panos gut: trinken. Und Druck machen. Er war ein kräftiger Mann um die vierzig und besaß eine Ausstrahlung, die Entschiedenheit ausdrückte. Wenn ihm etwas nicht passte, suchte er die Konfrontation und scheute auch vor Handgreiflichkeiten nicht zurück. Zwar hatte er bereits ein wenig angegraute Haare, doch das fiel kaum auf, da Panos meistens eine schwarze Baseballkappe trug, die er nur von Zeit zu Zeit lüftete, wenn ihm zu warm wurde oder wenn er einer Aussage besonderes Gewicht verleihen wollte. Fremden gegenüber war er schweigsam, im Freundeskreis dafür stets zu Scherzen aufgelegt. Außerdem war er kein Kostverächter. Zumindest nicht, wenn es um Frauen, Bier oder gutes Essen ging. Nur das Rauchen nervte ihn etwas, wegen des Hustens. Er hatte es bereits öfters aufgeben wollen, allerdings war es ihm immer nur für ein paar Stunden gelungen. Schon mehrmals hatte er hochspektakulär eine fast volle Zigarettenschachtel in ein offenes Feuer oder ins Meer geworfen, um sich zu beweisen, dass es das jetzt mit der Raucherei gewesen war. Doch kaum stand ein Glas Bier vor ihm, war auch die nächste Packung am Start.
Er liebte die Frauen, und viele Frauen fühlten sich von ihm angezogen. Touristinnen waren sein Spezialgebiet. Ihm fielen immer spontan lustige Storys ein, die er ihnen erzählen und mit denen er sie für sich gewinnen konnte. Im Alter von zwanzig Jahren hatte er eine Begegnung mit einer irischen Blondine gehabt. An jenem Abend hatte er ein wenig den Boden unter den Füßen verloren, da er das Flunkern unnötig übertrieben hatte: Um der sommersprossigen, feenhaften Frau zu gefallen, erzählte er, er sei Pilot bei Olympic Airways, einer renommierten griechischen Fluglinie. Ihr gefiel das, und sie wollte im Laufe des Abends immer mehr von seinen Fliegergeschichten hören. Ihm aber wurde das Lügen lästig. In der Hoffnung, die Situation würde sich klären und in Gelächter auflösen, übertrieb er über alle Maßen und erzählte ihr, dass es seine Spezialität sei, mit seiner Linienmaschine im Kanal von Korinth unter der Autobrücke hindurchzufliegen. Doch selbst das glaubte die Irin ihm bewundernd und schmiegte sich noch fester in seine Arme. Als sie die Insel verließ, um an einer Busreise zu den antiken Anlagen von Delphi teilzunehmen, musste ihr Bus ebenjene Brücke überqueren, von der Panos gesprochen hatte. Schockiert sah sie, wie schmal der Kanal war und dass ein Unterfliegen der Autobrücke praktisch unmöglich war. Heulend rief sie bei ihm an – was damals noch schwierig gewesen war, da es auf Paladiki nur etwa fünf Fernsprecher gegeben hatte, aber sie hatte die Nummer der Bäckerei seines Großvaters gehabt und ihn an die Strippe bekommen. Er rechnete damit, eine ordentliche Standpauke zu bekommen, doch zu seinem größten Erstaunen schluchzte sie vor Sorge um ihn und flehte ihn an, zugunsten ihrer Liebe solch ein gefährliches Unterfangen doch bitte in Zukunft zu unterlassen. Panos versprach es ihr. Sie sollte ihn schließlich in guter Erinnerung behalten. Gesehen hatte er sie trotzdem nie wieder. Das war normal. Zuerst schrieben ihm die Frauen wöchentlich Liebesbriefe, die er nie beantwortete. Im Winter wurden es dann schon deutlich weniger, und nur die hartnäckigsten blieben dran. Aber auch dann hielt er still. Ein paarmal war es passiert, dass die eine oder andere Frau im darauffolgenden Jahr wieder vor seinem Laden gestanden hatte, aber damit hatte er immer umzugehen gewusst. Meistens flammte die Liebe dann noch einmal auf. Gar nicht mochte er hingegen, wenn ihn Jahre später eine seiner Liebschaften samt Ehemann und Kindern aufsuchte und wie einen alten Freund behandelte. Das war in seinen Augen das Taktloseste, was man tun konnte, um eine heilige Erinnerung zu zerstören.
Aus der Pilotengeschichte aber hatte er gelernt, und ein Fehler dieser Art war ihm nie wieder passiert. Wenn er mit Frauen sprach, sagte Panos immer die Wahrheit. Wenn das nicht ging, dann sagte er lieber nichts, und wenn auch das mal nicht ging, dann wechselte er das Thema. Damit war er seitdem gut gefahren.

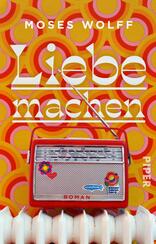


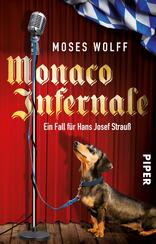
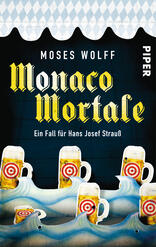





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.