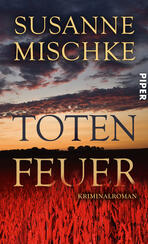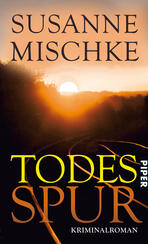„Frau Millerrr, wie gäht es uns denn haite?“
Martha schlug die Augen auf. An der linken Wand, die in einem schläfrigen Grün getüncht war, hing ein schlichtes Messingkreuz, rechts von ihr stand ein leeres Krankenhausbett und vor dem Fenster nahm sie den vagen Umriss eines Menschen wahr, eines Mannes, der Gestalt nach, der aber seltsam transparent war.
„Wo bin ich?“
Eine dralle Mittvierzigerin mit einem breiten Gesicht und Bäckchen so rot wie ein Nikolausapfel schob sich in Marthas Blickfeld.
„Frau Millerrr, Sie nix mehrrr auf Intensiv, hat man Sie auf Station verlägt. Ich bin Schwäster Bogdana.“
Marthas Oberarm wurde in die Manschette eines Blutdruckmessgeräts gequetscht, die Schwester Bogdana aufpumpte. „Ist sich Bluttdrruck wie Eidechse in Wintärrrschlaff“, konstatierte sie fröhlich. „Was mit Stuhlgang?“
Martha zog es vor, diese Frage zu ignorieren. Sie tastete nach ihrer Brust, während die Schwester den Beutel am Infusionsständer austauschte und dabei erklärte, dass Martha die Zufuhr des Schmerzmittels mit „kleine Rrrad“ am unteren Ende des Schlauchs selbst regeln könne.
„Welchen Tag haben wir heute?“
„Ist sich heite Doonnerrrstag.“
Am Dienstagmorgen war ihr ein Bypass gelegt worden. Routine, heutzutage. Für die Ärzte, nicht für Martha.
„Also nix Stuhlgang?“, insistierte Schwester Bogdana, schon im Gehen begriffen.
„Nein. Aber, Schwester …“
„Ja?“
„Wer ist der Mann, der da am Fenster steht?“
„Welches Maann? Da nix Maann. Mechten noch Tää?“
Martha nickte. Die Unterhaltung hatte sie angestrengt, sie schloss die Augen und überlegte im Wegdämmern, dass es vermutlich das Schmerzmittel war, das Halluzinationen hervorrief. Ähnliches hatte sie erlebt, als sie in ihren wilden Jahren ein bisschen mit LSD und Pilzen herumexperimentiert hatte. Ich muss aufpassen, dachte sie, dass ich nicht als Morphiumsüchtige hier herauskomme.
„Na, Frau Müller, wie fühlen Sie sich?“
Die Patientin blickte ihn stumm an. Milchiggraue Augen in einem Kranz von Falten.
Martha Müller, geb. 28.2.1943, stand auf dem Krankenblatt, das Professor Dr. Andreas Frowein auf seinem Klemmbrett bei sich trug.
„Frau Müller? Geht es Ihnen gut?“
Die alte Dame nickte geistesabwesend, dann aber kam plötzlich Leben in ihr blasses Gesicht. „Ich habe eine Frage.“
„Nur zu, dazu bin ich ja da.“
„Ist bei der Operation alles gut gegangen?“
„Sicher doch, alles bestens.“
„Gab es irgendwelche Komplikationen?“
„Aber nein, es ist alles glatt verlaufen“, log der Professor und lächelte dabei sein vertrauenerweckendstes Chefarztlächeln. Wozu um alles in der Welt sollte die Patientin erfahren, dass sie während der Operation einen Herzstillstand von fast einer Minute erlitten hatte und um ein Haar ex gegangen wäre? Nein, derlei Vorkommnisse hielt man besser unter dem Deckel. Die Patienten neigten dazu, ein Riesenbohei um solche Lappalien zu machen, und hinterher zogen sie einen für jedes Wehwehchen und für jede winzige Kalamität während der Genesungsphase zur Verantwortung.
„Wissen Sie, Herr Professor, ich hatte da nämlich so ein seltsames Erlebnis …“
Oje, dachte Frowein und schielte auf die Uhr. Um zwei Uhr war Abschlag, das konnte knapp werden.
Schon ging es los, die übliche Geschichte: der lange Tunnel mit dem gleißenden Licht am Ende, dann der Eintritt in diesen wunderbaren Feng-Shui-Garten, in dem es blühte und plätscherte und zwitscherte und wo einen die verstorbenen Lieben mit offenen Armen erwarteten…
Ich möchte einmal einen erleben, der in der Hölle landet, dachte Frowein.
„… und dann, plötzlich, verschwamm der Garten wieder vor meinen Augen, und ich fühlte, wie ich wieder zurückkehrte …“
„Wissen Sie, Frau Müller, solche Erfahrungen sind während einer Anästhesie nicht selten“, unterbrach der Professor den Sermon.
„Ja, aber da ist noch etwas, Herr Professor…“
„Frau Müller, ich darf Ihnen versichern, dass das kein Grund ist, sich zu beunruhigen. Ihre OP verlief reibungslos, Sie werden wieder vollkommen gesund. Es tut mir leid, ich muss jetzt weiter, es warten noch eine Menge Patienten auf mich. Wir sehen uns morgen früh bei der Visite, einverstanden?“
„Frau Millerrr, aufwachen, haben Sie Besuch von Schwäster!“
Schwester Bogdana stopfte die gelben Chrysanthemen in eine Vase und knallte sie auf Marthas Nachttisch. Auf dem Stuhl neben Marthas Bett saß Gertrud im schwarzen Kostüm für den Ernstfall, das Kreuz durchgedrückt, die altbackene Handtasche auf ihren Knien balancierend. Nun reckte sie ihren Schildkrötenhals über die Bettkante.
„Martha, wie geht es dir?“
„Gut“, versicherte Martha und schielte nach dem Fenster. Keine Spur von der Lichtgestalt.
„Wann darfst du nach Hause?“
„Sicher bald. Schließlich befinden wir uns im Zeitalter der Fallpauschalen.“ Nach Hause, dachte Martha. Hätte Gertrud doch bloß nicht davon angefangen. Martha lebte in Linden, dem Multikulti-Viertel Hannovers, in dem die Gentrifizierung in letzter Zeit immer rascher voranschritt. Der leicht heruntergekommene Altbau, in dem sie als übrig Gebliebene einer großen WG seit vierzig Jahren wohnte, wurde gerade luxussaniert. Martha war der festen Überzeugung, dass ihre plötzliche Herzschwäche nach zweiundsiebzig Jahren robuster Gesundheit mit ihrer misslichen Wohnsituation zu tun hatte.
Sie wechselte das Thema. „Gertrud, ich habe etwas ganz Seltsames erlebt, als ich in Narkose war …“ Als Martha an der Stelle angekommen war, an dem sich der Paradiesgarten mit all den Vögeln, den Schmetterlingen, den verstorbenen Haustieren und den herumhuschenden Engeln quasi vor ihren Augen wieder aufgelöst hatte, unterbrach sie Gertrud: „Das war eine Nahtoderfahrung. So nennt man das, das habe ich neulich im Fernsehen gesehen.“ Die goldenen Ohrgehänge an ihren lang gezogenen Ohrläppchen zitterten erregt.
„Das war aber noch nicht alles“, sagte Martha. „Als es durch den hellen Tunnel wieder rückwärtsgegangen ist … also, wie soll ich sagen … ich glaube, es ist jemand mitgekommen.“
„Mitgekommen?“ Gertrud vergaß, ihren Mund zu schließen.
„Ja, von… da drüben.“
„Doch nicht etwa Großtante Hedwig!“
„Nein. Die ist bestimmt in der Hölle. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber er steht seitdem hier im Zimmer herum, am Fenster.“
Erschrocken fuhr Gertrud herum.
„Er ist nicht immer da“, sagte Martha.
„Er?“
„Ja. Er ist weiß gekleidet und irgendwie durchsichtig und er strahlt ganz hell. Ich glaube, er ist ein Engel.“
Gertrud, die Hände um ihre Handtasche gekrallt, starrte sie entsetzt an. Martha konnte es ihr nicht verübeln, vermutlich hätte sie an Gertruds Stelle dasselbe getan. Beide waren seit Jahr und Tag weder besonders religiös noch dem Esoterischen zugeneigt. Damit hörten die Gemeinsamkeiten aber auch schon auf.
„Ich bin nicht verrückt“, sagte Martha.
„Ja, ja, gewiss“, sagte Gertrud.
Eine Pause entstand.
„Du solltest mit jemandem darüber reden.“
„Mit wem denn? Mit einem Priester?“
„Mit einem Arzt.“
„Hab ich schon versucht, aber der Professor hier …“
„Nein, nein, mit einem Arzt, der von so etwas Ahnung hat“, sagte Gertrud.
„Von Engeln?“
„Nein, von solchen… psychischen Sachen.“
„Du meinst einen Psychiater.“
„Ja, so etwas in der Art“, nickte Gertrud.
„Ich bin nicht verrückt“, wiederholte Martha.
Gertrud verabschiedete sich. Martha sank zurück in die Kissen. Die helle Gestalt stand jetzt wieder vor dem Fenster, von einem amethystblauen Licht umgeben. Jetzt war Martha, als würde sie etwas flüstern, aber die Worte waren nicht zu verstehen.
Adventszeit. Seit einer Woche war Martha wieder zu Hause. Das Treppenhaus war verstellt mit Säcken voller Putz und Zement, dazwischen lagen Eimer, Holzlatten, Leitern, Pakete mit Badezimmerfliesen, Bierflaschen, Pizzakartons und Handwerkszeug. Bis in den dritten Stock hinauf war es der reinste Hindernislauf. Das ging schon seit dem Sommer so. Neu war das Gerüst auf der Vorderseite des Hauses. Immer wieder erschrak Martha, wenn Handwerker vor den beiden Fenstern ihres Wohnzimmers vorbeigingen und zu ihr hineingafften. Zudem hatten die Arbeiter das Gerüst mit Planen verhängt, und da es nun ohnehin schon dunkel im Zimmer war, schloss Martha auch tagsüber die Vorhänge, um sich vor den Blicken der Arbeiter zu schützen. Sie hätte sich in die Küche setzen können, denn zum Hof hin stand kein Gerüst, aber dort war es kalt. Immer wieder fielen Strom und Gas aus oder sie stellten ihr das Wasser ab. Martha hatte sich einen Campingkocher besorgt, sie achtete darauf, immer einen ausreichenden Vorrat an Kerzen im Haus zu haben und ein paar volle Wassereimer. Die Zentralheizung funktionierte schon seit Monaten nicht mehr, doch zum Glück gab es im Wohnzimmer den großen Kachelofen. Das Hinaufschleppen der Kohlen vom Keller in den dritten Stock war zwar mühsam, zumal in ihrem Zustand, aber wenn dann der Ofen schön warm strahlte, dann dachte Martha jedes Mal trotzig: Prigge, du kannst mich mal! Du kriegst mich nicht klein.
Der Engel saß nun meistens in dem Rattansessel, in dem früher immer ihr Kater Leo geschlafen hatte. Manchmal schwebte er auch als heller Lichtfleck über der Biedermeieranrichte oder im Schlafzimmer zwischen dem Art-déco-Vertiko aus Nussbaumholz und dem Empirebett. Auch wenn Martha ausging, zum Arzt oder zum Einkaufen, hatte sie stets das Gefühl, dass der Engel bei ihr war, obwohl sie ihn draußen noch nie gesehen hatte. Sie erahnte seine Anwesenheit jedoch an einem warmen, sanften Druck, den sie auf ihrem Rücken spürte, genau zwischen den Schulterblättern, so ähnlich wie ein ABC-Pflaster. Anfangs hatte sie sich ein bisschen gefürchtet und natürlich war da immer noch der beunruhigende Gedanke, dass sie womöglich einen an der Waffel hatte. Einen Psychiater wollte sie jedoch nicht aufsuchen, von Ärzten hatte sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt erst einmal genug. Außerdem lebte es sich ganz gut mit dem Engel, denn er war vollkommen anspruchslos. Sie hatte sich angewöhnt, sich mit ihm zu unterhalten. „Es tut mir leid, wie es hier momentan zugeht“, entschuldigte sie sich. „Sie sind sicher Besseres gewohnt, so wie es bei euch da drüben ausgesehen hat. All diese hübschen Springbrunnen …“
Sie hatte lange darüber nachgedacht, ob man einen Engel duzte oder siezte und sich für Letzteres entschieden. Höflichkeit war nie verkehrt. Bis jetzt hatte er jedoch noch nicht geantwortet, wenn man das gelegentliche leise, unverständliche Flüstern einmal außer Acht ließ. Vielleicht musste sich der Engel erst an sie gewöhnen, so wie sie sich an ihn hatte gewöhnen müssen.
„Bis zum Herbst haben noch die Türken im Erdgeschoss gewohnt und neben mir der alte Schuhmacher. Aber den haben sie vergrault, der ist jetzt in einer Siedlung für betreutes Wohnen in Bothfeld. Die Türken hat der Prigge vermutlich rausgekauft“, erzählte sie ihm eines Abends. „Hat er mit mir ja auch versucht, mit Engelszungen – Verzeihung! – hat er auf mich eingeredet. Aber ich bin nicht käuflich. Wissen Sie, Herr Engel, seit vierzig Jahren wohne ich nun schon hier, eine so schöne Wohnung zu so einem Preis finde ich in Linden nicht mehr, und ich will nicht weg aus Linden, das kommt nicht infrage. Ich wüsste ja gar nicht, wo ich meine ganzen schönen Möbel lassen sollte. Das sind alles kostbare Stücke. Ich habe bis vor drei Jahren in einem Antiquitätengeschäft gearbeitet“, erklärte Martha. „Aber nun bin ich langsam selber eine.“ Sie lächelte kokett und zupfte an einer ihrer langen grauen Locken. „Seit klar ist, dass ich nicht nachgeben werde, versuchen sie es mit ihren Terrormethoden – der Prigge und seine bezahlten Schergen. Sein Vorarbeiter, dieser Polanski, hat vermutlich meinen Kater Leo verschwinden lassen, um mich mürbe zu machen. Aber das war ein Fehler. Jetzt gehe ich erst recht nicht. Jetzt müssen sie schon mir persönlich ans Leder. Wahrscheinlich haben sie gehofft, dass ich nicht mehr aus dem Krankenhaus zurückkomme. Zum Teufel mit diesen … oh, entschuldigen Sie bitte!“
„Keine Ursache“, sagte der Engel.
Martha konnte ihn jetzt plötzlich besser sehen. Er trug einen elfenbeinfarbenen Anzug, der seidig glänzte, und sein Gesicht erinnerte sie an das von Cäsar auf alten römischen Münzen. Wäre er ein Mensch, hätte sie ihn auf Mitte vierzig geschätzt. Ein bildschöner Mann war er allemal, ob Engel oder nicht. Nach Flügeln auf seinem Rücken hielt Martha allerdings vergeblich Ausschau.
Er sagte, sein Name sei Nathanael.
„Und was machen Sie hier auf Erden, Herr Nathanael, wenn ich fragen darf?“
Der Engel seufzte tief. „Wissen Sie, Martha, seit über dreitausend Jahren bin ich nun schon an dem Ort, den Sie gesehen haben, zwischen all meinen Kollegen und den guten Menschen. Manchmal würde ich am liebsten vor Langeweile sterben, wenn ich denn sterblich wäre.“
„Ich verstehe“, sagte Martha. „Aber dass Sie ausgerechnet zu mir kommen. Ich meine, ich freue mich sehr darüber und fühle mich geehrt, Herr Nathanael, aber bei mir ist ja nun auch nicht gerade die Hölle los.“
„Apropos Hölle“, sagte der Engel. „Warum lassen Sie sich das bieten, was diese Kerle hier treiben?“
„Ich habe doch schon die Miete gekürzt.“
„Miete gekürzt, Miete gekürzt! Dieser feiste Kerl mit den ekligen Haaren unter der Nase hat Ihre Katze ermordet.“
„Aber was soll ich denn machen?“
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“, sagte Nathanael und seufzte erneut: „Ach, das waren schöne Zeiten, als noch das Alte Testament galt. Ehe dieser Gutmensch aus Nazareth kam und uns den ganzen Spaß verdorben hat. Und ich musste auch noch vor einem Haufen zerlumpter Schafhirten seine Geburt verkünden.“ Nathanael schüttelte sein edles Haupt, dann richteten sich seine huskyblauen Augen auf Martha: „Stoßen Sie diesen Kerl doch bei nächster Gelegenheit vom Gerüst!“
„Ein Mord? Nein, das könnte ich nicht“, sagte Martha mit fester Stimme und der ebenso festen Überzeugung, dass der Engel sie nur auf die Probe stellen wollte.
„Hm“, machte Nathanael und hing für den Rest des Abends als schweigsame helle Wolke über dem Fernseher.
Ab und zu war der Engel für Stunden oder auch ganze Tage nicht zu sehen. Martha fragte ihn einmal nach seiner Rückkehr, wo er denn gewesen sei. Er meinte, er würde sich ein wenig umsehen.
Inzwischen ging es stramm auf Weihnachten zu. Gertrud rief an. „Du solltest Weihnachten bei uns verbringen, nicht in deiner Bruchbude.“
„Das ist sehr nett von euch, aber ich möchte lieber hierbleiben“, lehnte Martha ab. Sie mochte ihren Schwager nicht besonders, und wenn sie ganz ehrlich war, ihre ältere Schwester auch nicht.
„Aber du kannst doch an Weihnachten nicht ganz alleine sein“, protestierte Gertrud. „Dann komm doch wenigstens an Heiligabend.“
„Nein, danke. Wir… ich bleibe hier.“
„Überleg dir das lieber noch einmal“, sagte Gertrud mit Grabesstimme und Martha legte auf.
Eines der letzten Tabus, dachte sie. Sie verzeihen einem heutzutage so manche Exzentrizität, aber möchte man den Heiligen Abend alleine verbringen, gilt man als asozial, suizidgefährdet und als Fall für die Psychiatrie. Dabei machte es Martha wirklich nichts aus. Sie war das Alleinsein gewohnt und schätzte es inzwischen sogar. Dass sie in den Augen anderer das Klischee der alten Jungfer verkörperte, war ihr egal.
Aber sie war ja gar nicht allein. Der Heilige Abend mit Nathanael verlief harmonisch. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit aß der Engel zusammen mit Martha Rehrücken und zum Nachtisch Mousse au Chocolat. Dazu tranken sie zwei Flaschen Burgunder und schauten sich später Das Leben des Brian auf DVD an. Der Engel lachte Tränen dabei. Ein bisschen wehmütig dachte Martha an die Heiligabende der letzten zwölf Jahre, die sie auf ähnliche Weise mit ihrer Freundin Doro verbracht hatte. Doro war im Frühling an Krebs gestorben. Martha erkundigte sich bei Nathanael nach ihr, aber er konnte ihr keine Auskunft geben.
„Heißt das, sie ist … Sie wissen schon?“
„Ja, vielleicht hat sie Glück gehabt“, sagte der Engel.
„Wie meinen Sie das?“
„Martha, wenn ich Sie wäre, würde ich alles daransetzen, lieber nicht ins Paradies zu kommen. Aber bis jetzt waren Sie dazu viel zu brav.“
„Ich, zu brav? Ich war schon seit Jahren in keiner Kirche mehr und in den Siebzigern …“
„Ach, das bisschen Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll, wen interessiert denn das? Haben Sie mal die Bibel gelesen, wie es da drunter und drüber geht?“
Martha sah ihn erstaunt an.
„Was ist Ihre Lieblingsspeise?“, fragte Nathanael.
„Ich glaube, es ist ein Kuchen: Himbeerbaiser.“
„Das Paradies ist wie jeden Tag Himbeerbaiser.“
„Ich verstehe“, sagte Martha. „Und die Hölle?“
„Sie dürfen sich die andere Seite nicht so vorstellen wie auf den Bildern des Mittelalters.“
„Aber wie dann?“, fragte Martha.
„Wie die Limmerstraße Freitagnacht um zwölf“, sagte der Engel und lächelte.
Am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages kam plötzlich kein Wasser mehr aus dem Hahn. Martha machte sich Sorgen, ob die sechs vollen Reserveeimer bis über die Feiertage reichen würden. Wer weiß, am Ende ließ sich bis zum zweiten Januar keiner von den Arbeitern mehr im Haus blicken. Erbost ging sie hinaus ins Treppenhaus und stakste durch das Gerümpel bis nach unten. Sie hatte Glück, Polanski, der Vorarbeiter, war noch da. Er stand auf einer Leiter und schraubte an der Deckenlampe herum, die am Abgang zur Kellertreppe angebracht war.
„Ich möchte, dass Sie sofort wieder das Wasser anstellen“, sagte Martha.
„Nix verstehen“, sagte der Vorarbeiter.
„Ich weiß genau, dass Sie gut Deutsch können, ich habe Sie oft genug mit Herrn Prigge reden hören“, sagte Martha und wiederholte ihre Forderung.
Polanski grinste breit unter seinem Schnäuzer hervor und sagte mit süßlich verstellter Stimme: „Miez, miez, miez …“
Bis dahin hatte Martha nur den Verdacht gehabt, Polanski könnte etwas mit Leos Verschwinden zu tun haben, aber diese Lautäußerung eben wertete Martha als klares Geständnis. Augenblicklich wurde sie von einem heiligen Zorn übermannt. Gleichzeitig fühlte sie die Hand des Engels zwischen ihren Schulterblättern. Der Druck war fester als sonst und viel wärmer und sie hatte nur noch den einen alles beherrschenden Gedanken: Rache!
Sie nahm Anlauf und trat, im wahrsten Sinn des Wortes beflügelt von Nathanaels unsichtbarer Gegenwart, gegen die Leiter. Das Holzgestell geriet ins Schwanken, Polanski verlor den Halt und stürzte mit einem Schrei die steile Kellertreppe hinab. Sie hörte seinen massigen Körper aufklatschen, dann war es ruhig. Sehr ruhig. Martha stieg zögernd zu ihm hinunter. Er lag auf dem Rücken, leblos, sein Kopf war unnatürlich verdreht. Genick gebrochen, diagnostizierte Martha. Entsetzt über ihre Tat lief sie die Kellertreppe hinauf, stolperte durchs vermüllte Treppenhaus nach oben und in ihre Wohnung, wo sie atemlos auf ihr Kanapee sank.
„Jetzt haben Sie mich doch so weit gebracht!“, keuchte sie anklagend, aber ihre Worte verhallten ungehört. Der Engel war nicht da.
„Ach ja! Erst Unheil anzetteln, dann verschwinden“, schimpfte Martha. Dann saß sie in ihrem dämmrigen Wohnzimmer und wartete. Immer wieder blickte sie hinüber zu Leos Rattansessel. Sie wollte so gern mit Nathanael über ihre Tat reden, nie hätte sie ihn dringender gebraucht als jetzt. Aber der Engel ließ sich nicht blicken. Martha ging schließlich zu Bett, verbrachte dort eine schlaflose Nacht, und als Nathanael am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages immer noch nicht aufgetaucht war, griff sie resigniert zum Hörer und telefonierte mit der Polizei. Wenig später wimmelte es im Haus von Beamten. Martha gab ihre Tat unumwunden zu. Ein Streifenwagen brachte sie aufs Polizeirevier, sie wurde verhört, man nahm ihre Fingerabdrücke und machte Fotos von ihr, dann wurde sie noch einmal verhört, sie unterschrieb ihr Geständnis und man brachte sie in eine Zelle.
Auf der schmalen, harten Pritsche liegend hoffte Martha insgeheim, Nathanael würde sich noch einmal sehen lassen. Aber nichts dergleichen geschah. Dafür kam am nächsten Tag der Kommissar, der sie vernommen hatte, und meinte, sie könne nach Hause gehen, aber er würde ihr dringend empfehlen, einen Therapeuten aufzusuchen.
„Aber ich war es doch. Ich habe diesen Mann umgebracht“, sagte Martha.
„Gute Frau“, sagte der Kommissar. „Wir haben die protokollierten und unterschriebenen Aussagen Ihrer Schwester und Ihres Schwagers. Sie waren von Heiligabend bis zum Mittag des Sechsundzwanzigsten ununterbrochen bei Ihren Verwandten in Neustadt am Rübenberge. Wie können Sie da am Fünfundzwanzigsten Herrn Polanski die Kellertreppe hinuntergestoßen haben?“
Zu Hause wartete Nathanael schon auf sie.
„Wie haben Sie das gemacht?“, fragte ihn Martha. „Dass Gertrud die Polizei anlügt, und sogar mein überkorrekter Schwager?“
Nathanael lächelte. „Wissen Sie, Martha, ich habe viele Gesichter. Ich kann auch andere Gestalten annehmen als diese angenehme, in der ich Ihnen erscheine. Ganz andere! Das, was Ihre Schwester und ihr Gatte gestern Nacht von mir zu sehen bekommen haben, glauben Sie mir, Martha, diese Erfahrung wollen Sie wirklich nicht machen.“
Martha gab sich damit zufrieden. Ihr schlechtes Gewissen, was ihren „Totschlag im Affekt“ an Polanski anging, hatte sich inzwischen gelegt. Der Mann war ein Rohling und hatte ein unschuldiges Haustier getötet, er verdiente es nicht anders. Auge um Auge. Andererseits – was nützt mir Polanskis Tod?, fragte sich Martha besorgt. Der Prigge wird sich einen anderen Mann fürs Grobe suchen, um mich zu schikanieren. Selbst wenn ich auch noch den Prigge ins Jenseits befördere – es wird ein neuer Prigge kommen. Ich habe keine Chance, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Vielleicht sollte ich mir doch einmal Altenheime genauer ansehen …
Am nächsten Morgen war Nathanael verschwunden. Stattdessen stand gegen Mittag plötzlich der Hausbesitzer, Herr Prigge, mit einem großen Strauß rosa Tulpen vor der Tür. Beinahe hätte Martha ihn gar nicht erkannt. Er war wachsbleich im Gesicht und sein ehemals dunkles Haar war auf einmal weiß wie Engelshaar. Dabei war der Mann erst Ende dreißig. Er sagte, er wolle sich für all das Ungemach der letzten Monate bei Martha entschuldigen, und bis zum Abschluss der Umbauarbeiten müsse sie natürlich keine Miete mehr bezahlen.
Der Umschlag, der am Tulpenstrauß angebracht war, enthielt einen Scheck über 2000 Euro. Binnen zwei Tagen waren das Treppenhaus vom Gerümpel befreit, die Planen vor Marthas Wohnzimmerfenster verschwunden und die Zentralheizung wieder in Gang gesetzt. Wann immer danach Wasser oder Strom kurzzeitig abgestellt werden mussten, kam ein Arbeiter und fragte, ob es für Martha zu dieser oder jener Zeit akzeptabel wäre, man würde sich ganz nach ihr richten.
Auf Herrn Prigges wundersame Verwandlung angesprochen, meinte Nathanael nur, der Mann müsse aufpassen, sonst käme er trotz seiner Schandtaten der letzten Jahre am Ende doch noch ins Paradies.
Nathanael kam jetzt nur noch sporadisch vorbei. Er meinte, er habe etwas nachzuholen in Sachen Amüsement und Sünden. Dafür hatte Martha großes Verständnis. Aber er versprach, das nächste Weihnachtsfest auf jeden Fall bei Martha zu verbringen.
Martha holte sich einen neuen Kater aus dem Tierheim. Sie sollte noch fast zwanzig Jahre in dem Haus leben, ehe sie kurz nach ihrem einundneunzigsten Geburtstag friedlich verstarb. Wohin die Reise danach ging, ist nicht bekannt.
Über die Autorin
Susanne Mischke wurde 1960 in Kempten geboren und lebt heute bei Hannover. Sie war mehrere Jahre Präsidentin der „Sisters in Crime“ und erschrieb sich mit ihren fesselnden Kriminalromanen eine große Fangemeinde. Für das Buch „Wer nicht hören will, muss fühlen“ erhielt sie die „Agathe“, den Frauen-Krimi-Preis der Stadt Wiesbaden. Ihre Hannover-Krimis haben über die Grenzen Niedersachsens hinaus großen Erfolg.