Prolog
Mit dreizehn schloss ich mich einer Jungengruppe an, die sich regelmäßig zu langen Wanderungen in den Bergen rund um Seattle traf. Eigentlich hatten wir uns bei den Pfadfindern kennengelernt und waren mit ihnen auch viel wandern und zelten gegangen, aber dann hatte sich unser kleiner Trupp abgespalten, um eigene Expeditionen zu unternehmen – ja, Expeditionen, nichts anderes sahen wir darin. Wir wünschten uns mehr Freiheit und mehr Wagnis, als die Pfadfinderausflüge uns boten.
Meist waren wir zu fünft unterwegs – Mike, Rocky, Reilly, Danny und ich. Mike war der Anführer; er war ein paar Jahre älter als wir anderen und hatte viel mehr Erfahrung mit dem Leben im Freien. Innerhalb von rund drei Jahren sind wir viele Hundert Meilen zusammen gewandert. Wir haben den Olympic National Forest westlich von Seattle und die Glacier Peak Wilderness nordöstlich durchquert und haben Touren entlang der Pazifikküste unternommen. Oft waren wir sieben Tage oder länger am Stück unterwegs, unsere topografischen Karten führten uns durch alte Wälder und über felsige Strände, wo wir die Gezeiten beachten mussten, wenn wir Landzungen umrundeten. In den Winterferien unternahmen wir ausgedehnte Ausflüge und wanderten und zelteten bei jedem Wetter, was in diesem Gebiet im pazifischen Nordwesten durchnässte, kratzende Wollhosen aus Armeebeständen, die immerfort verschrumpelt waren, bedeutete. Es gab keine Kletterpartien an Felswänden, weder mit Seil noch ohne, es war einfach nur stures, anstrengendes Wandern. Unsere Touren waren nicht gefährlich, abgesehen davon, dass da eine Gruppe Halbwüchsiger mitten in den Bergen unterwegs war, Hilfe mehrere Stunden entfernt lag und an Handys nicht zu denken war.
Mit der Zeit wuchsen wir zu einem vertrauensvollen, eingeschworenen Team zusammen. Wenn wir uns nach einem langen und anstrengenden Wandertag für einen Schlafplatz entschieden, brauchte es keine langen Worte zur Verteilung der Aufgaben. Mike und Rocky befestigten die Plane, die uns für die Nacht als Dach dienen würde, Danny suchte trockenes Holz zusammen, Reilly und ich brachten mit einem Anzünder und Zweigen ein Lagerfeuer zum Brennen.
Und dann gab es Essen. Günstige Lebensmittel, die leicht zu transportieren waren, uns aber ordentlich stärkten. Nichts hat jemals besser geschmeckt. Zum Abendessen öffneten wir eine Dose Pökelfleisch und mischten ihm eine Fertigtüte „Hamburger Helper“ oder „Beef Stroganoff“ unter. Morgens gab es „Carnation Instant Breakfast“ oder ein anderes Pulver, das sich unter Zugabe von Wasser in ein Western-Omelett verwandelte – zumindest laut Verpackung. Mein Lieblingsfrühstück waren „Oscar Mayer Smokie Links“: geräucherte Würstchen, beworben als „100 % Fleisch“, die heute nicht mehr erhältlich sind. Wir hatten nur eine Bratpfanne für die Zubereitung des Essens und aßen aus leeren Konservendosen, die bei jedem von uns am Rucksack hingen. Diese Dosen waren Wassereimer, Kochtopf und Haferflockenschüssel in einem. Ich weiß nicht, wer von uns das heiße Himbeergetränk erfunden hat. Eine großartige kulinarische Innovation war es zwar nicht, man musste nur Wackelpuddingpulver in kochendes Wasser geben, aber es war perfekt als Dessert oder als morgendlicher Zuckerschub vor einem Wandertag.
Wir waren ohne Aufsicht unserer Eltern, ohne jede Kontrolle durch Erwachsene, wir entschieden selbst, wohin wir gingen, was wir aßen und wann wir schliefen, und auch welche Risiken wir eingingen. In der Schule gehörten wir nicht etwa zu den Coolen. Nur Danny war in einer Sportmannschaft, er spielte Basketball, aber er gab es bald auf, um Zeit für unsere Touren zu haben. Ich war der dünnste in der Gruppe und meist der kälteste, und ich hatte immer das Gefühl, dass ich schwächer war als die anderen. Aber ich mochte die körperliche Herausforderung und das Gefühl der Autonomie. Wandern wurde damals in unserer Gegend zwar immer beliebter, aber Jugendliche, die acht Tage allein durch die Wälder stapften, traf man nicht so oft.
Allerdings war das in den 1970er Jahren, und die Einstellung zur Kindererziehung war lockerer als heute. Kinder hatten im Allgemeinen mehr Freiheiten. Und als ich in meinen frühen Teenagerjahren war, hatten meine Eltern akzeptiert, dass ich anders war als viele meiner Altersgenossen, und sie hatten sich mit der Tatsache abgefunden, dass ich ein gewisses Maß an Unabhängigkeit brauchte, um mir meinen Weg durch die Welt zu bahnen. Diese Akzeptanz war hart erkämpft, vor allem für meine Mutter, aber sie sollte eine entscheidende Rolle dabei spielen, wer ich werden sollte.
Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich mir sicher, dass wir alle auf diesen Ausflügen etwas anderes suchten als Kameradschaft und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Wir waren in dem Alter, in dem Kinder ihre Grenzen austesten, mit verschiedenen Identitäten experimentieren – und manchmal auch eine Sehnsucht nach größeren, sogar transzendenten Erfahrungen verspüren. Ich hatte begonnen, eine klare Sehnsucht zu spüren, um herauszufinden, was mein Weg sein würde. Ich war mir nicht sicher, in welche Richtung es gehen sollte, aber es musste etwas Interessantes und Bedeutsames sein.
Auch mit einer anderen Jungengruppe verbrachte ich damals viel Zeit: Kent, Paul, Ric und ich gingen auf dieselbe Schule, die Lakeside School, die eine Möglichkeit für Schüler eingerichtet hatte, sich über eine Telefonleitung mit einem Großrechner zu verbinden. Dass Teenager überhaupt Zugang zu einem Computer hatten, war damals eine absolute Seltenheit. Wir vier waren begeistert und verbrachten unsere gesamte Freizeit damit, immer komplexere Programme zu schreiben und zu erforschen, was wir mit dieser elektronischen Maschine alles anstellen könnten.
Oberflächlich betrachtet hätte der Unterschied zwischen Wandern und Programmieren nicht größer sein können. Aber beides fühlte sich an wie ein Abenteuer. Mit beiden Freundesgruppen erkundete ich neue Welten und reiste an Orte, die selbst viele Erwachsene nicht erreichen konnten. Wie das Wandern passte auch das Programmieren zu mir, weil es mir erlaubte, mein eigenes Maß an Erfolg zu definieren, und es schien grenzenlos zu sein, nicht davon abhängig, wie schnell ich laufen oder wie weit ich werfen konnte. Die Logik, die Konzentration und die Ausdauer, die man braucht, um lange, komplizierte Programme zu schreiben, waren für mich selbstverständlich. Anders als beim Wandern war ich in diesem Freundeskreis der Anführer.
Gegen Ende meines zweiten Studienjahres, im Juni 1971, rief mich Mike mitten im Dezember an und erzählte mir, welche Tour als Nächstes geplant war: 50 Meilen durch die Olympic Mountains. Die von ihm ausgewählte Route hieß „Press Expedition Trail“, benannt nach einer Gruppe, die im Jahr 1890, von einer Zeitung finanziert, die Gegend erkundet hatte. Ob er die Unternehmung meinte, bei der die Teilnehmer fast verhungert wären und ihnen die Kleidung am Körper verrottet war? Ja, bestätigte er, aber das sei doch lange her.
Acht Jahrzehnte später ist die Wanderung immer noch anstrengend; in jenem Jahr gab es eine Menge Schnee, was sie zu einem besonders entmutigenden Unterfangen machte. Da aber alle anderen – Rocky, Reilly und Danny – Feuer und Flamme waren, konnte ich mich wohl kaum drücken. Außerdem war ein jüngerer Pfadfinder namens Chip bereit, sich uns anzuschließen. Ich musste mit.
Geplant war, den Low Divide Pass zu erklimmen, zum Quinault River hinabzusteigen und dann denselben Weg zurückzuwandern, wobei wir in Blockhütten entlang des Weges übernachten würden. Die Tour würde sieben oder acht Tage in Anspruch nehmen. Der erste Tag war noch recht leicht, wir verbrachten die Nacht auf einer wunderschönen schneebedeckten Wiese. Während der nächsten ein, zwei Tage, beim Aufstieg zum Low Divide, wurde der Schnee tiefer. Als wir unser Nachtquartier erreichten, lag die Hütte unter Schnee begraben. Innerlich freute ich mich schon. Bestimmt würden wir umkehren, dachte ich, und zu der weitaus einladenderen Schutzhütte absteigen, an der wir schon vorbeigekommen waren. Dort würden wir ein Feuer machen, uns aufwärmen und essen.
Mike meinte, wir sollten abstimmen: umkehren oder weiterwandern bis zum Fluss. Beide Optionen bedeuteten eine mehrstündige Wanderung. „Die Schutzhütte, an der wir vorbeigekommen sind, liegt 500 Meter weiter unten. Wir können dorthin zurückkehren, oder aber wir wandern weiter zum Quinault River“, erklärte Mike. Dass wir mit dem Abstieg unsere Mission, nämlich den Fluss zu erreichen, aufgeben müssten, brauchte er nicht weiter auszuführen.
„Was meinst du, Dan?“, fragte Mike. Danny war der inoffizielle stellvertretende Anführer unserer kleinen Gruppe. Er war größer als alle anderen, ein ausdauernder Wanderer mit langen Beinen, die offenbar nie ermüdeten. Was auch immer er antwortete, würde die Entscheidung beeinflussen.
„Gehen wir weiter, wir sind fast da, vielleicht sollten wir einfach weitergehen“, sagte Danny. Als die Hände hochgingen, war klar, dass ich in der Minderheit war. Wir würden weitermachen.
Später, als wir schon wieder durch den Schnee stapften, sagte ich zu ihm: „Danny, ich bin echt enttäuscht von dir. Du hättest das hier verhindern können.“ Das meinte ich im Scherz, aber nur halb.
Ich erinnere mich deutlich, wie kalt und elend mir an diesem Tag war. Und ich erinnere mich auch, was ich dagegen tat: Ich zog mich in meine Gedanken zurück.
Vor meinem inneren Auge hatte ich Programmiersprache.
Etwa zur selben Zeit hatte jemand der Lakeside einen Computer überlassen, einen sogenannten PDP-8, hergestellt von der Digital Equipment Corporation. Das war 1971, und obwohl ich mich bereits intensiv mit der aufkommenden Welt der Computer beschäftigte, hatte ich noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Bis dahin hatten meine Freunde und ich nur riesige Großrechner genutzt, mit denen mehrere Personen gleichzeitig arbeiteten. Entweder standen diese in einem gesonderten Raum, oder aber wir stellten über eine Telefonleitung eine Verbindung zu ihnen her. Der PDP-8 aber war für die direkte Nutzung durch eine Person konzipiert und immerhin so klein, dass er neben einem auf einem Tisch stand. Die 36 Kilo schwere, 8500 Dollar teure Maschine war wahrscheinlich das, was den ein Jahrzehnt später auf den Markt kommenden Personal Computern am nächsten kam. Ich nahm mir vor, eine Version der BASIC-Programmiersprache für den neuen Computer zu schreiben.
Vor der Wanderung hatte ich an dem Teil des Programms gearbeitet, der dem Computer die Reihenfolge vorgibt, in der er Operationen ausführen soll, etwa wenn jemand eine Rechenaufgabe wie 3(2 + 5) × 8 – 3 eingibt oder auch ein Spiel erstellen will, das komplexe Mathematik erfordert. Beim Programmieren spricht man hier von einem „Formula Evaluator“, also einer Art „Ausdrucksauswertung“. Nun stapfte ich also durch den Schnee, hatte den Blick auf den Boden geheftet und grübelte darüber nach, welche Schritte für die Ausführung der Operationen erforderlich waren. Die Devise lautete: So wenige wie möglich. Computer hatten damals nur sehr wenig Speicher, daher mussten Programme schlank sein und mit wenig Befehlen auskommen, um den Speicher nicht zu überlasten. Der PDP-8 hatte nur 6 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ich ging im Kopf durch, wie der Computer meine Befehle befolgen würde. Der Rhythmus meiner Schritte half mir beim Denken, ähnlich wie meine Angewohnheit, auf der Stelle zu wippen. Den restlichen Tag über war ich in mein Programmierrätsel vertieft. Als wir ins Tal hinabstiegen, wich der Schnee einem sanft abfallenden Pfad durch einen alten Fichten- und Tannenwald. Wir erreichten den Fluss, schlugen unser Lager auf, aßen unseren Spam Stroganoff und konnten endlich schlafen.
Früh am nächsten Morgen stiegen wir wieder zum Low Divide hinauf, der Wind peitschte uns die Graupel ins Gesicht. Wir hielten lange genug unter einem Baum an, um uns eine Packung Ritz Crackers zu teilen, und gingen weiter. Jedes Lager, das wir fanden, war voll mit anderen Wanderern, die den Sturm abwarteten. Also gingen wir einfach weiter und fügten einem unendlich langen Tag weitere Stunden hinzu. Beim Überqueren eines Baches stürzte Chip und schlug sich das Knie auf. Mike säuberte die Wunde und verband sie mit einem Schmetterlingsverband; wir kamen nur noch so schnell voran, wie Chip humpelte. Die ganze Zeit über analysierte ich schweigend meinen Code. Während der zwanzig Meilen, die wir an diesem Tag gewandert sind, habe ich kaum ein Wort gesprochen. Schließlich kamen wir zu einem Unterstand, der Platz für uns bot, und schlugen unser Lager auf.
Wie der berühmte Ausspruch „Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich einen kürzeren Brief geschrieben“ nahelegt, ist es einfacher, ein Programm in unpräzisem Code zu schreiben, der sich über mehrere Seiten erstreckt, als für dasselbe Programm nur eine Seite zu benötigen. Die unpräzise Version läuft langsamer und verbraucht mehr Speicherplatz. Unsere Wanderung bot mir genug Zeit, mich kurz zu fassen. An diesem langen Tag konnte ich mein Programm weiter reduzieren, so als würde ich kleine Stücke von einem Stock schnitzen, um seine Spitze zu schärfen. Das Ergebnis erschien mir effizient und erfreulich simpel. Es war mit Abstand der beste Code, den ich je geschrieben habe.
Als wir uns am nächsten Nachmittag auf den Rückweg zum Ausgangspunkt machten, wich der Regen endlich einem klaren Himmel und der Wärme des Sonnenlichts. Ich fühlte das Hochgefühl, das mich nach einer Wanderung immer überkommt, wenn die ganze harte Arbeit hinter mir liegt.
Als die Schule im Herbst wieder anfing, hatte derjenige, der uns den PDP-8 geliehen hatte, ihn zurückverlangt. Ich habe mein BASIC-Projekt nie beendet. Aber der Code, den ich auf dieser Wanderung schrieb, mein Ausdrucksauswerter und seine Schönheit blieben mir erhalten.
Dreieinhalb Jahre später war ich Student im zweiten Semester und wusste nicht, welchen Weg ich einschlagen sollte, als Paul, einer meiner Freunde aus Lakeside, mit der Nachricht von einem bahnbrechenden Computer in mein Wohnheimzimmer platzte. Ich wusste, dass wir eine BASIC-Sprache für ihn schreiben konnten: Wir hatten einen Vorsprung. Das erste, was ich tat, war, mich an diesen elenden Tag auf der Low Divide zu erinnern und den von mir geschriebenen Auswertecode aus meinem Gedächtnis zu holen. Ich tippte ihn in einen Computer ein und legte damit den Grundstein für eines der größten Unternehmen der Welt und den Beginn eines neuen Industriezweigs.
kapitel eins
Trey
Irgendwann würde es ein großes Unternehmen geben, würden Millionen Zeilen lange Softwareprogramme in Milliarden von überall auf der Welt verwendeten Computern stecken. Es würde Reichtum und Rivalen geben und die ständige Sorge, wie man sich an der Spitze einer technologischen Revolution behauptet.
Vor all dem aber gab es ein Kartenspiel und nur ein Ziel: meine Großmutter zu schlagen.
In meiner Familie konnte man besonders schnell zu Ruhm kommen, wenn man ein guter Spieler war. Gerade Kartenspiele hatten es uns angetan. Wer Rommé, Bridge oder Canasta beherrschte, dem war unser Respekt sicher. Meine Großmutter mütterlicherseits, Adelle Thompson, machte diese Spielebegeisterung zu einer Familienlegende. „Die beste Kartenspielerin ist und bleibt Gami“, hieß es in meiner Kindheit immer.
Gami wuchs in der Eisenbahnstadt Enumclaw im Bundesstaat Washington auf. Der Ort liegt weniger als 50 Meilen von Seattle entfernt, aber im Jahr 1902, dem Jahr ihrer Geburt, war er vollkommen abgeschieden. Gamis Vater arbeitete als Telegrafist bei der Eisenbahn, und ihre Mutter Ida Thompson – Lala genannt – verdiente sich mit dem Backen von Kuchen und dem Verkauf von Kriegsanleihen in der örtlichen Sägemühle ein bescheidenes Einkommen. Schon Lala spielte gern. Ihre Bridge-Partnerinnen, zu denen Bankiersgattinnen und die Frau des Sägemühlenbesitzers gehörten, kamen aus der feinen Gesellschaft. Diese Damen hatten vielleicht mehr Geld oder einen höheren sozialen Status, aber Lala glich das Gefälle aus, indem sie sie beim Kartenspielen besiegte. Dieses Talent wurde an Gami und bis zu einem gewissen Grad an deren einziges Kind, meine Mutter, weitergegeben.
Meine Einführung in die familiäre Spielkultur begann früh. Ich lag noch in den Windeln, da nannte Lala mich schon „Trey“, im Kartenspielerjargon das Wort für die „Drei“. Der Name lehnte daran an, dass ich nach meinem Vater und Großvater der dritte Bill Gates der Familie war. (Eigentlich bin ich Nummer vier, aber mein Vater entschied sich für den „Junior“, also wurde ich Bill Gates III genannt.) Als ich fünf war, brachte Gami mir das Quartettspielen bei. Darauf folgten Jahre mit unzähligen Kartenrunden. Wir spielten zum Spaß, wir spielten, um uns gegenseitig zu ärgern und zum Zeitvertreib. Aber meine Großmutter spielte vor allem, weil sie gewinnen wollte. Und sie gewann immer.
Ihre Überlegenheit erstaunte mich. Warum war sie nur so gut? War das schon immer so gewesen? Vielleicht war es eine Art Gottesgabe? Schließlich war sie ein gläubiger Mensch. Lange fand ich keine Antwort darauf. Ich wusste nur, dass sie jedes Mal gewann. Egal bei welchem Spiel. Egal wie sehr ich mich anstrengte.
Als Anfang des 20. Jahrhunderts die Religionsgemeinschaft der Christian Scientists immer mehr Verbreitung an der Westküste fand, wurden sowohl die Familie meiner Mutter als auch die meines Vaters zu frommen Anhängern. Ich nehme an, die Eltern meiner Mutter schöpften Kraft aus der „Christlichen Wissenschaft“ und teilten deren Überzeugung, dass die wahre Identität eines Menschen im Spirituellen und nicht im Materiellen zu finden sei. Für die Mitglieder der Christian Science ist das chronologische Alter nicht von Bedeutung, und so feierte Gami keine Geburtstage und gab ihr Alter nicht preis, ja noch nicht einmal ihr Geburtsjahr. Dabei drängte meine Großmutter ihre Überzeugungen anderen nicht auf. Meine Mutter und unsere Kernfamilie hingen der Religion nicht an. Gami versuchte jedoch nie, uns dazu zu überreden.
Wahrscheinlich trug ihr Glaube dazu bei, dass sie so starke Prinzipien an den Tag legte. Schon damals konnte ich erkennen, dass Gami strenge persönliche Anforderungen in Bezug auf Fairness, Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit hatte. Ein gutes Leben war für sie ein einfaches Leben, in dem man seinen Mitmenschen Zeit und Geld schenkte und vor allem auch seinen Verstand benutzte und sich mit der Welt beschäftigte. Meine Großmutter verlor nie die Beherrschung, sie tratschte und kritisierte nicht. Sie war zu keiner Hinterlist fähig. Oft war sie die klügste Person im Raum, aber sie achtete darauf, niemanden in den Schatten zu stellen. Sie war im Grunde eine schüchterne Person, doch sie besaß ein inneres Selbstvertrauen, das sich in einer Zen-ähnlichen Gelassenheit zeigte.
Zwei Monate vor meinem fünften Geburtstag starb mein Großvater J. W. Maxwell Jr. an Krebs. Er wurde nur 59 Jahre alt. Als Anhänger der Christian Science hatte er moderne medizinische Eingriffe abgelehnt. Seine letzten Jahre waren qualvoll, und Gami als seine Pflegerin hatte ebenso zu leiden. Wie ich später erfuhr, bildete sich mein Großvater ein, er sei so krank geworden, weil Gami etwas getan hatte, das Gott als Sünde ansah und nun ihn bestrafte. Trotzdem stand sie stoisch an seiner Seite und pflegte ihn bis zu seinem Tod. Zu meinen deutlichsten Kindheitserinnerungen gehört, dass meine Eltern mich nicht zu seiner Beerdigung gehen ließen. Ich ahnte nur, was da vor sich ging, bekam aber mit, dass meine Mutter, mein Vater und meine ältere Schwester ihn verabschieden durften, während ich mit einem Babysitter zurückblieb. Ein Jahr später starb meine Urgroßmutter Lala, als sie gerade bei Gami zu Besuch war.
Von da an konzentrierte Gami all ihre Liebe und Aufmerksamkeit auf mich und meine ältere Schwester Kristi, später dann auch auf meine jüngere Schwester Libby. Sie hat uns durch Kindheit und Jugend begleitet und unsere Persönlichkeit tiefgreifend geprägt. Sie las mir vor, bevor ich ein Buch halten konnte, und auch noch in den Jahren danach, Klassiker wie Der Wind in den Weiden, Die Abenteuer des Tom Sawyer und Wilbur und Charlotte. Nach dem Tod meines Großvaters brachte Gami mir das Lesen bei und ließ mich zunächst die Wörter aus damals beliebten amerikanischen Kinderbüchern wie The Nine Friendly Dogs und It’s a Lovely Day nachsprechen. Später fuhr sie mit mir zur Bibliothek und versorgte uns so mit weiteren Büchern. Mir war klar, dass sie viel las und über viele Dinge Bescheid wusste.
Meine Großeltern hatten ein Haus in Windermere gebaut, einem gehobeneren Viertel Seattles. Es sollte genug Platz für Enkelkinder und Familienfeiern haben. Gami blieb dort wohnen, nachdem mein Großvater gestorben war. An manchen Wochenenden übernachteten Kristi und ich in dem Haus, abwechselnd hatte einer von uns das Privileg, in Gamis Zimmer zu schlafen. Der andere schlief im Zimmer nebenan, in dem alles, von den Wänden bis zu den Vorhängen, hellblau war. Das Straßenlicht und vorbeifahrende Autos warfen unheimliche Schatten in diesen blauen Raum. Ich hatte Angst, dort zu übernachten, und war immer erleichtert, wenn ich in Gamis Zimmer bleiben durfte.
Diese Wochenendbesuche waren etwas Besonderes. Das Haus meiner Großmutter lag nur ein paar Meilen von unserem entfernt, aber die Zeit dort fühlte sich an wie Urlaub. Gami hatte einen Pool und einen kleinen Minigolfplatz, den mein Großvater angelegt hatte. Außerdem durften wir fernsehen – ein Vergnügen, das bei uns zu Hause streng dosiert wurde. Gami war für alles zu haben. Dank ihr wurden meine Schwestern und ich zu begeisterten Spielern, die alles – Monopoly, Risiko, Memory – zu einem Wettkampfsport machten. Manchmal kauften wir zwei Exemplare eines Puzzles und wetteiferten, wer zuerst fertig würde. Wir wussten jedoch, was sie am liebsten spielte: An den meisten Abenden teilte sie nach dem Essen die Karten aus und zeigte uns wieder einmal, was eine Harke ist.
Mit etwa acht Jahren bekam ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, wie sie das machte. Ich erinnere mich noch genau an den Tag: Ich saß meiner Großmutter am Esstisch gegenüber, Kristi neben mir. Im Zimmer stand eines dieser riesigen alten Holzradios, das schon damals ein Relikt der Vergangenheit war. An einer anderen Wand thronte ein großer Schrank, in dem Gami das gute Geschirr aufbewahrte, das nur sonntags benutzt wurde.
Es ist ruhig, man hört nur, wie die Karten auf den Tisch klatschen, die wir im Schnellfeuer aufdecken und ablegen. Wir spielen Pounce, eine Art schnelles Solitaire mit mehreren Spielern. Ein Pounce-Dauergewinner weiß nicht nur, was er auf der Hand hat, sondern auch welche Karten in den einzelnen Stapeln der Spieler auftauchen und was in den gemeinsamen Stapeln auf dem Tisch liegt. Das Spiel belohnt ein gutes Arbeitsgedächtnis und die Fähigkeit, Muster zu erkennen, wodurch man sofort weiß, wie eine aufgedeckte Karte zu dem passt, was man auf der Hand hat. Ich aber weiß davon nichts. Ich weiß nur, dass Gami irgendetwas besitzt, womit sie das Glück auf ihre Seite zieht.
Ich starre meine Karten an und versuche verzweifelt, Anlegemöglichkeiten zu finden. Dann höre ich Gami sagen: „Deine Sechs passt.“ Und dann: „Deine Neun passt.“ Sie leitet meine Schwester und mich an, während sie gleichzeitig ihr eigenes Blatt spielt. Sie bekommt irgendwie alles mit, was am Tisch passiert, und scheint sogar die Karten zu kennen, die jeder von uns auf der Hand hält. Wie macht sie das bloß? Für echte Kartenspieler ist das nichts Besonderes: Je genauer man das Blatt seines Gegners verfolgt, desto besser sind die Gewinnchancen. Für mich kleinen Jungen ist es dennoch eine Offenbarung. Ich erkenne zum ersten Mal, dass es bei all dem Rätselraten und Glückhaben auch Dinge gibt, die ich lernen kann, um meine Gewinnchancen zu erhöhen. Mir wird klar, dass Gami nicht nur Glück oder Talent hat. Sie hat ihr Gehirn trainiert. Und das kann ich auch.
Von da an begann ich ein Kartenspiel mit dem Bewusstsein, dass jedes ausgeteilte Blatt die Möglichkeit bietet, etwas zu lernen. Ich musste diese Möglichkeit nur ergreifen. Genau das wusste auch Gami. Dennoch machte sie es mir nicht leicht. Sie hätte sich auch einfach mit mir hinsetzen und mir die Strategien und Taktiken verschiedener Spiele erklären können. Aber das war nicht ihre Art. Sie war nicht belehrend. Lieber ging sie mit gutem Beispiel voran. Wir spielten einfach immer weiter.
Wir spielten Pounce, Gin Rummy, Hearts und Sevens, mein Lieblingsspiel. Und wir spielten ihr Lieblingsspiel, eine komplizierte Variante von Gin, die sie Coast Guard Rummy nannte. Ein wenig Bridge spielten wir auch. Wir spielten uns von vorne bis hinten durch Edmond Hoyles Official Rules of Card Games und probierten bekannte wie unbekannte Kartenspiele, bis hin zu Binokel.
Die ganze Zeit behielt ich meine Großmutter genau im Auge. In der Informatik gibt es einen sogenannten Zustandsautomaten, wobei es sich um einen Programmteil handelt, der eine Eingabe erhält und basierend auf dem aktuellen Zustand einer Reihe von Bedingungen die optimale Aktion ausführt. Meine Großmutter besaß einen fein abgestimmten Zustandsautomaten für Karten. Ihr gedanklicher Algorithmus arbeitete sich methodisch durch Wahrscheinlichkeiten, Entscheidungsbäume und Spieltheorie. Solche Konzepte hätte ich damals nie artikulieren können, ich begann jedoch, sie intuitiv zu erfassen. Ich bemerkte, dass sie selbst in unvorhergesehenen Momenten eines Spiels, bei einer nie da gewesenen Kombination aus möglichen Zügen und Chancen, meist treffsicher den optimalen Zug machte. Wenn sie mal eine gute Karte verlor, erkannte ich im Nachhinein, dass sie sie aus einem bestimmten Grund geopfert hatte: nämlich um ihren Sieg vorzubereiten.
Wir spielten und spielten, und ich verlor eine Partie nach der anderen. Aber ich beobachtete alles und verbesserte mich. Gami hörte nicht auf, mich zu ermutigen. „Denk smart, Trey. Denk smart“, sagte sie, während ich meinen nächsten Zug abwog. Wenn ich meinen Verstand benutzte und konzentriert blieb, so die Idee dahinter, würde ich schon herausfinden, welche Karte ich spielen musste. Ich hatte die Chance, zu gewinnen.
Was ich eines Tages auch tat.
Es gab keine Fanfare. Keinen Hauptpreis. Kein Abklatschen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, welches Spiel wir gespielt haben, als ich zum ersten Mal mehr Partien gewann als sie. Ich weiß aber, dass meine Großmutter sich freute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie anerkennend lächelte, weil ich mich offenbar weiterentwickelte.
Irgendwann – es brauchte noch fünf Jahre – gewann ich regelmäßig. Ich war fast ein Teenager, das Wetteifern lag mir. Ich genoss das mentale Ringen ebenso wie das befriedigende Gefühl, das das Erlernen einer neuen Fähigkeit mit sich bringt. Vor allem hat mich das Kartenspiel gelehrt: Ganz gleich, wie kompliziert oder gar rätselhaft etwas erscheint, man kann meist dahinterkommen. Die Welt kann begriffen werden.
Ich wurde am 28. Oktober 1955 als zweites von drei Kindern geboren. Meine Schwester Kristi, Jahrgang 1954, war 21 Monate älter; meine Schwester Libby erschien erst knapp ein Jahrzehnt später auf der Bildfläche. Als Baby wurde ich „Happy Boy“ genannt, weil mir angeblich ständig ein breites Grinsen im Gesicht stand. Bestimmt war es so, dass ich auch mal geweint habe, aber die sichtliche Freude überwog wohl. Eine weitere Eigenschaft, die ich als Kind an den Tag legte, könnte man als überschüssige Energie einordnen: Ich wippte gern. Zuerst auf einem Gummipferd, und das über Stunden. Als ich älter wurde, ging es ohne das Pferd weiter, ich wippte im Sitzen und im Stehen und wann immer ich Zeit hatte, mich in Gedanken zu vertiefen. Schaukeln war wie ein Metronom für mein Gehirn. Das ist es immer noch.
Schon früh merkten meine Eltern, dass sich der Takt in meinem Kopf von dem anderer Kinder unterschied. Kristi zum Beispiel tat, was man ihr sagte, spielte problemlos mit anderen Kindern und hatte von Anfang an gute Noten. Ich tat nichts dergleichen. Meine Mutter machte sich Sorgen um mich, und als ich in die Vorschule, die Acorn Academy, kommen sollte, warnte sie die Lehrer vorsichtshalber vor. Am Ende meines ersten Jahres schrieb der Schulleiter: „Seine Mutter hatte uns vorbereitet, denn sie ahnte wohl, dass er in deutlichem Kontrast zu seiner Schwester steht. Wir können uns dieser Einschätzung nur von Herzen anschließen, denn er wirkte entschlossen, uns mit seiner vollkommenen Sorglosigkeit gegenüber sämtlichen Aspekten des Schullebens zu beeindrucken. Er wusste nicht oder wollte nicht wissen, wie man eine Schere benutzt oder wie man seine Jacke anzieht, war damit aber absolut zufrieden.“ (Lustig auch, dass zu Kristis frühesten Erinnerungen gehört, dass sie die frustrierende Aufgabe hatte, mich in meinen Anorak zu zwingen, und sie mich am Ende auf den Boden legte, damit ich stillhielt und sie den Reißverschluss zumachen konnte.)
Mein zweites Jahr an der Acorn Academy begann ich als „neuerdings aggressives, rebellisches Kind“: ein Vierjähriger, der gern vor sich hinsang und imaginäre Reisen unternahm. Ich raufte mit anderen Kindern und war „die meiste Zeit frustriert und unglücklich“, berichtete der Direktor. Immerhin wurden meine Lehrer von meinen Zukunftsplänen wohlwollend gestimmt: „Wir fühlen uns von ihm sehr akzeptiert, da er uns als Passagiere auf seinem geplanten Mondflug vorsieht“, schrieben sie. (Ich war Kennedy wohl um ein paar Jahre voraus.)
Was den Pädagogen und meinen Eltern da auffiel, waren frühe Hinweise auf das, was kommen würde. Mit demselben Nachdruck, mit dem ich später das Rätsel um Gamis Kartenspielerfolge lösen wollte, verfolgte ich alles, was mich interessierte – und beachtete alles andere nicht. Zu den Dingen, die mich interessierten, gehörten Lesen, Mathematik und meinen Gedanken nachzugehen. Zu den Dingen, die mich nicht interessierten, gehörten die täglichen Abläufe des Lebens und der Schule, Handschrift, Kunst und Sport. Außerdem fast alles, was meine Mutter von mir verlangte.
Der Kampf meiner Eltern mit ihrem überaktiven, intelligenten und oft widerspenstigen, ungestümen Sohn sollte einen Großteil ihrer Energie während meiner Kindheit absorbieren und unsere Familie unauslöschlich prägen. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, wie sehr sie dazu beigetragen haben, meinen unkonventionellen Weg ins Erwachsenenleben zu ebnen.
Mein Vater war ein zwei Meter großer sanfter Riese. Er besaß eine zurückgenommene Höflichkeit, die man von einem Mann, der meist alle anderen überragte, nicht erwarten würde. Im direkten Umgang war er geradeheraus und entschlossen, was ihm in seinem Beruf entgegenkam: Als Rechtsanwalt beriet er Unternehmen und Vorstände, später war er unser erster Stiftungsrat. Er war ein höflicher Mensch, zugleich aber scheute er sich nicht, seine Anliegen klar zu äußern. Und als Student war es ihm ein dringendes Anliegen, eine Tanzpartnerin zu haben.
Im Herbst 1946 hatte er zu den Millionen Veteranen gehört, denen ein großzügiges Regierungsprogramm eine Ausbildung ermöglichte. Aus Sicht meines Vaters war der einzige Nachteil der Maßnahme, dass sich auf dem Campus der University of Washington nun viel mehr Männer als Frauen befanden. Es bestanden daher eher geringe Chancen, eine Tanzpartnerin zu finden. Irgendwann bat er eine Freundin um Hilfe. Ihr Name war Mary Maxwell.
Er wusste, dass sie der studentischen Frauenverbindung Kappa Kappa Gamma angehörte und dort vielleicht jemanden kannte, der Interesse daran haben könnte, mit einem ziemlich großen Mann tanzen zu gehen. Sie versprach nachzufragen. Als sich daraufhin längere Zeit nichts tat und die beiden eines Tages direkt vor dem Verbindungshaus spazieren gingen, fragte mein Vater sie erneut, ob sie nicht jemanden kenne.
„Ich habe da eine Person im Sinn“, sagte sie. „Mich.“
Meine Mutter war 1,70 Meter groß, und mein Vater sagte ihr, sie sei dem Job als Tanzpartnerin buchstäblich nicht gewachsen. „Mary“, antwortete er, „du bist zu klein.“
Meine Mutter hüpfte an ihn heran, stellte sich auf Zehenspitzen, legte die flache Hand auf den Kopf und erwiderte: „Bin ich nicht! Ich bin groß.“
Der Annahme, er habe meine Mutter nur gebeten, ihm eine Tanzpartnerin zu besorgen, um sich ihr anzunähern, widersprach mein Vater beharrlich. Aber genau so geschah es. „Donnerwetter“, sagte er, „dann gehen wir doch zusammen aus.“ Die Dinge nahmen ihren Lauf, zwei Jahre später heirateten die beiden.
Ich habe diese Geschichte immer gern gehört, weil sie die Charaktere meiner Eltern so wunderbar treffend einfängt. Mein Vater: überlegt und unverblümt pragmatisch, manchmal sogar in Herzensangelegenheiten. Meine Mutter: kontaktfreudig und auch nicht gerade schüchtern, wenn es darum ging, zu bekommen, was sie wollte. Es war eine lustige Begebenheit, die sich in die größere Geschichte fügte, welche von Unterschieden handelte, die über die Körpergröße hinausgingen und beeinflussen sollten, wer ich wurde.

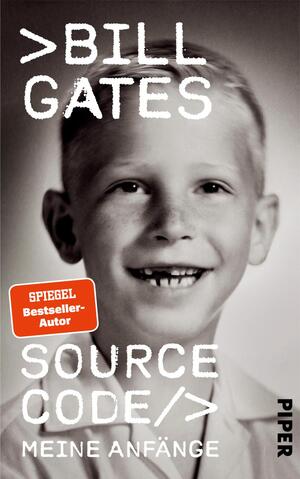
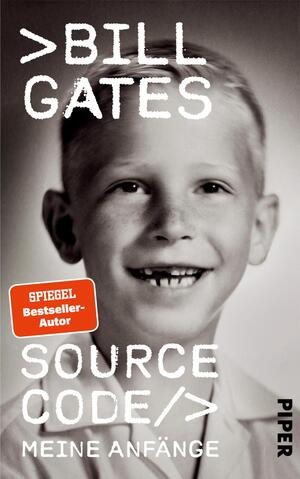
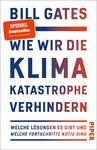
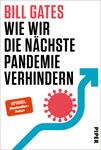

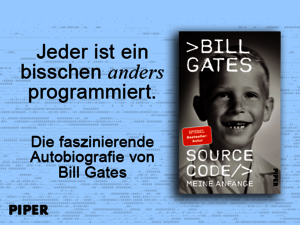
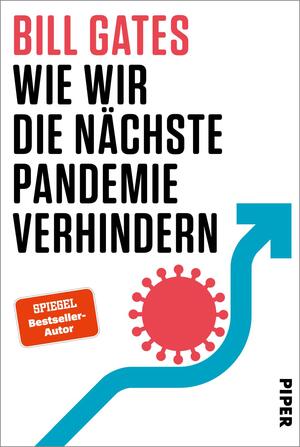
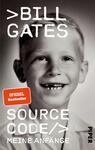
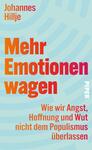
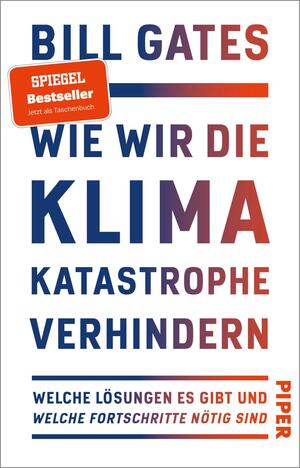
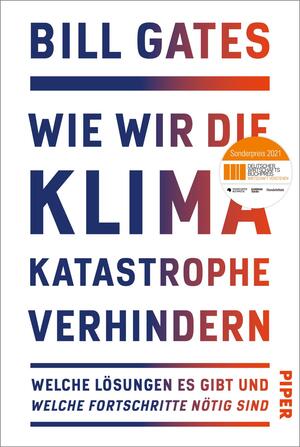
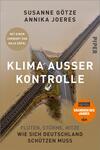

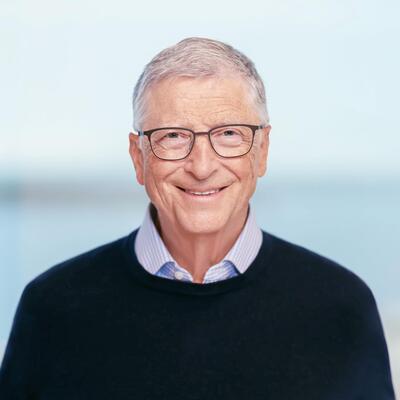
Es ist für uns und die Welt unumgänglich uns nicht - für unsere Gesundheit - gegen Pandemien zu wappnen!
Herzlichen Dank für eine kleine - aber vielleicht auch große - Innovation!
Franz L. Raaber