1 – GEFEUERT/SUNMYRA
Zu Beginn dieser Geschichte, ein paar Wochen vor seinem Verschwinden also, sehen wir Peter Siebert noch in den Kellern des Hauptquartiers von PepsiCo Neuseeland. Unter kaltem Neonlicht steht er, umgeben von spiegelnden Oberflächen, weißen Kacheln und poliertem Metall. Er befindet sich in einem Labor, er ist: allein. Gerade steckt Peter die fünf Teile einer langen marokkanischen Holzpfeife zusammen. Den tönernen Kopf hat er mit Gras gestopft, das will er rauchen, um sich danach und in verändertem Zustand wieder seiner Arbeit widmen zu können, den Reagenzgläsern und farbigen Aromafläschchen also, die vor ihm bereitstehen wie Zinnsoldaten in bunten Uniformen. Schon hat er die Pfeife im Mund, es springt bereitwillig das Flämmchen aus dem silbernen Feuerzeug, da betritt ohne Ankündigung und sozusagen polternd ein junger, ihm fremder Mann das Labor, stammelt, beim Anblick des offensichtlich mit Halbseidenem befassten Peter, erschrocken eine Entschuldigung. Er habe, sagt der junge Mann, bitte nicht stören wollen. Stan Sneed sei der Name, er sei der Assistent von Gene, also, von Gene Jeffries. „Haben Sie“, fragt Peter kalt, während er die Pfeife wieder auseinanderbaut, „schon einmal was von Klopfen gehört? Und was kann ich für Sie tun, Stan, bitte schön?“ „Mister Jeffries würde Sie gern sprechen.“ Ah. Mister Jeffries – Eugene – ist regional sales director von PepsiCo in Neuseeland. In der globalen Konzernhierarchie hat dieser Mann keine sonderliche Bedeutung. Dass er Peter sprechen will, ist seltsam, weil der als sogenannter consultant direkt dem Marketingvorstand des Brauseunternehmens untersteht, im weit entfernten Purchase, New York. Jeffries weiß tatsächlich noch nicht einmal, was Peter in den gewöhnlich verlassenen Kellerlabors von Pepsi Auckland so treibt. Er hat vor einer Weile bloß Weisung aus der Zentrale erhalten, dass dieser seltsame Deutsche bei ihm erscheinen würde, er solle den nach dessen eigenem Ermessen schalten und walten lassen. „Geht es um jetzt sofort?“, fragt Peter. „Ja“, sagt Stan Sneed. „Ich glaube schon.“ Also schiebt Peter das Pfeifenmäppchen zurück in seine rechte Jacketttasche und folgt Sneed in den vierten Stock des Gebäudes, die Chefetage. Unterwegs kann Sneed sich ein paar Seitenblicke auf Peter nicht verkneifen. Peter schaut, muss man sagen, allerdings auch wirklich sehr besonders aus, so besonders, dass man in den Fluren, in der Kantine von PepsiCo Neuseeland seit Wochen ständig über ihn flüstert. An diesem Tag zum Beispiel trägt er ein Paar kirschfarbener Tassel-Loafer, dazu flaschengrüne Seidenstrümpfe, knöchellange, kastanienfarbene Slacks aus grober Wolle, einen Kaschmir-Rollkragenpullover in Bordeaux und darüber jenes schmal geschnittene Jackett aus buntem Shetland-Tweed, in dessen geräumigen Pattentaschen auch sein Pfeifenmäppchen Platz findet. Diese Garderobe sitzt auf einem langgliedrigen Körper, dessen Fettanteil Peter durch regelmäßige Gymnastik und eine streng geregelte Diät penibel bei zehn bis zwölf Prozent hält. Sein ebenmäßiges, fein gebräuntes Gesicht ist wie stets messerscharf rasiert und duftet nach „Pour Monsieur“, die gescheitelten hellblonden Haare trägt Peter im Nacken derzeit protomodisch etwas zu lang wie die traurigen russischen Amateurpornodarsteller, die auch Gvasalia inspirieren. An Peters Handgelenk baumelt eine dreißig Jahre alte Cartier Santos in Stahl und Gold, hergestellt im Jahr seiner Geburt. Protestantisch gesinnte Menschen könnten unserem Freund wohl eine gewisse Oberflächlichkeit unterstellen. Und die hat Peter auch irgendwo, klar hat er die, er beschäftigt sich beruflich ja nicht umsonst mit der Welt des Sinnlichen, und hat dafür übrigens eine Begabung, die weltweit ihresgleichen sucht. Zugleich aber, und man sollte das hier am Anfang schon einmal deutlich festhalten, weil sonst ein falscher, allzu unerfreulicher Eindruck von ihm entstehen könnte, ist Peters Erscheinungsbild keiner Selbstverliebtheit geschuldet. Im Gegenteil ist sein Äußeres sogar nur insofern Ausdruck seiner Seele, als Peter hinter dieser Fassade zu verschwinden hofft. Es wird geboren aus der Hoffnung eines immens privaten und selbstzweiflerischen, ästhetisch allerdings auch vollkommen überbegabten Menschen, einen angenehmen, unanstößigen Auftritt hinzulegen. Inzwischen führt Sneed Peter schon durch einen Gang im vierten Stock. Peter bemerkt, dass die Wände hier von einer schönen, taupefarbenen Leinentapete bedeckt sind, die aus den Sechzigerjahren stammen dürfte. Der Linoleumfußboden riecht schwach nach einem essigbasierten Reinigungsmittel, sauber, klar, angenehm, vermutlich ein Eigengemisch der Putzkraft. Solche Sachen fallen Peter auf. Das Büro am Ende des Ganges ist das von Eugene Jeffries. Der sitzt hinter seinem Schreibtisch und hat noch Holos auf den Augen, als Sneed und Peter durch das Vorzimmer eintreten. Jeffries macht blind eine entschuldigende Geste in deren Richtung und beendet dabei sein Gespräch: „Jetzt sind sie da. Ich muss Schluss machen. Ja. Ich denke dran. Ja. Ja. Danke. Ich weiß. Bye bye. Ja. Klar. Bye-b… Ah.“ Jeffries ist ein großer, schwerer Mann mit wenig Haar, der heimlich noch immer erschrocken ist darüber, dass er seit etwa einem Jahr keinen direkten Vorgesetzten mehr hat. Er trägt einen schlecht geschnittenen schwarzen Dreiteiler, seine Füße stecken in brotlaibförmigen braunen Slippern mit Gummisohle. Auf Jeffries’ Schreibtisch stehen Fotos von ihm und seiner Familie, an der Wand hängen ebenfalls Fotos von ihm und seiner Familie, Jeffries hat sie in vorauseilendem Gehorsam für seine Frau aufgehängt. Vor dem Fenster mit Blick auf Parkplatz und Baumwipfel steht ein bräunlicher Farn, den Jeffries zu oft gießt. „Herr Siebert!“, sagt Jeffries, beugt sich über seinen Schreibtisch, um Peter die Hand zu reichen, wischt dabei versehentlich die Holos vom Schreibtisch, bückt sich, um sie aufzuheben, wobei ihm ein leiser Wind entfährt. Er reicht Peter errötend abermals die Hand und bedeutet ihm, sich doch bitte zu setzen. Peter, ein gefrorenes Lächeln im Gesicht, leistet Folge und fürchtet, dass Jeffries ihn doch bloß hochgebeten hat, um ihm ein Lunch oder so was vorzuschlagen. Vor solch informellen, unkartografierten Begegnungsformen flieht Peter, so gut es geht. „Ähh“, macht unterdessen Jeffries, den dieses gefrorene Lächeln in Peters Gesicht verunsichert. „Ja. Es ist toll, Sie wiederzusehen, wir haben uns ja an Ihrem ersten Tag hier nur in der Lobby … Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Ich weiß offen gestanden gar nicht, was genau Sie hier machen, hahaha! Wobei, neulich schickte mir doch Stan hier …“ Sneed, der hinter Peter sitzt, macht eine panisch abwehrende, vergebliche Geste. „Neulich schickte mir Stan einen Artikel über Sie! Ich glaube, aus dem Magazin Douche? ›The Teuton Instinct‹ oder so ähnlich? Hahaha.“ Peter zieht die Augenbrauen hoch und nickt. „Hochinteressant, wirklich! Ich habe ihn ganz gelesen. Auch dieser Ausdruck, den man für Sie erfunden hat, Gestaltdesigner, ganz toll.“ Jeffries schaut Peter Hilfe suchend an. „Toll“, sagt er noch einmal. „Danke, Mister Jeffries“, erlöst ihn Peter. „Ich weiß auch nicht, wie die Leute von der Douche mich entdeckt haben.“ „Hahaha!“ „Womit kann ich Ihnen denn dienen?“, fragt Peter. „Aaah“, sagt Jeffries und rutscht in seinem Stuhl hin und her. „Aaah.“ Er furcht die Stirne und schaut konzentriert auf ein Foto auf seinem Schreibtisch, als erkenne er seine Kinder auf einmal nicht mehr. „Also“, sagt Jeffries endlich, „ich habe vor ein paar Minuten einen Anruf aus Amerika, aus Purchase, gekriegt.“ Aber dort ist es, denkt Peter, doch gerade mitten in der Nacht. „Und es ist so … Erlauben Sie mir, direkt zu sein. Man hat mir gesagt, dass Ihr Vertrag, äh … be… ja, beendet ist. Also, man hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass Ihr Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet ist.“ Peter versteht nicht. Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. Er ist noch nie gefeuert – und das ist doch das, was hier gerade passiert? –, gefeuert worden. Aber warum? Bei dem Projekt, mit dem die Firma Pepsi Peter betraut hat, geht es um die Entwicklung eines neuen Getränks in der sogenannten Lifestyle-of-Health-and-Sustainability-Sparte, in der sich der Konzern nach eigener Meinung zu zögerlich, nicht gut aufgestellt hat. Peter, der seine eigenartige Arbeit im Grunde überall auf der Welt verrichten kann, hatte für das Projekt um ein Labor in Neuseeland gebeten, weil er sich von diesem Land und seiner Natur Inspiration, die rechte Stimmung erhofft hatte. Und tatsächlich geht die Arbeit gut voran, auch wenn sich Peter in Auckland noch einsamer fühlt als sonst. Sein Entwurf für Pepsi ist ein „hypermineralisiertes“ Wasser, das dem Konsumenten „perfekte Mineralisierung“ verspricht. Für dieses neue Produkt hat er sich den Namen Myned ausgedacht. Peter hat das Flaschendesign, die Werbekampagne, die Targetgruppen, er hat alles längst entworfen oder im Kopf, sogar den Geschmack. Seine Spezialität sind Gesamtpakete, Produkt und Marketing aus einem Guss, und Peter weiß mit seiner branchenweit bekannten, unfehlbaren Sicherheit auch, dass Myned ein großer Erfolg werden wird. Tatsächlich arbeitet er nur noch an letzten Geschmacksnuancen, an der Vanillenote, mit der er Myned noch weicher machen will. Was also, fragt sich Peter, war wohl sein Fehler? Wo war er unachtsam oder nicht zufriedenstellend für den Konzern? Er muss irgendwas übersehen, er muss sich irgendwie falsch verhalten haben. Oder versteht er gerade etwas nicht richtig? „Gefeuert“, sagt er. Seine Stimme ist ein paar Tonlagen höher als gewohnt, er räuspert sich. „Ich bin gefeuert, habe ich das richtig verstanden?“ „Neeein“, sagt Jeffries und macht eine beschwichtigende Handbewegung. „Nicht so!“ Er schaut hilflos zu Sneed, der diesen Austausch mit echtem Erstaunen verfolgt und seinem Chef keinerlei Unterstützung bieten kann. „Schauen Sie, das habe ich befürchtet“, sagt Jeffries unglücklich, „ich bin einfach so schlecht mit Worten. Also, na ja, Sie sind, in Anführungsstrichen, schon gefeuert.“ Peter lacht. „Was denn nun, Mister Jeffries?“ „Gene, bitte. Nennen Sie mich Gene.“ „Bin ich gefeuert, Gene?“ „Ja, schon.“ Jeffries macht wieder diese beschwichtigende Geste. „Aber man hat mir in Purchase aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass das absolut nichts mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Dass Sie einen ganz fantastischen Job gemacht haben.“ „Aha“, sagt Peter. Warum feuert man ihn für einen fast fertigen, angeblich fantastischen Job? Bei seiner Vertragsunterzeichnung hatte er noch den Eindruck gehabt, dass Pepsi so ein Produkt wie Myned ganz dringend suchte. Mehrere hochrangige Manager waren bei seinem Pitch zugegen gewesen. Und warum rufen die mich eigentlich nicht persönlich an, fragt er sich. Warum muss mich dieser armselige Jeffries entlassen? „Also“, sagt der, „wie gesagt sollen Sie wissen, Peter, dass der Konzern von all Ihren bisherigen Ideen ausgesprochen angetan ist. Aber die haben das Projekt – ich weiß ja gar nicht, worum es genau geht – aus internen Gründen auf Eis gelegt, so hat man das da ausgedrückt.“ Jeffries zuckt mit den Schultern und versucht, irgendwie brüderlich und professionell zugleich zu gucken. Peter schweigt. „Sie kennen wirklich keine genaueren Gründe?“, fragt er dann. „Geht es um Geld?“ „Ich weiß wirklich nichts“, sagt Jeffries wahrheitsgemäß. „Geld ist ja immer ein Faktor, oder? Aber zu dem Thema: Sie kriegen selbstverständlich die für diese Fälle im Vertrag vorgesehene Abfindung, das soll ich dringend ausrichten.“ „Aber was bedeutet das jetzt denn genau?“, fragt Peter. „Sie meinten sofortige Wirkung. Heißt das wirklich sofort?“ „Ja. Das habe ich auch gefragt. Sie können auf der Stelle gehen.“ Wenig später betritt Peter den Parkplatz vor dem PepsiCo-Gebäude, eine von Gebüsch und hohen Eukalyptusbäumen gesäumte Asphaltfläche am Stadtrand von Auckland, über der grellorange, in Pepsisprache sozusagen mirindafarben der herbstliche Himmel der Abenddämmerung steht. Es ist später Nachmittag und ungewöhnlich schwül, die Welt riecht schwer nach den öligen Bäumen, nach Asphalt und heraufziehendem Regen. Peter fühlt sich, als sei er auf einem fremden Planeten oder in einem fremden Leben, vollkommen verloren. Gewöhnlich würde er nun zurück in sein Hotel fahren. Gewöhnlich würde er dort im Gym seine Übungen machen, alleine am Tresen des japanischen Restaurants nebenan zu Abend essen, schließlich, vor dem Schlafengehen, auf seinem Zimmer noch „das Netz abarbeiten“, also penibel durch eine streng kuratierte Linkliste gehen, die aus ein paar großen Nachrichtenseiten, vor allem aber aus eigenartigen Blogs, Foren und Instagram-Feeds besteht, in denen sich für Peters Begriffe die Gegenwart kristallisiert. Tausend Bilder am Tag will Peter betrachten, das ist Teil, denkt er, seiner Disziplin und Arbeit. Schließlich würde Peter gewöhnlich in seine Pyjamas steigen. Nachts schläft er nur unruhig und fährt bisweilen desorientiert, mit jähem Schreck auf, ängstigt sich pochenden Herzens vor dem Sterbenmüssen, als stünde ein Mörder am Fußende des Bettes, und er fühlt sich dann haltlos und verlassen in seiner merkwürdigen, einsamen Existenz, in der niemand je warm und atmend neben ihm im Bett liegt. Und gewöhnlich würde Peter am kommenden Morgen zeitig aufstehen, um mit dem anderen, abendlichen Ende der Welt zu telefonieren: mit seiner Assistentin Friederike in Hamburg wegen des Geschäftlichen, und mit dem Privatdozenten Harald Siebert, seinem geliebten großen Bruder, einem verheirateten Vater dreier Kinder, wegen des Menschlichen. Mittwochs ruft Peter außerdem noch einen „Coach“ an, wegen des sogenannten Seelischen. Danach würde Peter gewöhnlich mit Musik auf den Ohren durch Auckland irren, die frei vor ihren Rechnern flottierende Jeunesse in den Cafés beobachten, die schlammbedeckten Rugbyspieler beim Training in Nebel und Regen. Fröstelnd am grauen Strand rumstehen wie ein Mann, der auf ein Schiff aus der Heimat wartet. Und dann endlich, nach dem Mittagessen, würde er ins Labor fahren und sich in der Arbeit verlieren. Gewöhnlich. Das ist jetzt ja aber offenbar in dieser Form zu Ende. Die bis zum Abend verbleibenden Stunden erstrecken sich vor Peter strukturlos und bedrohlich. Er betrachtet seinen Mietwagen, der im Halblicht steht wie ein großes, glänzendes Insekt. Peter hat den vagen Plan, sich in dieses Auto zu setzen, ins Hotel zu fahren, dort einen Drink zu nehmen vielleicht, denn in so einer Situation, stellt er sich vor, nimmt ein Mann doch einen Drink, an der Bar, alleine, lernt, das wäre natürlich schön, eine ebenfalls einsame Frau kennen. Er muss auch Friederike anrufen, fällt ihm ein, die Sache erklären. Peter wählt ihre Nummer, er wird sie nicht erreichen, denkt er, es ist ja noch wahnsinnig früh in Hamburg, aber dann klingelt es immerhin, und dann geht Friederike sogar ran, mit verschlafener Stimme. „Hey, Peter“, sagt sie. „Ist alles in Ordnung?“ „Habe ich dich geweckt?“ „Nein nein, schon okay, ich liege irgendwie sowieso wach. Warte mal, ich geh mal kurz aus dem Schlafzimmer.“ Peter schweigt. „Wieso rufst du denn an, ist alles okay?“, fragt Friederike. „Du, es ist etwas ganz Seltsames passiert gerade“, sagt Peter. „Ich bin … ich bin gerade gefeuert worden hier von Pepsi.“ „Was?“ Peter hört, wie sich Friederike eine Zigarette anzündet. „Bist du sicher?“ Peter antwortet nicht. „Blöde Frage, entschuldige. Aber … wieso denn?“ „Das ist es ja, ich habe keine Ahnung. Die haben gesagt, sie seien total zufrieden mit dem Projekt, aber aus angeblich konzerninternen Gründen müsste man mich absägen.“ „Wie seltsam. Ist alles okay bei dir?“ „Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe.“ „Du hast bestimmt nichts falsch gemacht.“ „Aber warum haben die mich gefeuert? Vielleicht habe ich mich irgendwie schlecht benommen? Ich hab hier mit niemandem mal Lunch gegessen oder so, weißt du? Vielleicht fanden die mich arrogant oder so, vielleicht haben die sich in Purchase über mich beschwert.“ „So ein Unsinn“, sagt Friederike in einem Ton, der Peter ein bisschen beruhigt. „Jetzt warte mal kurz. Du meintest doch, Myned würde sehr gut laufen?“ „Ja, ich fand schon.“ „Na also. Wenn du das sagst, dann ist das auch so. Pepsi ist doch scheißegal, wie du dich in dem Laden benimmst, die wollen einfach, dass das Produkt gut ist.“ Sie schweigt für einen Moment. „Vielleicht gibt es irgendeinen Wechsel in der Konzernführung, von dem wir noch nichts mitgekriegt haben. So was. Die melden sich deswegen bestimmt auch noch bei dir. Mach dir keine Sorgen.“ „Ich hab Angst, dass ich mich irgendwie dumm angestellt habe“, sagt Peter. „Das ist doch auch irgendwie respektlos, ich bin hier echt von dem Regionalchef einfach vor die Tür gesetzt worden, weißt du? Das hat keine fünf Minuten gedauert.“ Peter stellt sich vor, dass man in Purchase über ihn lacht oder aus lauter Unzufriedenheit mit ihm dafür sorgt, dass er nie wieder einen Job kriegt. Bald, so fühlt er, ist es mit der Arbeit dann ganz zu Ende, dann sitzt er auf der Straße, dann kräht kein Hahn mehr nach ihm. So ist das bei ihm immer. Wenn etwas nicht glatt läuft, kriegt er gleich Zweifel an seiner ganzen Person, an seiner ganzen Stellung in der Welt. „Die schulden dir auf jeden Fall schon mal eine fette Entschädigung“, sagt Friederike. „Ich check das gleich noch mal im Vertrag aus. Ich bin mir sicher, dass deine Arbeit nicht der Grund gewesen ist und erst recht nicht deine Art. Du bist halt nicht so der supersoziale Typ, na und? Bislang haben ja wohl alle Arbeitgeber immer deine Professionalität gelobt, und dass deine Pakete am Ende stimmen, ist ja sowieso klar. Das liegt an irgendwas anderem.“ Peter fühlt sich ein bisschen getröstet. „Was machen wir denn jetzt?“ „Ich muss gleich noch mal in deinen Planer gucken. Das nächste Projekt ist, wenn ich mich erinnere, doch erst in vier Wochen, Nestlé, oder?“ „Ja, kann gut sein. Das ist dann eine ganze Weile hin. Kann man das nicht vorziehen vielleicht?“ „Du hattest dir doch überlegt, surfen zu gehen, wenn die Zeit es zulässt, Bali? Dann fährst du halt jetzt mal hin für ein bisschen länger. Und kommst auch mal runter. Ich sag dir doch seit Monaten schon, dass wir mal einen anständigen Urlaub einplanen müssen für dich.“ „Hab ich denn die Kröten?“, fragt er bescheiden. „Peter“, lacht Friederike. „Komm schon.“ „Okay. Kannst du mal nach Flügen und schönen Hotels für mich gucken? In Keramas oder so?“ „Klar, mach ich.“ „Und bei Nestlé anrufen, ob das Projekt noch steht?“ „Mann, Peter. Ich mach das, okay. Aber natürlich ist das noch ein go. Ist doch alles längst unterschrieben. Reg dich nicht so auf. Ist doch egal, wenn die dich gefeuert haben, die Trottel. Wahrscheinlich ist die fällige Entschädigung sogar teurer, als dich bis zum Ende des Projekts weiterzubezahlen. Die schießen sich doch da selbst ins Bein. Mit Geld hat das also nichts zu tun, das ist irgendwas anderes, und wir verstehen das bestimmt auch noch. Purchase wird sich garantiert bei dir melden.“ „Okay. Du bist fabelhaft. Das beruhigt mich ein bisschen. Danke. Ist bei dir alles in Ordnung?“ „Ach, danke, ja, mir geht’s gut. Das Kolloquium gestern war nicht schlecht, die Diss steht, glaube ich. Und ach so, ja, Pelle hat mir gestern vorgeschlagen, zusammenzuziehen. Also er will das. Ich weiß noch nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich den Kerl die ganze Zeit ertrage. Wahrscheinlich kann ich deswegen nicht schlafen. Ich meine, eigentlich ist das so süß. Und schön ja auch. Aber …“ In diesem Moment lässt Peter auf dem Parkplatz in Neuseeland vor Schreck das Handy fallen, denn offenbar wird in einem Gebüsch zu seiner Linken gerade eine Frau ermordet. Oder zumindest klingt der Schrei, der Mark und Bein durchdringend aus dem Dickicht gellt, für den ersten Augenblick ganz genau so, und für diese eine Sekunde dämmert Peter auch wie hellsichtig, dass vielleicht gar nicht Pepsi für seine Demissionierung verantwortlich sein könnte, sondern dass eine schicksalhafte Kraft nach ihm greift und etwas Schreckliches mit ihm anzustellen gedenkt. Diese Ahnung versinkt jedoch gleich schon wieder, gewinnt der Schrei im Abklang doch eine eindeutig vogelhafte, animalische Klangfarbe, im Gebüsch sitzt und ruft also bloß irgendeine Peter fremde, antipodische Kreatur. Peter fasst sich an die Brust, in der das Herz rast, bückt sich fahrig nach seinem auf der Erde liegenden Telefon, dabei fallen ihm die Autoschlüssel aus der Tasche und unter den Mietwagen. „Peter? Was war das denn?“, fragt Friederike, die er wieder am Ohr hat. „Du, keine Ahnung! Irgendein Tier, glaube ich. Furchtbar! Keine Ahnung, wer … Moment.“ Es klopft an in Peters Leitung. „Anonym“ liest er auf dem Display. „Friederike? Jesus. Entschuldige, jetzt geht bei mir gerade ein Anruf ein, ich glaube, das ist Pepsi. Ich geh da mal ran, ja?“ „Absolut! Sei ruhig ein bisschen wütend mit denen, das geht so nicht. Und dann meld dich danach wieder! Ciao!“ „Mach ich! Ciao.“ Peter wechselt zum anderen Gespräch. „Siebert“, sagt er zittrig. „Herr Siebert. Entschuldigen Sie bitte, dass ich unangekündigt anrufe.“ Amerikanisch, fremde Frau. „Mit wem spreche ich, bitte?“ Die Frau am anderen Ende stellt sich vor als Clementine Bouvet. „Ich bin Anwältin“, sagt sie ominös. „Rufen Sie aus Purchase an?“ „Purchase?“ „Sie sind nicht bei Pepsi?“ Am anderen Ende der Leitung kurzes Schweigen. „Peter, nein, nicht bei Pepsi, nicht aus Purchase. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie einen Anruf erwartet? Ich rufe Sie an, weil …“ „Woher haben Sie meine Nummer?“, unterbricht Peter. „Über Bekannte. Peter“, sagt die Anwältin, „gestatten Sie bitte, dass ich gleich zum Punkt komme, ich habe, ehrlich gesagt, wenig Zeit. Ich rufe Sie an, weil ich Sie gerne kennenlernen möchte.“ „Privat?“, fragt Peter verwirrt, während er sich bäuchlings auf den Boden legt, um nach den Autoschlüsseln zu schauen. Die Anwältin am anderen Ende der Leitung lacht. „Business. Wir haben ein sehr interessantes Projekt für Sie. Ist allerdings noch, Sie kennen das ja, nehme ich mal an, geheim, und mein Klient hat mich gebeten, Sie sozusagen einmal abzuklopfen dafür.“ „Aha“, sagt Peter, und als vom anderen Ende wieder nichts kommt, auf einmal gereizt: „Hallo? Würden Sie mir bitte verraten, wer Sie sind.“ „Natürlich, Peter“, sagt die Anwältin. „Das ist sicher eine unkonventionelle Kontaktaufnahme. Es geht nur darum, dass es ein bisschen drängt mit unserem Projekt.“ „Schreiben Sie“, sagt Peter, dem endgültig die Nerven durchgehen, „doch bitte meiner Assistentin, wie das übrigens auch absolut üblich ist. Die Adresse finden Sie online. Ich bin die nächsten Monate allerdings total ausgebucht.“ Er legt auf. Ein paar Sekunden später klingelt das Handy abermals. „Es geht um sofort“, sagt die Anwältin. „Wir würden Sie gerne dazu bewegen, sofort bei uns vorstellig zu werden.“ „Ha!“, macht Peter. „Ich bin mir sicher, dass Sie viel zu tun haben, Peter“, sagt die Anwältin. „Und natürlich haben Sie keine Lust, ständig von irgendwem angerufen zu werden, deswegen bitte ich abermals um Entschuldigung für diesen Überfall. Aber wie gesagt: es ist dringend, und ich wollte nicht über Ihr Büro gehen, sondern die Sache direkt mit Ihnen persönlich klären. Würden Sie mir erlauben, zwei, drei Sätze zu dem Projekt zu sagen – mehr geht im Moment sowieso nicht?“ Peter betrachtet sein Spiegelbild in der schimmernden Türe seines Wagens. Hinter ihm bewegt sich etwas, er dreht sich um und sieht Stan Sneed, der in der Eingangstür von PepsiCo, Neuseeland, erscheint und ihn beobachtet. Das Pepsi-Gebäude sieht auf einmal sehr klein aus, trist, der Anblick macht Peter wütend. „Meinetwegen“, sagt er. „Pray tell.“ Ihr Klient, sagt die Anwältin, sitze in Kalifornien. „Er hat als Unternehmer sehr viel Geld verdient. Software. Er macht aber mittlerweile eigentlich nur noch VC … Venture Capital.“ „Ich weiß, wofür VC steht“, lügt Peter. „Nun entwickelt er zum ersten Mal seit Jahren wieder selbst ein Projekt, eines, von dem er glaubt, dass es die Welt verändern wird. Also, wirklich verändern. Ich rede hier von der Größenordnung des Internets. Für meinen Klienten …“ Peter hat aber auf einmal eine Idee. „Sagen Sie, Mrs, ähm, Mrs“, sagt er. „Für welche Kanzlei arbeiten Sie eigentlich?“ Bei Klient und Geld ist ihm diese Frage in den Kopf gefallen. Er kennt selbst zwar keine einzige Kanzlei beim Namen, mit dem ganzen legalen Kram, mit Patenten und dergleichen, Dingen, die theoretisch ein großer Teil seines Geschäftsfelds sein könnten, hat er sich nie beschäftigt, so was macht höchstens Friederike – aber er hat plötzlich das Gefühl, dass er hier besser wie ein Detektiv vorgehen, den Dingen auf den Grund gehen sollte, denn was ist eigentlich gerade los, vor einer halben Stunde noch gedachte er doch bloß, seine Pfeife zu rauchen? Jetzt will er mal ein bisschen mehr rausfinden, auf die Finger klopfen, was, mit dem Namen, die googeln oder so. „Peter“, sagt unterdessen Clementine Bouvet. „Sie hören mir nicht zu. Ich arbeite für keine Kanzlei. Ich arbeite für nur einen einzigen Mann. Fulltime. Hier spricht nicht die Micky Maus. Es geht, ich wiederhole mich nur ungern, sehr ernsthaft um ein Projekt, das die Welt verändern wird. Auch Ihre, ob Sie mitmachen oder nicht.“ Wieder dieser langweilige Ausdruck, „weltverändernd“, das hat für Peter keinen sonderlichen Sound mehr, genau wie dieses blöde „disruptiv“. Jedes Produkt, an dessen Entwicklung er teilhat, soll inzwischen die Welt verändern, Peter hat längst begriffen, dass es sich um eine bloße Phrase handelt, die einfach erwartet wird, schon lange nicht mehr nur im Silicon Valley. Er hört das noch in jedem Pitch, es geht dann zwar bloß um Limonade, Chips, Spültabs, aber all das ist angeblich auch schon „weltverändernd“. Das Virus, denkt Peter, war weltverändernd, disruptiv. Dass die sich dieses Wort nicht mal sparen können. „Das Produkt, von dem ich spreche“, fährt unterdessen die Anwältin fort, „wird eines sein, das nicht rein digital, sondern physisch existiert. Für alle sinnlichen Qualitäten des Projekts sucht mein Klient nun einen beratenden Experten. Er hat das Porträt über Sie in der Douche gelesen und hält Sie für geeignet.“ „Ich verstehe“, sagt Peter, der jetzt doch zuhört. Die Anwältin spricht schnell, schnörkellos, eindrücklich. Dass sie den Artikel erwähnt, gefällt ihm. Er hält die Douche für eines der zeitgeistigsten, relevantesten Magazine überhaupt, es hat keine breite, aber eine sehr einflussreiche Leserschaft. „Mein Klient ist ein sehr besonderer Mann, Peter. Sie würden mit Sicherheit gerne mit ihm zusammenarbeiten. Ich kann an dieser Stelle noch nicht viel mehr sagen. Ich möchte Sie allerdings nun, deswegen rief ich ja an, erneut einladen.“ Peter fragt sich plötzlich, ob diese Clementine Bouvet nicht vielleicht sogar für Drew Itautis arbeiten könnte, den weltberühmten Unternehmer aus Kalifornien. Er stellt sein Handy auf Lautsprecher und googelt „drew itautis lawyer“, findet aber keinen hilfreichen Eintrag. Die Anwältin bietet Peter einen Flug erster Klasse nach Washington, D. C., an. Von dort aus, erklärt sie, solle er weiterreisen nach West Virginia, zu einem Retreat, in dem er drei Tage lang bleiben würde, um der Anwältin zu begegnen und an einer Art Assessment Center teilzunehmen. „Assessment Center?“, sagt Peter. „Ein Kennenlernen“, sagt die Anwältin. „Keine Sorge. Keine Mathetests, keine Consulting-Rätsel.“ Für den Aufwand dieser drei Tage soll Peter eine Entschädigung erhalten, die Anwältin nennt eine Summe, die einem Vielfachen von Peters üblicher Rate entspricht, das Geld würde sofort auf sein Konto gehen, wenn er jetzt zusagen sollte. „Ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende auch längerfristig passen wird, Peter. Für Sie und für uns. Wir haben uns Ihren track record ganz genau angesehen und glauben, dass Sie der richtige Mann für uns sind. Sie müssten allerdings eben bitte wirklich sofort zusagen. Wir würden Ihnen dann auch gleich das Ticket zukommen lassen, sodass wir Sie so bald wie möglich hier haben könnten.“ Peter sitzt inzwischen auf der Motorhaube seines Mietwagens. In dem Gebüsch zu seiner Linken bewegt sich etwas. Ein seltsames, räudiges Tier hoppelt daraus auf ihn zu. Peter erkennt, dass es sich wohl um einen Kiwi handelt. Diese Kreatur hat offenbar gerade so furchtbar geschrien. „Sagen Sie mir bitte einmal ganz kurz, worum es geht“, sagt Peter. „Kann ich nicht. Es geht um eine neue Technologie, um etwas, das es so noch nicht gibt. Elektronik, im weitesten Sinne.“ „Sie wissen, dass ich bislang eher in anderen Branchen gearbeitet habe?“ „Wie gesagt, wir haben uns über Ihre bisherige Arbeit so gut informiert, wie das ohne ein echtes Gespräch möglich ist. Sagen Sie zu und schauen Sie dann auf Ihr Konto, wir überweisen Ihnen Ihr Honorar per push, dann wissen Sie, dass wir es sehr ernst meinen.“ „Ich hätte zufällig tatsächlich gerade ein paar Tage Zeit“, hört sich Peter sagen. „Wirklich?“, antwortet die Anwältin. „Großartig!“ Ihr Erstaunen ist übrigens gespielt. Es war diese mächtige, ausgesprochen gut vernetzte Frau selbst, die durch ein paar wenige Anrufe innerhalb von Stunden für Peters vorzeitige Entlassung gesorgt hat. So viel sei hier schon verraten. „Ich bin derzeit in Neuseeland“, sagt Peter, während er sein Auto aufsperrt und sich ängstlich nach dem Vogel umdreht, der immer näher kommt. „Dann werden Sie vermutlich über L. A. fliegen müssen“, sagt die Anwältin. Ein paar Augenblicke später sieht Stan Sneed, wie Peter in das Coupé steigt und den Wagen anlässt. Der Auspuff hüllt den Kiwi sofort in eine dichte Qualmwolke. Das Auto fährt an, beschreibt eine große Kurve über den Parkplatz und saust davon, wobei laute Orgelmusik durch die geöffneten Scheiben weht. Es handelt sich um Bachs Kleine Fuge in a-Moll, und man könnte mit dieser Musik leicht zu den opening credits übergehen, zu einer schönen Montage, die Peters Reise nach Amerika zeigt. Die Musik passt aber genauso gut zu einer anderen Geschichte um Stan Sneed, die hier als kleiner Zwischengang erzählt werden soll, bevor es mit Peter weitergeht. Deren Anfang liegt fünf Jahre zurück. Damals war Stan Sneed noch Schüler, kaum sechzehn Jahre alt, befallen von einer quälenden Schüchternheit, unglücklich mit sich selbst und dementsprechend auch nur unglücklich verliebt – ein Teenager, wenn man so will. Haley, seine durchaus Angebetete, darf man sich vorstellen als den rotwangigen, bereitwillig lachenden, heiteren Typus, eine kleine, wärmende Sonne inmitten einer Schar von fröhlichen Freunden. Sneed hingegen, bleich, vampirhaft, war ein loner, und er verbrachte einen großen Teil seiner Zeit mit Computerspielen, die ihn ablenken sollten von seiner Einsamkeit und der Unfähigkeit, Haley anzusprechen, dabei warf die ihm doch, wie er meinte, bisweilen verstohlene Blicke zu. Im Unterschied zu den übrigen geeks seiner Altersklasse hatte der Computerspieler Sneed längst jedes Interesse an Blockbuster-Shootern und sogenannten massively multiplayer online role-playing games verloren. Stanley Sneed versenkte sich in esoterischeren, verträumteren Online-Welten, in speziellen, anspruchsvoll modifizierten Rollenspielszenarien, bei denen die User in gemeinsamer, konzentrierter Arbeit eine möglichst große erzählerische Dichte herzustellen versuchten, indem sie komplizierten Regeln in strenger Auslegung folgten. Plattformen, wie Sneed sie nutzte, waren nicht offen zugänglich, sondern oft nur zu betreten nach ausführlichen Bewerbungsgesprächen mit sogenannten Moderatoren. Das waren ehrenamtliche Kontrolleure, die in erster Linie für die Einhaltung der Regeln und Codes der Spiele zuständig waren, es handelte sich zumeist um anale, oft auch noch arrogante, also eigentlich unerträgliche Nerds. In den per Chat oder Videokonferenz geführten Vorstellungsgesprächen musste Sneed eine solide Vorkenntnis der Regeln des Spiels an den Tag legen, ausreichendes Wissen über Gegenwart und Vergangenheit seriöser Rollenspiele im Allgemeinen belegen sowie, für Sneed am schwersten, ein feinfühliges, den Moderatoren angenehmes Urteil zu ewig kritischen Fragen der Nerdkultur abgeben („Letzte Frage: Warum muss Frodo mit dem Ring zu Fuß nach Mordor ziehen, statt dass Gandalf damit gleich zum Schicksalsberg fliegt auf dem Adler Gwaihir?“ *smirk*). Sneed – stoned, lonesome, Fantasy- und Sci-Fi-Romane verschlingend – war selbst unterdessen keineswegs der Auffassung vieler seiner Mitspieler, dass es höhere und niedere Ränge von gamern gebe, also sozusagen Plebs, die Massenware konsumierte, und Patrizier, die sich in elitären Welten raffinierten. Gamer waren, so sah er das, so oder so Verlierer, Betas wie er selbst. Er war bloß wirklich daran interessiert, in einem Spiel eine gute Geschichte erzählt zu bekommen und Mitspieler zu finden, die nicht dauernd aus der Rolle fielen wie jene Horden koreanischer Sechstklässler, die ihm in bekannteren Spielewelten als Elfen oder Magier verkörpert begegneten, ihn über ihre Headsets aber trotzdem dauernd nur stimmbrüchig als faggot bezeichneten. Eines Tages in diesem siebzehnten Lebensjahr also – die Premierministerin von Neuseeland hatte gerade die Schließung aller Schulen verkündet in der Hoffnung, die Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus ließe sich in ihrem Land in dieser Weise verlangsamen – hatte Sneed ein besonders mühsames Interview zu überstehen, in dessen Folge ihm zwei Moderatoren – beide waren ihm während des Austausches ausgesprochen unsympathisch geblieben – endlich Zugang zu einer sehr begehrten Fantasy-Welt gewährten, einem Elder-Scrolls-Mod, der von Ernst Jüngers „Marmorklippen“ inspiriert war und nach der Figur des Fürsten „Sunmyra“ genannt wurde. In diesem Spiel tobte ein Krieg zwischen den lichten, aquaphilen Bewohnern der Marina und den dunklen, urwüchsigen Mächten des Waldgelichters. Sneed, der Jüngers Buch nur von Wikipedia kannte, gestaltete seinen Avatar nach der Zusage als einen jungen Mönch, der sich mit Dampfmaschinen befasste, und nannte diese Figur Aloisius. Tagelang – er hatte ja Zeit – arbeitete Sneed an den Eigenschaften seines Mönchleins, verteilte vorsichtig dessen Fertigkeitspunkte, dachte genau über Herkunft, Art und Charakter seiner Figur nach, und nachdem deren Grundparameter von den Moderatoren gewährt und ins System eingepflegt worden waren, dämmerte endlich der Morgen, an dem er seinen Avatar erstmals durch die Weinberge entlang der Marina bewegen durfte. Als Aloisius also spawnte er in der Zelle einer ausgesprochen hübsch gestalteten Kartause und lief bald staunend durch die ihm noch fremde, liebevoll animierte Welt, geriet allerdings, er war zu diesem Zeitpunkt noch keine zehn Minuten in Sunmyra unterwegs, zufällig auf einen vor der Kartause, unter alten Weiden und mit Blick auf die Marina gelegenen Friedhof. Soeben fand dort eine Bestattung statt, denn einer der Erfinder der Sunmyra-Welt hatte wegen in real life entstandener Vaterpflichten beschließen müssen, seine zeitaufwendige Präsenz im Spiel zu beenden, seinen mächtigen Avatar sich also dramatisch suizidieren lassen. Nun waren die ältesten, engagiertesten Spieler des Spiels auf diesem virtuellen Friedhof versammelt, um „Donbardus dem Jäger“ das letzte, treue Geleit zu geben. Sneed aka Aloisius gesellte sich sehr unschuldig zur Gruppe der Trauernden. Er hielt sich bescheiden in der letzten Reihe der Gemeinde, beobachtete für eine Weile das dürftige Geschehen, bevor er sich endlich an die neben ihm stehende sexy Kriegerin „Noemia die Schmale“ wandte, um sie im Flüstermodus zu fragen, wessen Messe hier denn gerade gelesen werde – woraufhin Noemia furiengleich mit „Wer wagt es, solch schmählichen Frevel“ oder so ähnlich antwortete und in ein unvorhersehbares Wutgeheuel ausbrach, genau wie die übrigen Anwesenden auch, die diesen komischen Aloisius ja auch alle nicht kannten und sich ihre kriegerisch veranlagten Avatare ob des verstorbenen Anführers Donbardus sozusagen vor Schmerz rasend vorstellten. Alles empörte sich über die freche Unterbrechung der Zeremonie durch den fremden Neuling, dessen bodenlose Pietätlosigkeit, und nach einem ersten Rempler, auf den gleich ein zweiter, noch gröberer folgte, bereiteten sie dem Mönchlein Aloisius, mithin Sneed, enthemmt und durch wütende Prügel mit Knütteln und schweren Hämmern den schnellsten Garaus der Spielhistorie. Aloisius war damit aus „Sunymra“ gelöscht. Sneed, der gerade noch ein Köpfchen Haze geflutscht hatte, bevor er seine harmlose Frage langsam und mühsam in die verschwommene Tastatur eingegeben hatte, saß am heimischen Rechner und sah diesem brutalen Geschehen vollkommen hilflos und bestürzt zu. Sofort hatte er das Gefühl, dass es sich dabei um ein Verbrechen, einen niedrigen, xenophoben Akt handelte, bei dem die Alteingesessenen des Spiels den Neuankömmling aus Langeweile, aus abgeschmackter, bloß halb empfundener Emphase heraus über den Jordan geschickt hatten. Die Empörung darüber paarte sich in ihm mit dem kalt und sicher gefassten Entschluss zu grausiger Rache. Dem Entschluss lag letzten Endes natürlich nicht bloß die empfundene Ungerechtigkeit zugrunde, sondern es brach sich darin endlich der über Jahre genährte Hass auf die Nerds und sich selbst und die unglückliche Vernarrtheit in Haley seltsamste Bahn. Es wäre nun zu aufwendig, detailgetreue Auskunft über die Mühen zu geben, die Sneed sich in der Folge und zum Zweck der Rache machte, kurz zusammengefasst aber lässt sich Folgendes sagen: Über die folgenden fünf Jahre, in denen Sneed, nicht zuletzt wegen dieses Erlebnisses, endgültig die Freude an den Computerspielen verlor und sich stattdessen zunehmend dem echten Leben widmete – mithin die Schule erfolgreich abschloss, die Universität besuchte, Europa bereiste, trotz Krise einen Job als Assistent der Geschäftsführung bei PepsiCo Neuseeland landete, auch seine Gestalt zu akzeptieren lernte und seine Jungfräulichkeit loswurde, gar beschloss, dereinst ein großer Mann zu werden – über diese fünf Jahre fand er sich, nachdem er die Regeln von „Sunmyra“ bis ins letzte Detail studiert und sich unter falscher Identität abermals erfolgreich um Teilnahme beworben hatte, jeden Tag für mehrere Stunden in der Spielewelt ein, um als „Dandaldo der Wirt“ eine Schenke an der Marina zu eröffnen, die sich dank der gemütlichen Atmosphäre, der freundlichen Art des Wirtes und der zunehmend ausgezeichneten, weil die Avatare mit Potenz, Mana und Energie versorgenden Speisen und Getränke schnell zum absoluten place to be in Sunmyra entwickelte. Jeden Tag fanden sich dort „Noemia die Schmale“ und ihre mörderischen Kollegen, die Alten wie die Jungen, die Guten wie die Bösen ein, um einvernehmlich zu trinken und, ihre Rollen vorsichtig ablegend, friedlich über das echte Leben, über Beruf, Beziehung, „Gaming“ und Weltpolitik zu schnattern. Dandaldo unterdessen stand hinter dem Tresen, lächelte freundlich und polierte die Gläser. In mühseliger Klickarbeit ließ Sneed ihn unendliche Drinks und Gerichte mixen und kochen, wodurch Dandaldos experience in diesen obskuren und eher als Nebensache angelegten Entwicklungspfaden von „Sunmyra“ ins Unermessliche stieg, seine Figur in immer entlegenere Fertigkeitswelten gelangte, in denen sich bald auch nur noch Sneed allein auskannte. Tagsüber sah man Dandaldo über die Hügel entlang der Marina streichen, durch Wiesen und Dickichte, an den heiteren Bächlein entlang, wo er zur Jagd auf Hasen und Rehe ging und seltene Kräuter sammelte, selbst tief in den finsteren, gefährlichen Wäldern suchte er noch nach Flechten, Pilzen und Moosen, bevor er im Laden des Gemüsemannes die reguläreren Zutaten für seine Kunst erstand. Abends servierte er das Erjagte, Gefundene, Gekaufte in herrlicher Zubereitung. Des Nachts dann aber, nach Ladenschluss, sperrte Dandaldo seine Schenke ab, stieg in deren Keller hinab und braute dort, von allen unbeobachtet, Gift. Das Gift, das Sneed alias Dandaldo zubereitete, nannte sich „Dolor Aeternitatem“, hatte, als einzige Substanz von „Sunmyra“, die Wirksamkeitsstufe 7, war mithin in ausreichender Konzentration zwingend letal, allerdings auch nur von den wenigsten Figuren und lediglich in winzigen Dosen produzierbar. Sneed verbrachte zahllose Stunden seines echten Lebens damit, Dandaldo in einem geheimen Raum unterhalb der Schenke ein Fass mit diesem Gift füllen zu lassen. Das Giftkochen bestand in einer elend komplizierten Folge von Klicks und Tastatureingaben, die fehlerfrei bleiben musste und sich nicht umgehen ließ, die Sneed daher auch schrecklich langweilte und ihn zugleich immer tiefer in sein Geheimnis hinabtauchen ließ. Denn den Wahnsinn dieser Zeitverschwendung, den Irrsinn dieses Aktes, dessen zunehmende Isoliertheit innerhalb der restlichen Tätigkeiten seines Lebens, auch die Nichtigkeit des Anlasses, all das hätte er niemandem erklären können, verstand er es doch selbst schon längst nicht mehr. Womit wir endlich wieder in der Gegenwart angelangt wären. Also. Peter, unsere Hauptperson, ist gerade in sein Auto gestiegen. Und Sneed, Sneed geht nun auch nach Hause, fährt dort seinen Rechner hoch, setzt sich die Holos auf die Augen und macht sich daran, heute, ausgerechnet an diesem Tag, den lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen und die Welt Sunmyra zu schleifen. Es ist eigenartig, wie viel Freude ihm das am Ende dann doch bereiten wird, hatte er vorher doch eher mit einem schalen Gefühl gerechnet, denn man muss bedenken, dass fünf Jahre intensiver Vorbereitung für diese kleine, letztlich sehr private Performance schon eher reichlich sind, und gerade wenn man wie Sneed innerlich schon eine gewisse Distanz zu solchen Spielewelten aufgebaut hat, droht der return on investment schmal auszufallen. Sneed hat eigentlich sogar Angst, sich am Ende selbst nur wieder neuerlich dafür verachten zu müssen, dass er für diese blöde Sache so viel Zeit in die Hand genommen hat. Aber es kommt ganz anders. Stanley Sneed hat sich diesen spezifischen Tag für seine Aktion ausgewählt, weil in Sunmyra Fasching gefeiert wird, der Höhepunkt des Kalenderjahres der Spielewelt. Zu solchen Festen muss sich, bei Strafe des Ausschlusses, wirklich jeder Spieler einloggen. Die Avatare werden in bunte Farben verkleidet, ziehen durch die feiernden, fackelbeleuchteten Straßen, die Spieler zischen vor dem heimischen Rechner dabei wohl auch selbst das ein oder andere Bier. Als Sneed aka Dandaldo seine Schänke aufsperrt, stehen die Avatare schon Schlange, im Handumdrehen ist die Klause rappelvoll, und da, im Gewimmel, sieht er auch Noemia die Schmale in knappestem Outfit, umgeben von ihrer Crew, den absoluten Freaks, die ihr ganzes Leben Sunmyra widmen. Sieht sie zwischen all den anderen Spielern, die Sneed, der ihrem privaten Geseier als Dandaldo über Jahre zuhören musste, kaum weniger hasst. Als sich die Festivitäten gegen Mitternacht ihrem Höhepunkt nähern, steigt er in den Keller und kippt das teure Fässchen mit dem geruchs- und geschmacksneutralen Gift in einen großen Trog Honigmet. Den schleppt er hoch in die Schenke, stellt sich auf den Tresen und ruft über den Lärm hinweg in CAPS: „Eine Runde aufs Haus, von Dandaldo für Sunmyra!“ „Ein Hoch auf Dandaldo!“, schallt es zurück, und ausgerechnet von Noemia angeführt drängt sich die ganze Kneipe, in der, schätzt Sneed, gerade wohl wirklich alle Spieler von Sunmyra versammelt sind, um seinen Tresen, und einem nach dem anderen reicht er einen Becher giftigsten Mets. Das Gift braucht etwa fünfzehn Minuten, bevor es zu wirken beginnt, und etwa eine halbe Stunde, um zu töten. Dandaldo hat kaum alle versorgt, da bricht schon der erste Avatar in einer Ecke der Schenke zuckend zusammen. „Was ist los?“, will sein Besitzer im public-chat-Modus wissen, da ereilt es neben ihm den nächsten, und dann schon den nächsten, und siehe, bald liegen die meisten Avatare auf dem Boden, und die Reihe ist nun an Noemia, auch sie rollt sich auf der Erde mit schäumendem Mund. „Was geschieht mit uns?“, schreien die Spieler durcheinander. „Wir sind vergiftet!“, ahnen einige, „Fuuuuuuuuckkk“ schreiben sehr viele, „Dandaldo!“, ächzen wenige korrekt. Panik ist ausgebrochen. Dandaldo aber hält sich versteckt, bis die ganze Kneipe handlungsunfähig und moribund ist, dann endlich steht er auf, klettert abermals auf den Tresen, um von dort zu verkünden, wer er in Wahrheit sei, ein Wiedergänger des unschuldig getöteten Mönchleins Aloisius nämlich, und dies sei seine Rache, alle würden nun sterben durch Dolor Aeternitatem, Sunmyra müsse untergehen, und dann fällt Sneed aus der Rolle und schreibt nur noch unflätigst und lachend Quatsch in die Tastatur, während die Sterbenden unter ihm hysterisch schreien und weinen, um Gegengift betteln, wildeste Flüche ausstoßen und vergeblich irgendwelche Heiltränke kippen. Viele der Spieler lieben ihre Avatare wie eigene Kinder, der fette Lette, dem Noemia die Schmale gehört, fühlt sich im Grunde halb mit der verheiratet, für ihn ist das, was ihm hier an diesem Abend widerfährt, ganz so, als müsste er seiner Geliebten beim Krepieren zuschauen, eine existenzielle Katastrophe, die er nie wirklich verwinden wird, zumal er überhaupt keine Erinnerung mehr hat an die Episode mit Aloisius, also gar nicht weiß, wofür er hier so plötzlich so drakonisch bestraft wird. Sneed, alleine vor seinem Rechner in Neuseeland, fühlt unterdessen, wie sich eine goldene Freude in ihm ausbreitet. Er weiß, dass er gerade etwas Schreckliches getan hat, er weiß aber auch, dass er gerade etwas total Egales getan hat, denn was, let’s get real, sind schon diese albernen virtuellen Figuren. Bald zucken die Avatare in der Schenke nicht mehr. Sie beginnen, transparent und geisterhaft auszuschauen, sie liegen still, sie sind tot. Sneed öffnet nun alle Foren und Chats, in denen es um Sunmyra geht, und wird Zeuge vollkommen entfesselter Austäusche. Er macht Screenshots von jeder Morddrohung, die gegen den User hinter Aloisius und Dandaldo ausgesprochen wird, er raucht endlich einen großen Joint und freut sich über jede Zeile Hass. Später wird er zu einer Legende werden in der obskuren Welt der Gamer-Foren. Videomitschnitte seiner Tat werden auf YouTube hochgeladen, denn was in Sunmyra geschehen ist, bleibt ohnegleichen. An einem einzigen Abend eine ganze Welt von einem einzigen User ausradiert, sodass schon kurz danach die Server runtergefahren werden, weil keiner jemals je wieder Sunmyra spielen will. Die meisten ähnlichen Rollenspielwelten bauen in der Folge einen „AD“-Passus in ihr Regelwerk ein, „Against Dandaldoing“, was bedeutet, dass ein solcher Giftanschlag von den Moderatoren im Bedarfsfall per Intervention in den Code selbst unterbrochen werden darf. Was diesen Welten allerdings natürlich einen Reiz nimmt, von dem zuvor niemand geahnt hatte, dass es ihn geben könnte, den Reiz der steten, leisen Angst vor dem jähen, unvorhersehbaren Ende durch eine geheime Schicksalsmacht nämlich. Dabei lässt dieser Reiz ja vielleicht nicht nur die virtuellen Erlebniswelten intensiver erscheinen. Seht also jedenfalls: Dort schleicht Stan Sneed, Angestellter von PepsiCo, Assistent des Gene Jeffries, Bewohner Neuseelands und heimlicher Killer von Sunmyra, und kein Mensch sieht es ihm an, und niemand weiß es, und doch ist er einer von uns, unter uns. 1 – GEFEUERT/SUNMYRA Zu Beginn dieser Geschichte, ein paar Wochen vor seinem Verschwinden also, sehen wir Peter Siebert noch in den Kellern des Hauptquartiers von PepsiCo Neuseeland. Unter kaltem Neonlicht steht er, umgeben von spiegelnden Oberflächen, weißen Kacheln und poliertem Metall. Er befindet sich in einem Labor, er ist: allein. Gerade steckt Peter die fünf Teile einer langen marokkanischen Holzpfeife zusammen. Den tönernen Kopf hat er mit Gras gestopft, das will er rauchen, um sich danach und in verändertem Zustand wieder seiner Arbeit widmen zu können, den Reagenzgläsern und farbigen Aromafläschchen also, die vor ihm bereitstehen wie Zinnsoldaten in bunten Uniformen. Schon hat er die Pfeife im Mund, es springt bereitwillig das Flämmchen aus dem silbernen Feuerzeug, da betritt ohne Ankündigung und sozusagen polternd ein junger, ihm fremder Mann das Labor, stammelt, beim Anblick des offensichtlich mit Halbseidenem befassten Peter, erschrocken eine Entschuldigung. Er habe, sagt der junge Mann, bitte nicht stören wollen. Stan Sneed sei der Name, er sei der Assistent von Gene, also, von Gene Jeffries. „Haben Sie“, fragt Peter kalt, während er die Pfeife wieder auseinanderbaut, „schon einmal was von Klopfen gehört? Und was kann ich für Sie tun, Stan, bitte schön?“ „Mister Jeffries würde Sie gern sprechen.“ Ah. Mister Jeffries – Eugene – ist regional sales director von PepsiCo in Neuseeland. In der globalen Konzernhierarchie hat dieser Mann keine sonderliche Bedeutung. Dass er Peter sprechen will, ist seltsam, weil der als sogenannter consultant direkt dem Marketingvorstand des Brauseunternehmens untersteht, im weit entfernten Purchase, New York. Jeffries weiß tatsächlich noch nicht einmal, was Peter in den gewöhnlich verlassenen Kellerlabors von Pepsi Auckland so treibt. Er hat vor einer Weile bloß Weisung aus der Zentrale erhalten, dass dieser seltsame Deutsche bei ihm erscheinen würde, er solle den nach dessen eigenem Ermessen schalten und walten lassen. „Geht es um jetzt sofort?“, fragt Peter. „Ja“, sagt Stan Sneed. „Ich glaube schon.“ Also schiebt Peter das Pfeifenmäppchen zurück in seine rechte Jacketttasche und folgt Sneed in den vierten Stock des Gebäudes, die Chefetage. Unterwegs kann Sneed sich ein paar Seitenblicke auf Peter nicht verkneifen. Peter schaut, muss man sagen, allerdings auch wirklich sehr besonders aus, so besonders, dass man in den Fluren, in der Kantine von PepsiCo Neuseeland seit Wochen ständig über ihn flüstert. An diesem Tag zum Beispiel trägt er ein Paar kirschfarbener Tassel-Loafer, dazu flaschengrüne Seidenstrümpfe, knöchellange, kastanienfarbene Slacks aus grober Wolle, einen Kaschmir-Rollkragenpullover in Bordeaux und darüber jenes schmal geschnittene Jackett aus buntem Shetland-Tweed, in dessen geräumigen Pattentaschen auch sein Pfeifenmäppchen Platz findet. Diese Garderobe sitzt auf einem langgliedrigen Körper, dessen Fettanteil Peter durch regelmäßige Gymnastik und eine streng geregelte Diät penibel bei zehn bis zwölf Prozent hält. Sein ebenmäßiges, fein gebräuntes Gesicht ist wie stets messerscharf rasiert und duftet nach „Pour Monsieur“, die gescheitelten hellblonden Haare trägt Peter im Nacken derzeit protomodisch etwas zu lang wie die traurigen russischen Amateurpornodarsteller, die auch Gvasalia inspirieren. An Peters Handgelenk baumelt eine dreißig Jahre alte Cartier Santos in Stahl und Gold, hergestellt im Jahr seiner Geburt. Protestantisch gesinnte Menschen könnten unserem Freund wohl eine gewisse Oberflächlichkeit unterstellen. Und die hat Peter auch irgendwo, klar hat er die, er beschäftigt sich beruflich ja nicht umsonst mit der Welt des Sinnlichen, und hat dafür übrigens eine Begabung, die weltweit ihresgleichen sucht. Zugleich aber, und man sollte das hier am Anfang schon einmal deutlich festhalten, weil sonst ein falscher, allzu unerfreulicher Eindruck von ihm entstehen könnte, ist Peters Erscheinungsbild keiner Selbstverliebtheit geschuldet. Im Gegenteil ist sein Äußeres sogar nur insofern Ausdruck seiner Seele, als Peter hinter dieser Fassade zu verschwinden hofft. Es wird geboren aus der Hoffnung eines immens privaten und selbstzweiflerischen, ästhetisch allerdings auch vollkommen überbegabten Menschen, einen angenehmen, unanstößigen Auftritt hinzulegen. Inzwischen führt Sneed Peter schon durch einen Gang im vierten Stock. Peter bemerkt, dass die Wände hier von einer schönen, taupefarbenen Leinentapete bedeckt sind, die aus den Sechzigerjahren stammen dürfte. Der Linoleumfußboden riecht schwach nach einem essigbasierten Reinigungsmittel, sauber, klar, angenehm, vermutlich ein Eigengemisch der Putzkraft. Solche Sachen fallen Peter auf. Das Büro am Ende des Ganges ist das von Eugene Jeffries. Der sitzt hinter seinem Schreibtisch und hat noch Holos auf den Augen, als Sneed und Peter durch das Vorzimmer eintreten. Jeffries macht blind eine entschuldigende Geste in deren Richtung und beendet dabei sein Gespräch: „Jetzt sind sie da. Ich muss Schluss machen. Ja. Ich denke dran. Ja. Ja. Danke. Ich weiß. Bye bye. Ja. Klar. Bye-b… Ah.“ Jeffries ist ein großer, schwerer Mann mit wenig Haar, der heimlich noch immer erschrocken ist darüber, dass er seit etwa einem Jahr keinen direkten Vorgesetzten mehr hat. Er trägt einen schlecht geschnittenen schwarzen Dreiteiler, seine Füße stecken in brotlaibförmigen braunen Slippern mit Gummisohle. Auf Jeffries’ Schreibtisch stehen Fotos von ihm und seiner Familie, an der Wand hängen ebenfalls Fotos von ihm und seiner Familie, Jeffries hat sie in vorauseilendem Gehorsam für seine Frau aufgehängt. Vor dem Fenster mit Blick auf Parkplatz und Baumwipfel steht ein bräunlicher Farn, den Jeffries zu oft gießt. „Herr Siebert!“, sagt Jeffries, beugt sich über seinen Schreibtisch, um Peter die Hand zu reichen, wischt dabei versehentlich die Holos vom Schreibtisch, bückt sich, um sie aufzuheben, wobei ihm ein leiser Wind entfährt. Er reicht Peter errötend abermals die Hand und bedeutet ihm, sich doch bitte zu setzen. Peter, ein gefrorenes Lächeln im Gesicht, leistet Folge und fürchtet, dass Jeffries ihn doch bloß hochgebeten hat, um ihm ein Lunch oder so was vorzuschlagen. Vor solch informellen, unkartografierten Begegnungsformen flieht Peter, so gut es geht. „Ähh“, macht unterdessen Jeffries, den dieses gefrorene Lächeln in Peters Gesicht verunsichert. „Ja. Es ist toll, Sie wiederzusehen, wir haben uns ja an Ihrem ersten Tag hier nur in der Lobby … Ich hoffe, es gefällt Ihnen bei uns. Ich weiß offen gestanden gar nicht, was genau Sie hier machen, hahaha! Wobei, neulich schickte mir doch Stan hier …“ Sneed, der hinter Peter sitzt, macht eine panisch abwehrende, vergebliche Geste. „Neulich schickte mir Stan einen Artikel über Sie! Ich glaube, aus dem Magazin Douche? ›The Teuton Instinct‹ oder so ähnlich? Hahaha.“ Peter zieht die Augenbrauen hoch und nickt. „Hochinteressant, wirklich! Ich habe ihn ganz gelesen. Auch dieser Ausdruck, den man für Sie erfunden hat, Gestaltdesigner, ganz toll.“ Jeffries schaut Peter Hilfe suchend an. „Toll“, sagt er noch einmal. „Danke, Mister Jeffries“, erlöst ihn Peter. „Ich weiß auch nicht, wie die Leute von der Douche mich entdeckt haben.“ „Hahaha!“ „Womit kann ich Ihnen denn dienen?“, fragt Peter. „Aaah“, sagt Jeffries und rutscht in seinem Stuhl hin und her. „Aaah.“ Er furcht die Stirne und schaut konzentriert auf ein Foto auf seinem Schreibtisch, als erkenne er seine Kinder auf einmal nicht mehr. „Also“, sagt Jeffries endlich, „ich habe vor ein paar Minuten einen Anruf aus Amerika, aus Purchase, gekriegt.“ Aber dort ist es, denkt Peter, doch gerade mitten in der Nacht. „Und es ist so … Erlauben Sie mir, direkt zu sein. Man hat mir gesagt, dass Ihr Vertrag, äh … be… ja, beendet ist. Also, man hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass Ihr Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet ist.“ Peter versteht nicht. Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. Er ist noch nie gefeuert – und das ist doch das, was hier gerade passiert? –, gefeuert worden. Aber warum? Bei dem Projekt, mit dem die Firma Pepsi Peter betraut hat, geht es um die Entwicklung eines neuen Getränks in der sogenannten Lifestyle-of-Health-and-Sustainability-Sparte, in der sich der Konzern nach eigener Meinung zu zögerlich, nicht gut aufgestellt hat. Peter, der seine eigenartige Arbeit im Grunde überall auf der Welt verrichten kann, hatte für das Projekt um ein Labor in Neuseeland gebeten, weil er sich von diesem Land und seiner Natur Inspiration, die rechte Stimmung erhofft hatte. Und tatsächlich geht die Arbeit gut voran, auch wenn sich Peter in Auckland noch einsamer fühlt als sonst. Sein Entwurf für Pepsi ist ein „hypermineralisiertes“ Wasser, das dem Konsumenten „perfekte Mineralisierung“ verspricht. Für dieses neue Produkt hat er sich den Namen Myned ausgedacht. Peter hat das Flaschendesign, die Werbekampagne, die Targetgruppen, er hat alles längst entworfen oder im Kopf, sogar den Geschmack. Seine Spezialität sind Gesamtpakete, Produkt und Marketing aus einem Guss, und Peter weiß mit seiner branchenweit bekannten, unfehlbaren Sicherheit auch, dass Myned ein großer Erfolg werden wird. Tatsächlich arbeitet er nur noch an letzten Geschmacksnuancen, an der Vanillenote, mit der er Myned noch weicher machen will. Was also, fragt sich Peter, war wohl sein Fehler? Wo war er unachtsam oder nicht zufriedenstellend für den Konzern? Er muss irgendwas übersehen, er muss sich irgendwie falsch verhalten haben. Oder versteht er gerade etwas nicht richtig? „Gefeuert“, sagt er. Seine Stimme ist ein paar Tonlagen höher als gewohnt, er räuspert sich. „Ich bin gefeuert, habe ich das richtig verstanden?“ „Neeein“, sagt Jeffries und macht eine beschwichtigende Handbewegung. „Nicht so!“ Er schaut hilflos zu Sneed, der diesen Austausch mit echtem Erstaunen verfolgt und seinem Chef keinerlei Unterstützung bieten kann. „Schauen Sie, das habe ich befürchtet“, sagt Jeffries unglücklich, „ich bin einfach so schlecht mit Worten. Also, na ja, Sie sind, in Anführungsstrichen, schon gefeuert.“ Peter lacht. „Was denn nun, Mister Jeffries?“ „Gene, bitte. Nennen Sie mich Gene.“ „Bin ich gefeuert, Gene?“ „Ja, schon.“ Jeffries macht wieder diese beschwichtigende Geste. „Aber man hat mir in Purchase aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass das absolut nichts mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Dass Sie einen ganz fantastischen Job gemacht haben.“ „Aha“, sagt Peter. Warum feuert man ihn für einen fast fertigen, angeblich fantastischen Job? Bei seiner Vertragsunterzeichnung hatte er noch den Eindruck gehabt, dass Pepsi so ein Produkt wie Myned ganz dringend suchte. Mehrere hochrangige Manager waren bei seinem Pitch zugegen gewesen. Und warum rufen die mich eigentlich nicht persönlich an, fragt er sich. Warum muss mich dieser armselige Jeffries entlassen? „Also“, sagt der, „wie gesagt sollen Sie wissen, Peter, dass der Konzern von all Ihren bisherigen Ideen ausgesprochen angetan ist. Aber die haben das Projekt – ich weiß ja gar nicht, worum es genau geht – aus internen Gründen auf Eis gelegt, so hat man das da ausgedrückt.“ Jeffries zuckt mit den Schultern und versucht, irgendwie brüderlich und professionell zugleich zu gucken. Peter schweigt. „Sie kennen wirklich keine genaueren Gründe?“, fragt er dann. „Geht es um Geld?“ „Ich weiß wirklich nichts“, sagt Jeffries wahrheitsgemäß. „Geld ist ja immer ein Faktor, oder? Aber zu dem Thema: Sie kriegen selbstverständlich die für diese Fälle im Vertrag vorgesehene Abfindung, das soll ich dringend ausrichten.“ „Aber was bedeutet das jetzt denn genau?“, fragt Peter. „Sie meinten sofortige Wirkung. Heißt das wirklich sofort?“ „Ja. Das habe ich auch gefragt. Sie können auf der Stelle gehen.“ Wenig später betritt Peter den Parkplatz vor dem PepsiCo-Gebäude, eine von Gebüsch und hohen Eukalyptusbäumen gesäumte Asphaltfläche am Stadtrand von Auckland, über der grellorange, in Pepsisprache sozusagen mirindafarben der herbstliche Himmel der Abenddämmerung steht. Es ist später Nachmittag und ungewöhnlich schwül, die Welt riecht schwer nach den öligen Bäumen, nach Asphalt und heraufziehendem Regen. Peter fühlt sich, als sei er auf einem fremden Planeten oder in einem fremden Leben, vollkommen verloren. Gewöhnlich würde er nun zurück in sein Hotel fahren. Gewöhnlich würde er dort im Gym seine Übungen machen, alleine am Tresen des japanischen Restaurants nebenan zu Abend essen, schließlich, vor dem Schlafengehen, auf seinem Zimmer noch „das Netz abarbeiten“, also penibel durch eine streng kuratierte Linkliste gehen, die aus ein paar großen Nachrichtenseiten, vor allem aber aus eigenartigen Blogs, Foren und Instagram-Feeds besteht, in denen sich für Peters Begriffe die Gegenwart kristallisiert. Tausend Bilder am Tag will Peter betrachten, das ist Teil, denkt er, seiner Disziplin und Arbeit. Schließlich würde Peter gewöhnlich in seine Pyjamas steigen. Nachts schläft er nur unruhig und fährt bisweilen desorientiert, mit jähem Schreck auf, ängstigt sich pochenden Herzens vor dem Sterbenmüssen, als stünde ein Mörder am Fußende des Bettes, und er fühlt sich dann haltlos und verlassen in seiner merkwürdigen, einsamen Existenz, in der niemand je warm und atmend neben ihm im Bett liegt. Und gewöhnlich würde Peter am kommenden Morgen zeitig aufstehen, um mit dem anderen, abendlichen Ende der Welt zu telefonieren: mit seiner Assistentin Friederike in Hamburg wegen des Geschäftlichen, und mit dem Privatdozenten Harald Siebert, seinem geliebten großen Bruder, einem verheirateten Vater dreier Kinder, wegen des Menschlichen. Mittwochs ruft Peter außerdem noch einen „Coach“ an, wegen des sogenannten Seelischen. Danach würde Peter gewöhnlich mit Musik auf den Ohren durch Auckland irren, die frei vor ihren Rechnern flottierende Jeunesse in den Cafés beobachten, die schlammbedeckten Rugbyspieler beim Training in Nebel und Regen. Fröstelnd am grauen Strand rumstehen wie ein Mann, der auf ein Schiff aus der Heimat wartet. Und dann endlich, nach dem Mittagessen, würde er ins Labor fahren und sich in der Arbeit verlieren. Gewöhnlich. Das ist jetzt ja aber offenbar in dieser Form zu Ende. Die bis zum Abend verbleibenden Stunden erstrecken sich vor Peter strukturlos und bedrohlich. Er betrachtet seinen Mietwagen, der im Halblicht steht wie ein großes, glänzendes Insekt. Peter hat den vagen Plan, sich in dieses Auto zu setzen, ins Hotel zu fahren, dort einen Drink zu nehmen vielleicht, denn in so einer Situation, stellt er sich vor, nimmt ein Mann doch einen Drink, an der Bar, alleine, lernt, das wäre natürlich schön, eine ebenfalls einsame Frau kennen. Er muss auch Friederike anrufen, fällt ihm ein, die Sache erklären. Peter wählt ihre Nummer, er wird sie nicht erreichen, denkt er, es ist ja noch wahnsinnig früh in Hamburg, aber dann klingelt es immerhin, und dann geht Friederike sogar ran, mit verschlafener Stimme. „Hey, Peter“, sagt sie. „Ist alles in Ordnung?“ „Habe ich dich geweckt?“ „Nein nein, schon okay, ich liege irgendwie sowieso wach. Warte mal, ich geh mal kurz aus dem Schlafzimmer.“ Peter schweigt. „Wieso rufst du denn an, ist alles okay?“, fragt Friederike. „Du, es ist etwas ganz Seltsames passiert gerade“, sagt Peter. „Ich bin … ich bin gerade gefeuert worden hier von Pepsi.“ „Was?“ Peter hört, wie sich Friederike eine Zigarette anzündet. „Bist du sicher?“ Peter antwortet nicht. „Blöde Frage, entschuldige. Aber … wieso denn?“ „Das ist es ja, ich habe keine Ahnung. Die haben gesagt, sie seien total zufrieden mit dem Projekt, aber aus angeblich konzerninternen Gründen müsste man mich absägen.“ „Wie seltsam. Ist alles okay bei dir?“ „Ich frage mich, was ich falsch gemacht habe.“ „Du hast bestimmt nichts falsch gemacht.“ „Aber warum haben die mich gefeuert? Vielleicht habe ich mich irgendwie schlecht benommen? Ich hab hier mit niemandem mal Lunch gegessen oder so, weißt du? Vielleicht fanden die mich arrogant oder so, vielleicht haben die sich in Purchase über mich beschwert.“ „So ein Unsinn“, sagt Friederike in einem Ton, der Peter ein bisschen beruhigt. „Jetzt warte mal kurz. Du meintest doch, Myned würde sehr gut laufen?“ „Ja, ich fand schon.“ „Na also. Wenn du das sagst, dann ist das auch so. Pepsi ist doch scheißegal, wie du dich in dem Laden benimmst, die wollen einfach, dass das Produkt gut ist.“ Sie schweigt für einen Moment. „Vielleicht gibt es irgendeinen Wechsel in der Konzernführung, von dem wir noch nichts mitgekriegt haben. So was. Die melden sich deswegen bestimmt auch noch bei dir. Mach dir keine Sorgen.“ „Ich hab Angst, dass ich mich irgendwie dumm angestellt habe“, sagt Peter. „Das ist doch auch irgendwie respektlos, ich bin hier echt von dem Regionalchef einfach vor die Tür gesetzt worden, weißt du? Das hat keine fünf Minuten gedauert.“ Peter stellt sich vor, dass man in Purchase über ihn lacht oder aus lauter Unzufriedenheit mit ihm dafür sorgt, dass er nie wieder einen Job kriegt. Bald, so fühlt er, ist es mit der Arbeit dann ganz zu Ende, dann sitzt er auf der Straße, dann kräht kein Hahn mehr nach ihm. So ist das bei ihm immer. Wenn etwas nicht glatt läuft, kriegt er gleich Zweifel an seiner ganzen Person, an seiner ganzen Stellung in der Welt. „Die schulden dir auf jeden Fall schon mal eine fette Entschädigung“, sagt Friederike. „Ich check das gleich noch mal im Vertrag aus. Ich bin mir sicher, dass deine Arbeit nicht der Grund gewesen ist und erst recht nicht deine Art. Du bist halt nicht so der supersoziale Typ, na und? Bislang haben ja wohl alle Arbeitgeber immer deine Professionalität gelobt, und dass deine Pakete am Ende stimmen, ist ja sowieso klar. Das liegt an irgendwas anderem.“ Peter fühlt sich ein bisschen getröstet. „Was machen wir denn jetzt?“ „Ich muss gleich noch mal in deinen Planer gucken. Das nächste Projekt ist, wenn ich mich erinnere, doch erst in vier Wochen, Nestlé, oder?“ „Ja, kann gut sein. Das ist dann eine ganze Weile hin. Kann man das nicht vorziehen vielleicht?“ „Du hattest dir doch überlegt, surfen zu gehen, wenn die Zeit es zulässt, Bali? Dann fährst du halt jetzt mal hin für ein bisschen länger. Und kommst auch mal runter. Ich sag dir doch seit Monaten schon, dass wir mal einen anständigen Urlaub einplanen müssen für dich.“ „Hab ich denn die Kröten?“, fragt er bescheiden. „Peter“, lacht Friederike. „Komm schon.“ „Okay. Kannst du mal nach Flügen und schönen Hotels für mich gucken? In Keramas oder so?“ „Klar, mach ich.“ „Und bei Nestlé anrufen, ob das Projekt noch steht?“ „Mann, Peter. Ich mach das, okay. Aber natürlich ist das noch ein go. Ist doch alles längst unterschrieben. Reg dich nicht so auf. Ist doch egal, wenn die dich gefeuert haben, die Trottel. Wahrscheinlich ist die fällige Entschädigung sogar teurer, als dich bis zum Ende des Projekts weiterzubezahlen. Die schießen sich doch da selbst ins Bein. Mit Geld hat das also nichts zu tun, das ist irgendwas anderes, und wir verstehen das bestimmt auch noch. Purchase wird sich garantiert bei dir melden.“ „Okay. Du bist fabelhaft. Das beruhigt mich ein bisschen. Danke. Ist bei dir alles in Ordnung?“ „Ach, danke, ja, mir geht’s gut. Das Kolloquium gestern war nicht schlecht, die Diss steht, glaube ich. Und ach so, ja, Pelle hat mir gestern vorgeschlagen, zusammenzuziehen. Also er will das. Ich weiß noch nicht. Ich hab keine Ahnung, ob ich den Kerl die ganze Zeit ertrage. Wahrscheinlich kann ich deswegen nicht schlafen. Ich meine, eigentlich ist das so süß. Und schön ja auch. Aber …“ In diesem Moment lässt Peter auf dem Parkplatz in Neuseeland vor Schreck das Handy fallen, denn offenbar wird in einem Gebüsch zu seiner Linken gerade eine Frau ermordet. Oder zumindest klingt der Schrei, der Mark und Bein durchdringend aus dem Dickicht gellt, für den ersten Augenblick ganz genau so, und für diese eine Sekunde dämmert Peter auch wie hellsichtig, dass vielleicht gar nicht Pepsi für seine Demissionierung verantwortlich sein könnte, sondern dass eine schicksalhafte Kraft nach ihm greift und etwas Schreckliches mit ihm anzustellen gedenkt. Diese Ahnung versinkt jedoch gleich schon wieder, gewinnt der Schrei im Abklang doch eine eindeutig vogelhafte, animalische Klangfarbe, im Gebüsch sitzt und ruft also bloß irgendeine Peter fremde, antipodische Kreatur. Peter fasst sich an die Brust, in der das Herz rast, bückt sich fahrig nach seinem auf der Erde liegenden Telefon, dabei fallen ihm die Autoschlüssel aus der Tasche und unter den Mietwagen. „Peter? Was war das denn?“, fragt Friederike, die er wieder am Ohr hat. „Du, keine Ahnung! Irgendein Tier, glaube ich. Furchtbar! Keine Ahnung, wer … Moment.“ Es klopft an in Peters Leitung. „Anonym“ liest er auf dem Display. „Friederike? Jesus. Entschuldige, jetzt geht bei mir gerade ein Anruf ein, ich glaube, das ist Pepsi. Ich geh da mal ran, ja?“ „Absolut! Sei ruhig ein bisschen wütend mit denen, das geht so nicht. Und dann meld dich danach wieder! Ciao!“ „Mach ich! Ciao.“ Peter wechselt zum anderen Gespräch. „Siebert“, sagt er zittrig. „Herr Siebert. Entschuldigen Sie bitte, dass ich unangekündigt anrufe.“ Amerikanisch, fremde Frau. „Mit wem spreche ich, bitte?“ Die Frau am anderen Ende stellt sich vor als Clementine Bouvet. „Ich bin Anwältin“, sagt sie ominös. „Rufen Sie aus Purchase an?“ „Purchase?“ „Sie sind nicht bei Pepsi?“ Am anderen Ende der Leitung kurzes Schweigen. „Peter, nein, nicht bei Pepsi, nicht aus Purchase. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie einen Anruf erwartet? Ich rufe Sie an, weil …“ „Woher haben Sie meine Nummer?“, unterbricht Peter. „Über Bekannte. Peter“, sagt die Anwältin, „gestatten Sie bitte, dass ich gleich zum Punkt komme, ich habe, ehrlich gesagt, wenig Zeit. Ich rufe Sie an, weil ich Sie gerne kennenlernen möchte.“ „Privat?“, fragt Peter verwirrt, während er sich bäuchlings auf den Boden legt, um nach den Autoschlüsseln zu schauen. Die Anwältin am anderen Ende der Leitung lacht. „Business. Wir haben ein sehr interessantes Projekt für Sie. Ist allerdings noch, Sie kennen das ja, nehme ich mal an, geheim, und mein Klient hat mich gebeten, Sie sozusagen einmal abzuklopfen dafür.“ „Aha“, sagt Peter, und als vom anderen Ende wieder nichts kommt, auf einmal gereizt: „Hallo? Würden Sie mir bitte verraten, wer Sie sind.“ „Natürlich, Peter“, sagt die Anwältin. „Das ist sicher eine unkonventionelle Kontaktaufnahme. Es geht nur darum, dass es ein bisschen drängt mit unserem Projekt.“ „Schreiben Sie“, sagt Peter, dem endgültig die Nerven durchgehen, „doch bitte meiner Assistentin, wie das übrigens auch absolut üblich ist. Die Adresse finden Sie online. Ich bin die nächsten Monate allerdings total ausgebucht.“ Er legt auf. Ein paar Sekunden später klingelt das Handy abermals. „Es geht um sofort“, sagt die Anwältin. „Wir würden Sie gerne dazu bewegen, sofort bei uns vorstellig zu werden.“ „Ha!“, macht Peter. „Ich bin mir sicher, dass Sie viel zu tun haben, Peter“, sagt die Anwältin. „Und natürlich haben Sie keine Lust, ständig von irgendwem angerufen zu werden, deswegen bitte ich abermals um Entschuldigung für diesen Überfall. Aber wie gesagt: es ist dringend, und ich wollte nicht über Ihr Büro gehen, sondern die Sache direkt mit Ihnen persönlich klären. Würden Sie mir erlauben, zwei, drei Sätze zu dem Projekt zu sagen – mehr geht im Moment sowieso nicht?“ Peter betrachtet sein Spiegelbild in der schimmernden Türe seines Wagens. Hinter ihm bewegt sich etwas, er dreht sich um und sieht Stan Sneed, der in der Eingangstür von PepsiCo, Neuseeland, erscheint und ihn beobachtet. Das Pepsi-Gebäude sieht auf einmal sehr klein aus, trist, der Anblick macht Peter wütend. „Meinetwegen“, sagt er. „Pray tell.“ Ihr Klient, sagt die Anwältin, sitze in Kalifornien. „Er hat als Unternehmer sehr viel Geld verdient. Software. Er macht aber mittlerweile eigentlich nur noch VC … Venture Capital.“ „Ich weiß, wofür VC steht“, lügt Peter. „Nun entwickelt er zum ersten Mal seit Jahren wieder selbst ein Projekt, eines, von dem er glaubt, dass es die Welt verändern wird. Also, wirklich verändern. Ich rede hier von der Größenordnung des Internets. Für meinen Klienten …“ Peter hat aber auf einmal eine Idee. „Sagen Sie, Mrs, ähm, Mrs“, sagt er. „Für welche Kanzlei arbeiten Sie eigentlich?“ Bei Klient und Geld ist ihm diese Frage in den Kopf gefallen. Er kennt selbst zwar keine einzige Kanzlei beim Namen, mit dem ganzen legalen Kram, mit Patenten und dergleichen, Dingen, die theoretisch ein großer Teil seines Geschäftsfelds sein könnten, hat er sich nie beschäftigt, so was macht höchstens Friederike – aber er hat plötzlich das Gefühl, dass er hier besser wie ein Detektiv vorgehen, den Dingen auf den Grund gehen sollte, denn was ist eigentlich gerade los, vor einer halben Stunde noch gedachte er doch bloß, seine Pfeife zu rauchen? Jetzt will er mal ein bisschen mehr rausfinden, auf die Finger klopfen, was, mit dem Namen, die googeln oder so. „Peter“, sagt unterdessen Clementine Bouvet. „Sie hören mir nicht zu. Ich arbeite für keine Kanzlei. Ich arbeite für nur einen einzigen Mann. Fulltime. Hier spricht nicht die Micky Maus. Es geht, ich wiederhole mich nur ungern, sehr ernsthaft um ein Projekt, das die Welt verändern wird. Auch Ihre, ob Sie mitmachen oder nicht.“ Wieder dieser langweilige Ausdruck, „weltverändernd“, das hat für Peter keinen sonderlichen Sound mehr, genau wie dieses blöde „disruptiv“. Jedes Produkt, an dessen Entwicklung er teilhat, soll inzwischen die Welt verändern, Peter hat längst begriffen, dass es sich um eine bloße Phrase handelt, die einfach erwartet wird, schon lange nicht mehr nur im Silicon Valley. Er hört das noch in jedem Pitch, es geht dann zwar bloß um Limonade, Chips, Spültabs, aber all das ist angeblich auch schon „weltverändernd“. Das Virus, denkt Peter, war weltverändernd, disruptiv. Dass die sich dieses Wort nicht mal sparen können. „Das Produkt, von dem ich spreche“, fährt unterdessen die Anwältin fort, „wird eines sein, das nicht rein digital, sondern physisch existiert. Für alle sinnlichen Qualitäten des Projekts sucht mein Klient nun einen beratenden Experten. Er hat das Porträt über Sie in der Douche gelesen und hält Sie für geeignet.“ „Ich verstehe“, sagt Peter, der jetzt doch zuhört. Die Anwältin spricht schnell, schnörkellos, eindrücklich. Dass sie den Artikel erwähnt, gefällt ihm. Er hält die Douche für eines der zeitgeistigsten, relevantesten Magazine überhaupt, es hat keine breite, aber eine sehr einflussreiche Leserschaft. „Mein Klient ist ein sehr besonderer Mann, Peter. Sie würden mit Sicherheit gerne mit ihm zusammenarbeiten. Ich kann an dieser Stelle noch nicht viel mehr sagen. Ich möchte Sie allerdings nun, deswegen rief ich ja an, erneut einladen.“ Peter fragt sich plötzlich, ob diese Clementine Bouvet nicht vielleicht sogar für Drew Itautis arbeiten könnte, den weltberühmten Unternehmer aus Kalifornien. Er stellt sein Handy auf Lautsprecher und googelt „drew itautis lawyer“, findet aber keinen hilfreichen Eintrag. Die Anwältin bietet Peter einen Flug erster Klasse nach Washington, D. C., an. Von dort aus, erklärt sie, solle er weiterreisen nach West Virginia, zu einem Retreat, in dem er drei Tage lang bleiben würde, um der Anwältin zu begegnen und an einer Art Assessment Center teilzunehmen. „Assessment Center?“, sagt Peter. „Ein Kennenlernen“, sagt die Anwältin. „Keine Sorge. Keine Mathetests, keine Consulting-Rätsel.“ Für den Aufwand dieser drei Tage soll Peter eine Entschädigung erhalten, die Anwältin nennt eine Summe, die einem Vielfachen von Peters üblicher Rate entspricht, das Geld würde sofort auf sein Konto gehen, wenn er jetzt zusagen sollte. „Ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende auch längerfristig passen wird, Peter. Für Sie und für uns. Wir haben uns Ihren track record ganz genau angesehen und glauben, dass Sie der richtige Mann für uns sind. Sie müssten allerdings eben bitte wirklich sofort zusagen. Wir würden Ihnen dann auch gleich das Ticket zukommen lassen, sodass wir Sie so bald wie möglich hier haben könnten.“ Peter sitzt inzwischen auf der Motorhaube seines Mietwagens. In dem Gebüsch zu seiner Linken bewegt sich etwas. Ein seltsames, räudiges Tier hoppelt daraus auf ihn zu. Peter erkennt, dass es sich wohl um einen Kiwi handelt. Diese Kreatur hat offenbar gerade so furchtbar geschrien. „Sagen Sie mir bitte einmal ganz kurz, worum es geht“, sagt Peter. „Kann ich nicht. Es geht um eine neue Technologie, um etwas, das es so noch nicht gibt. Elektronik, im weitesten Sinne.“ „Sie wissen, dass ich bislang eher in anderen Branchen gearbeitet habe?“ „Wie gesagt, wir haben uns über Ihre bisherige Arbeit so gut informiert, wie das ohne ein echtes Gespräch möglich ist. Sagen Sie zu und schauen Sie dann auf Ihr Konto, wir überweisen Ihnen Ihr Honorar per push, dann wissen Sie, dass wir es sehr ernst meinen.“ „Ich hätte zufällig tatsächlich gerade ein paar Tage Zeit“, hört sich Peter sagen. „Wirklich?“, antwortet die Anwältin. „Großartig!“ Ihr Erstaunen ist übrigens gespielt. Es war diese mächtige, ausgesprochen gut vernetzte Frau selbst, die durch ein paar wenige Anrufe innerhalb von Stunden für Peters vorzeitige Entlassung gesorgt hat. So viel sei hier schon verraten. „Ich bin derzeit in Neuseeland“, sagt Peter, während er sein Auto aufsperrt und sich ängstlich nach dem Vogel umdreht, der immer näher kommt. „Dann werden Sie vermutlich über L. A. fliegen müssen“, sagt die Anwältin. Ein paar Augenblicke später sieht Stan Sneed, wie Peter in das Coupé steigt und den Wagen anlässt. Der Auspuff hüllt den Kiwi sofort in eine dichte Qualmwolke. Das Auto fährt an, beschreibt eine große Kurve über den Parkplatz und saust davon, wobei laute Orgelmusik durch die geöffneten Scheiben weht. Es handelt sich um Bachs Kleine Fuge in a-Moll, und man könnte mit dieser Musik leicht zu den opening credits übergehen, zu einer schönen Montage, die Peters Reise nach Amerika zeigt. Die Musik passt aber genauso gut zu einer anderen Geschichte um Stan Sneed, die hier als kleiner Zwischengang erzählt werden soll, bevor es mit Peter weitergeht. Deren Anfang liegt fünf Jahre zurück. Damals war Stan Sneed noch Schüler, kaum sechzehn Jahre alt, befallen von einer quälenden Schüchternheit, unglücklich mit sich selbst und dementsprechend auch nur unglücklich verliebt – ein Teenager, wenn man so will. Haley, seine durchaus Angebetete, darf man sich vorstellen als den rotwangigen, bereitwillig lachenden, heiteren Typus, eine kleine, wärmende Sonne inmitten einer Schar von fröhlichen Freunden. Sneed hingegen, bleich, vampirhaft, war ein loner, und er verbrachte einen großen Teil seiner Zeit mit Computerspielen, die ihn ablenken sollten von seiner Einsamkeit und der Unfähigkeit, Haley anzusprechen, dabei warf die ihm doch, wie er meinte, bisweilen verstohlene Blicke zu. Im Unterschied zu den übrigen geeks seiner Altersklasse hatte der Computerspieler Sneed längst jedes Interesse an Blockbuster-Shootern und sogenannten massively multiplayer online role-playing games verloren. Stanley Sneed versenkte sich in esoterischeren, verträumteren Online-Welten, in speziellen, anspruchsvoll modifizierten Rollenspielszenarien, bei denen die User in gemeinsamer, konzentrierter Arbeit eine möglichst große erzählerische Dichte herzustellen versuchten, indem sie komplizierten Regeln in strenger Auslegung folgten. Plattformen, wie Sneed sie nutzte, waren nicht offen zugänglich, sondern oft nur zu betreten nach ausführlichen Bewerbungsgesprächen mit sogenannten Moderatoren. Das waren ehrenamtliche Kontrolleure, die in erster Linie für die Einhaltung der Regeln und Codes der Spiele zuständig waren, es handelte sich zumeist um anale, oft auch noch arrogante, also eigentlich unerträgliche Nerds. In den per Chat oder Videokonferenz geführten Vorstellungsgesprächen musste Sneed eine solide Vorkenntnis der Regeln des Spiels an den Tag legen, ausreichendes Wissen über Gegenwart und Vergangenheit seriöser Rollenspiele im Allgemeinen belegen sowie, für Sneed am schwersten, ein feinfühliges, den Moderatoren angenehmes Urteil zu ewig kritischen Fragen der Nerdkultur abgeben („Letzte Frage: Warum muss Frodo mit dem Ring zu Fuß nach Mordor ziehen, statt dass Gandalf damit gleich zum Schicksalsberg fliegt auf dem Adler Gwaihir?“ *smirk*). Sneed – stoned, lonesome, Fantasy- und Sci-Fi-Romane verschlingend – war selbst unterdessen keineswegs der Auffassung vieler seiner Mitspieler, dass es höhere und niedere Ränge von gamern gebe, also sozusagen Plebs, die Massenware konsumierte, und Patrizier, die sich in elitären Welten raffinierten. Gamer waren, so sah er das, so oder so Verlierer, Betas wie er selbst. Er war bloß wirklich daran interessiert, in einem Spiel eine gute Geschichte erzählt zu bekommen und Mitspieler zu finden, die nicht dauernd aus der Rolle fielen wie jene Horden koreanischer Sechstklässler, die ihm in bekannteren Spielewelten als Elfen oder Magier verkörpert begegneten, ihn über ihre Headsets aber trotzdem dauernd nur stimmbrüchig als faggot bezeichneten. Eines Tages in diesem siebzehnten Lebensjahr also – die Premierministerin von Neuseeland hatte gerade die Schließung aller Schulen verkündet in der Hoffnung, die Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus ließe sich in ihrem Land in dieser Weise verlangsamen – hatte Sneed ein besonders mühsames Interview zu überstehen, in dessen Folge ihm zwei Moderatoren – beide waren ihm während des Austausches ausgesprochen unsympathisch geblieben – endlich Zugang zu einer sehr begehrten Fantasy-Welt gewährten, einem Elder-Scrolls-Mod, der von Ernst Jüngers „Marmorklippen“ inspiriert war und nach der Figur des Fürsten „Sunmyra“ genannt wurde. In diesem Spiel tobte ein Krieg zwischen den lichten, aquaphilen Bewohnern der Marina und den dunklen, urwüchsigen Mächten des Waldgelichters. Sneed, der Jüngers Buch nur von Wikipedia kannte, gestaltete seinen Avatar nach der Zusage als einen jungen Mönch, der sich mit Dampfmaschinen befasste, und nannte diese Figur Aloisius. Tagelang – er hatte ja Zeit – arbeitete Sneed an den Eigenschaften seines Mönchleins, verteilte vorsichtig dessen Fertigkeitspunkte, dachte genau über Herkunft, Art und Charakter seiner Figur nach, und nachdem deren Grundparameter von den Moderatoren gewährt und ins System eingepflegt worden waren, dämmerte endlich der Morgen, an dem er seinen Avatar erstmals durch die Weinberge entlang der Marina bewegen durfte. Als Aloisius also spawnte er in der Zelle einer ausgesprochen hübsch gestalteten Kartause und lief bald staunend durch die ihm noch fremde, liebevoll animierte Welt, geriet allerdings, er war zu diesem Zeitpunkt noch keine zehn Minuten in Sunmyra unterwegs, zufällig auf einen vor der Kartause, unter alten Weiden und mit Blick auf die Marina gelegenen Friedhof. Soeben fand dort eine Bestattung statt, denn einer der Erfinder der Sunmyra-Welt hatte wegen in real life entstandener Vaterpflichten beschließen müssen, seine zeitaufwendige Präsenz im Spiel zu beenden, seinen mächtigen Avatar sich also dramatisch suizidieren lassen. Nun waren die ältesten, engagiertesten Spieler des Spiels auf diesem virtuellen Friedhof versammelt, um „Donbardus dem Jäger“ das letzte, treue Geleit zu geben. Sneed aka Aloisius gesellte sich sehr unschuldig zur Gruppe der Trauernden. Er hielt sich bescheiden in der letzten Reihe der Gemeinde, beobachtete für eine Weile das dürftige Geschehen, bevor er sich endlich an die neben ihm stehende sexy Kriegerin „Noemia die Schmale“ wandte, um sie im Flüstermodus zu fragen, wessen Messe hier denn gerade gelesen werde – woraufhin Noemia furiengleich mit „Wer wagt es, solch schmählichen Frevel“ oder so ähnlich antwortete und in ein unvorhersehbares Wutgeheuel ausbrach, genau wie die übrigen Anwesenden auch, die diesen komischen Aloisius ja auch alle nicht kannten und sich ihre kriegerisch veranlagten Avatare ob des verstorbenen Anführers Donbardus sozusagen vor Schmerz rasend vorstellten. Alles empörte sich über die freche Unterbrechung der Zeremonie durch den fremden Neuling, dessen bodenlose Pietätlosigkeit, und nach einem ersten Rempler, auf den gleich ein zweiter, noch gröberer folgte, bereiteten sie dem Mönchlein Aloisius, mithin Sneed, enthemmt und durch wütende Prügel mit Knütteln und schweren Hämmern den schnellsten Garaus der Spielhistorie. Aloisius war damit aus „Sunymra“ gelöscht. Sneed, der gerade noch ein Köpfchen Haze geflutscht hatte, bevor er seine harmlose Frage langsam und mühsam in die verschwommene Tastatur eingegeben hatte, saß am heimischen Rechner und sah diesem brutalen Geschehen vollkommen hilflos und bestürzt zu. Sofort hatte er das Gefühl, dass es sich dabei um ein Verbrechen, einen niedrigen, xenophoben Akt handelte, bei dem die Alteingesessenen des Spiels den Neuankömmling aus Langeweile, aus abgeschmackter, bloß halb empfundener Emphase heraus über den Jordan geschickt hatten. Die Empörung darüber paarte sich in ihm mit dem kalt und sicher gefassten Entschluss zu grausiger Rache. Dem Entschluss lag letzten Endes natürlich nicht bloß die empfundene Ungerechtigkeit zugrunde, sondern es brach sich darin endlich der über Jahre genährte Hass auf die Nerds und sich selbst und die unglückliche Vernarrtheit in Haley seltsamste Bahn. Es wäre nun zu aufwendig, detailgetreue Auskunft über die Mühen zu geben, die Sneed sich in der Folge und zum Zweck der Rache machte, kurz zusammengefasst aber lässt sich Folgendes sagen: Über die folgenden fünf Jahre, in denen Sneed, nicht zuletzt wegen dieses Erlebnisses, endgültig die Freude an den Computerspielen verlor und sich stattdessen zunehmend dem echten Leben widmete – mithin die Schule erfolgreich abschloss, die Universität besuchte, Europa bereiste, trotz Krise einen Job als Assistent der Geschäftsführung bei PepsiCo Neuseeland landete, auch seine Gestalt zu akzeptieren lernte und seine Jungfräulichkeit loswurde, gar beschloss, dereinst ein großer Mann zu werden – über diese fünf Jahre fand er sich, nachdem er die Regeln von „Sunmyra“ bis ins letzte Detail studiert und sich unter falscher Identität abermals erfolgreich um Teilnahme beworben hatte, jeden Tag für mehrere Stunden in der Spielewelt ein, um als „Dandaldo der Wirt“ eine Schenke an der Marina zu eröffnen, die sich dank der gemütlichen Atmosphäre, der freundlichen Art des Wirtes und der zunehmend ausgezeichneten, weil die Avatare mit Potenz, Mana und Energie versorgenden Speisen und Getränke schnell zum absoluten place to be in Sunmyra entwickelte. Jeden Tag fanden sich dort „Noemia die Schmale“ und ihre mörderischen Kollegen, die Alten wie die Jungen, die Guten wie die Bösen ein, um einvernehmlich zu trinken und, ihre Rollen vorsichtig ablegend, friedlich über das echte Leben, über Beruf, Beziehung, „Gaming“ und Weltpolitik zu schnattern. Dandaldo unterdessen stand hinter dem Tresen, lächelte freundlich und polierte die Gläser. In mühseliger Klickarbeit ließ Sneed ihn unendliche Drinks und Gerichte mixen und kochen, wodurch Dandaldos experience in diesen obskuren und eher als Nebensache angelegten Entwicklungspfaden von „Sunmyra“ ins Unermessliche stieg, seine Figur in immer entlegenere Fertigkeitswelten gelangte, in denen sich bald auch nur noch Sneed allein auskannte. Tagsüber sah man Dandaldo über die Hügel entlang der Marina streichen, durch Wiesen und Dickichte, an den heiteren Bächlein entlang, wo er zur Jagd auf Hasen und Rehe ging und seltene Kräuter sammelte, selbst tief in den finsteren, gefährlichen Wäldern suchte er noch nach Flechten, Pilzen und Moosen, bevor er im Laden des Gemüsemannes die reguläreren Zutaten für seine Kunst erstand. Abends servierte er das Erjagte, Gefundene, Gekaufte in herrlicher Zubereitung. Des Nachts dann aber, nach Ladenschluss, sperrte Dandaldo seine Schenke ab, stieg in deren Keller hinab und braute dort, von allen unbeobachtet, Gift. Das Gift, das Sneed alias Dandaldo zubereitete, nannte sich „Dolor Aeternitatem“, hatte, als einzige Substanz von „Sunmyra“, die Wirksamkeitsstufe 7, war mithin in ausreichender Konzentration zwingend letal, allerdings auch nur von den wenigsten Figuren und lediglich in winzigen Dosen produzierbar. Sneed verbrachte zahllose Stunden seines echten Lebens damit, Dandaldo in einem geheimen Raum unterhalb der Schenke ein Fass mit diesem Gift füllen zu lassen. Das Giftkochen bestand in einer elend komplizierten Folge von Klicks und Tastatureingaben, die fehlerfrei bleiben musste und sich nicht umgehen ließ, die Sneed daher auch schrecklich langweilte und ihn zugleich immer tiefer in sein Geheimnis hinabtauchen ließ. Denn den Wahnsinn dieser Zeitverschwendung, den Irrsinn dieses Aktes, dessen zunehmende Isoliertheit innerhalb der restlichen Tätigkeiten seines Lebens, auch die Nichtigkeit des Anlasses, all das hätte er niemandem erklären können, verstand er es doch selbst schon längst nicht mehr. Womit wir endlich wieder in der Gegenwart angelangt wären. Also. Peter, unsere Hauptperson, ist gerade in sein Auto gestiegen. Und Sneed, Sneed geht nun auch nach Hause, fährt dort seinen Rechner hoch, setzt sich die Holos auf die Augen und macht sich daran, heute, ausgerechnet an diesem Tag, den lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen und die Welt Sunmyra zu schleifen. Es ist eigenartig, wie viel Freude ihm das am Ende dann doch bereiten wird, hatte er vorher doch eher mit einem schalen Gefühl gerechnet, denn man muss bedenken, dass fünf Jahre intensiver Vorbereitung für diese kleine, letztlich sehr private Performance schon eher reichlich sind, und gerade wenn man wie Sneed innerlich schon eine gewisse Distanz zu solchen Spielewelten aufgebaut hat, droht der return on investment schmal auszufallen. Sneed hat eigentlich sogar Angst, sich am Ende selbst nur wieder neuerlich dafür verachten zu müssen, dass er für diese blöde Sache so viel Zeit in die Hand genommen hat. Aber es kommt ganz anders. Stanley Sneed hat sich diesen spezifischen Tag für seine Aktion ausgewählt, weil in Sunmyra Fasching gefeiert wird, der Höhepunkt des Kalenderjahres der Spielewelt. Zu solchen Festen muss sich, bei Strafe des Ausschlusses, wirklich jeder Spieler einloggen. Die Avatare werden in bunte Farben verkleidet, ziehen durch die feiernden, fackelbeleuchteten Straßen, die Spieler zischen vor dem heimischen Rechner dabei wohl auch selbst das ein oder andere Bier. Als Sneed aka Dandaldo seine Schänke aufsperrt, stehen die Avatare schon Schlange, im Handumdrehen ist die Klause rappelvoll, und da, im Gewimmel, sieht er auch Noemia die Schmale in knappestem Outfit, umgeben von ihrer Crew, den absoluten Freaks, die ihr ganzes Leben Sunmyra widmen. Sieht sie zwischen all den anderen Spielern, die Sneed, der ihrem privaten Geseier als Dandaldo über Jahre zuhören musste, kaum weniger hasst. Als sich die Festivitäten gegen Mitternacht ihrem Höhepunkt nähern, steigt er in den Keller und kippt das teure Fässchen mit dem geruchs- und geschmacksneutralen Gift in einen großen Trog Honigmet. Den schleppt er hoch in die Schenke, stellt sich auf den Tresen und ruft über den Lärm hinweg in CAPS: „Eine Runde aufs Haus, von Dandaldo für Sunmyra!“ „Ein Hoch auf Dandaldo!“, schallt es zurück, und ausgerechnet von Noemia angeführt drängt sich die ganze Kneipe, in der, schätzt Sneed, gerade wohl wirklich alle Spieler von Sunmyra versammelt sind, um seinen Tresen, und einem nach dem anderen reicht er einen Becher giftigsten Mets. Das Gift braucht etwa fünfzehn Minuten, bevor es zu wirken beginnt, und etwa eine halbe Stunde, um zu töten. Dandaldo hat kaum alle versorgt, da bricht schon der erste Avatar in einer Ecke der Schenke zuckend zusammen. „Was ist los?“, will sein Besitzer im public-chat-Modus wissen, da ereilt es neben ihm den nächsten, und dann schon den nächsten, und siehe, bald liegen die meisten Avatare auf dem Boden, und die Reihe ist nun an Noemia, auch sie rollt sich auf der Erde mit schäumendem Mund. „Was geschieht mit uns?“, schreien die Spieler durcheinander. „Wir sind vergiftet!“, ahnen einige, „Fuuuuuuuuckkk“ schreiben sehr viele, „Dandaldo!“, ächzen wenige korrekt. Panik ist ausgebrochen. Dandaldo aber hält sich versteckt, bis die ganze Kneipe handlungsunfähig und moribund ist, dann endlich steht er auf, klettert abermals auf den Tresen, um von dort zu verkünden, wer er in Wahrheit sei, ein Wiedergänger des unschuldig getöteten Mönchleins Aloisius nämlich, und dies sei seine Rache, alle würden nun sterben durch Dolor Aeternitatem, Sunmyra müsse untergehen, und dann fällt Sneed aus der Rolle und schreibt nur noch unflätigst und lachend Quatsch in die Tastatur, während die Sterbenden unter ihm hysterisch schreien und weinen, um Gegengift betteln, wildeste Flüche ausstoßen und vergeblich irgendwelche Heiltränke kippen. Viele der Spieler lieben ihre Avatare wie eigene Kinder, der fette Lette, dem Noemia die Schmale gehört, fühlt sich im Grunde halb mit der verheiratet, für ihn ist das, was ihm hier an diesem Abend widerfährt, ganz so, als müsste er seiner Geliebten beim Krepieren zuschauen, eine existenzielle Katastrophe, die er nie wirklich verwinden wird, zumal er überhaupt keine Erinnerung mehr hat an die Episode mit Aloisius, also gar nicht weiß, wofür er hier so plötzlich so drakonisch bestraft wird. Sneed, alleine vor seinem Rechner in Neuseeland, fühlt unterdessen, wie sich eine goldene Freude in ihm ausbreitet. Er weiß, dass er gerade etwas Schreckliches getan hat, er weiß aber auch, dass er gerade etwas total Egales getan hat, denn was, let’s get real, sind schon diese albernen virtuellen Figuren. Bald zucken die Avatare in der Schenke nicht mehr. Sie beginnen, transparent und geisterhaft auszuschauen, sie liegen still, sie sind tot. Sneed öffnet nun alle Foren und Chats, in denen es um Sunmyra geht, und wird Zeuge vollkommen entfesselter Austäusche. Er macht Screenshots von jeder Morddrohung, die gegen den User hinter Aloisius und Dandaldo ausgesprochen wird, er raucht endlich einen großen Joint und freut sich über jede Zeile Hass. Später wird er zu einer Legende werden in der obskuren Welt der Gamer-Foren. Videomitschnitte seiner Tat werden auf YouTube hochgeladen, denn was in Sunmyra geschehen ist, bleibt ohnegleichen. An einem einzigen Abend eine ganze Welt von einem einzigen User ausradiert, sodass schon kurz danach die Server runtergefahren werden, weil keiner jemals je wieder Sunmyra spielen will. Die meisten ähnlichen Rollenspielwelten bauen in der Folge einen „AD“-Passus in ihr Regelwerk ein, „Against Dandaldoing“, was bedeutet, dass ein solcher Giftanschlag von den Moderatoren im Bedarfsfall per Intervention in den Code selbst unterbrochen werden darf. Was diesen Welten allerdings natürlich einen Reiz nimmt, von dem zuvor niemand geahnt hatte, dass es ihn geben könnte, den Reiz der steten, leisen Angst vor dem jähen, unvorhersehbaren Ende durch eine geheime Schicksalsmacht nämlich. Dabei lässt dieser Reiz ja vielleicht nicht nur die virtuellen Erlebniswelten intensiver erscheinen. Seht also jedenfalls: Dort schleicht Stan Sneed, Angestellter von PepsiCo, Assistent des Gene Jeffries, Bewohner Neuseelands und heimlicher Killer von Sunmyra, und kein Mensch sieht es ihm an, und niemand weiß es, und doch ist er einer von uns, unter uns.
Alard von Kittlitz gewinnt mit „Sonder“ den Deutschen Popliteraturpreis für Magic, Pop und Ewigkeit
Am 15. Mai 2022 vergab das Literaturhaus Augsburg erstmals den Deutschen Popliteraturpreis für Magic, Pop und Ewigkeit an Alard von Kittlitz, der mit seinem Roman "Sonder" (Piper) angetreten ist. Die Jury bestand aus Polina Lapkovskaja, Alexa Hennig von Lange (abwesend), Eckhart Nickel, Dr. Stefan Bronner (LithausAUX), Katrin Montiegel (LithausAUX) und Dr. Franziska Diller (LithausAUX).
Im Finale um den Preis standen außerdem Anaïs Meier mit ihrem Debüt „Mit einem Fuss draussen" und Mithu Sanyal mit „Identitti". Der Preis ist mit 3000€ dotiert, soll aber in der Zukunft weiter aufgestockt werden. Er wird alle zwei Jahre in Augsburg verliehen.


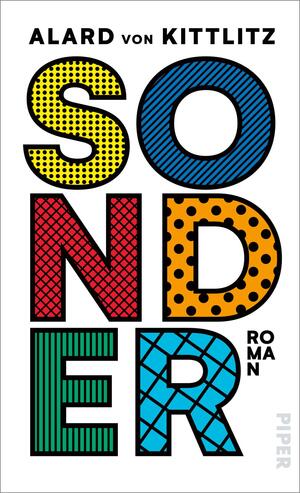
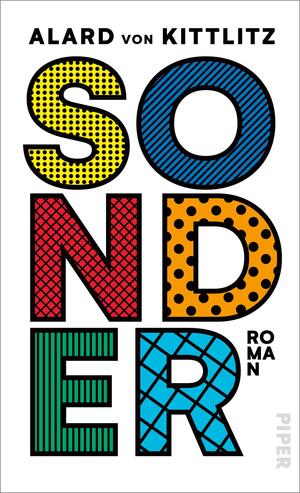




Kommentare
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.