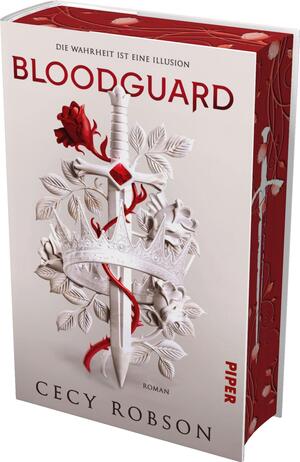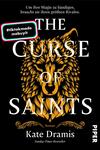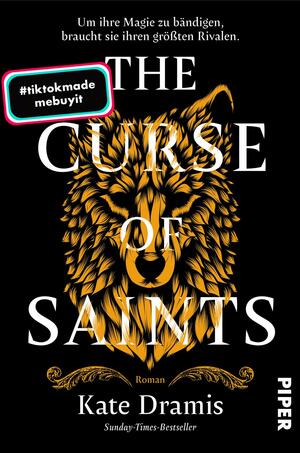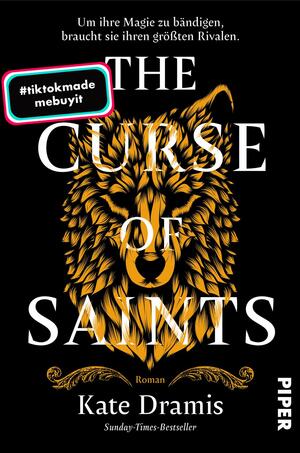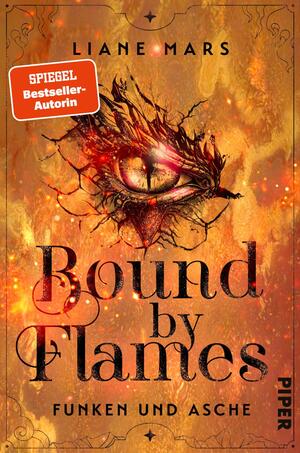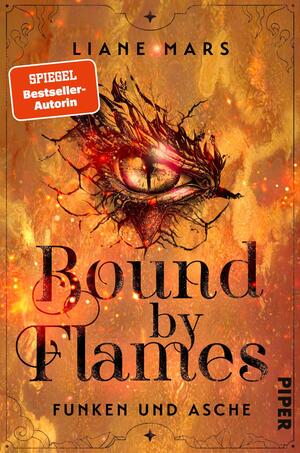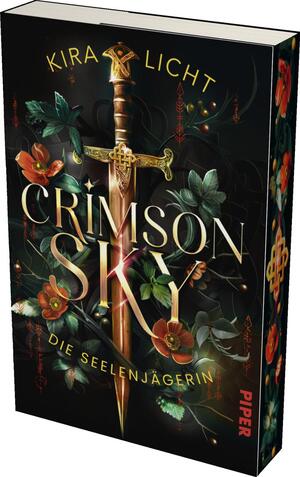1
Lara
Lara stützte die Ellbogen auf die niedrige Sandsteinmauer, den Blick starr auf die glühende Sonne gerichtet, die sich auf die fernen Berggipfel herabsenkte. Dazwischen gab es nichts als brennend heiße Sanddünen, Skorpione und gelegentlich eine Eidechse. Die Wüste war für niemanden passierbar, der nicht über ein gutes Kamel, die richtigen Vorräte und eine gehörige Portion Glück verfügte.
Nicht, dass sie nicht mehr als einmal in Versuchung gewesen wäre, ihr Glück dort auf die Probe zu stellen.
Ein Gong ertönte, und die Echos hallten über das Gelände. Dieser Gong hatte sie während der vergangenen fünfzehn Jahre jeden Abend zum Essen gerufen, doch heute hallte er in ihr nach wie eine Kriegstrommel. Lara holte tief Luft, dann drehte sie sich um und stolzierte über den Trainingsplatz auf die turmhohen Palmen zu. Ihr roséfarbener Rock umspielte ihre Beine. Ihre elf Halbschwestern sammelten sich ebenfalls auf dem Platz, eine jede in einem anderen Gewand, die Farbe sorgfältig von ihrer Lehrmeisterin für Ästhetik ausgewählt, um die Gesichtszüge der Mädchen vorteilhaft zur Geltung zu bringen.
Lara verabscheute die Farbe Rosa, aber niemand hatte sie nach ihrer Meinung gefragt.
Nach fünfzehn Jahren Gefangenschaft auf dem Gelände würden die Schwestern heute den letzten gemeinsamen Abend hier verbringen. Ihr Lehrmeister für Meditation hatte ihnen befohlen, die Stunde vor dem Abendessen an einem Lieblingsort zu verbringen und über all das nachzusinnen, das sie gelernt hatten, und auch über alles, das sie mit den ihnen gegebenen Mitteln erreichen würden.
Oder zumindest, was eine von ihnen erreichen würde.
Der Duft der Oase wehte als schwache Brise zu Lara herüber. Der Geruch von Früchten und grünen Blättern, vom Holzkohlenfeuer, über dem Fleisch garte, und vor allem von Wasser. Kostbarem, kostbarem Wasser. Das Gelände befand sich über einer der wenigen Quellen mitten in der Roten Wüste, aber fernab von allen Karawanen-Routen. Isoliert. Verborgen.
Genau so, wie ihr Vater, der König von Maridrina, es wollte. Und nach dem, was man Lara über ihn erzählt hatte, war er ein Mann, der immer bekam, was er wollte, auf die eine oder andere Weise.
Am Rand des Trainingsplatzes hielt Lara inne, strich sich mit den Fußsohlen über die Waden und wischte den Sand ab, bevor sie in zierliche, hochhackige Sandalen schlüpfte, ihr Gleichgewicht blieb so unerschütterlich, als trüge sie Kampfstiefel.
Klack, klack, klack. Ihre Absätze ahmten den hektischen Schlag ihres Herzens nach, als sie den mit Mosaiksteinchen bedeckten Weg entlangschritt und eine kleine Brücke überquerte. Der sanfte Klang der Saiteninstrumente erhob sich über das Gurgeln eines Wasserlaufs. Die Musikanten waren mit dem Gefolge ihres Vaters eingetroffen, um bei den Festlichkeiten des heutigen Abends für Unterhaltung zu sorgen. Lara zweifelte daran, dass für sie auch die Rückreise eingeplant war.
Eine Schweißperle rann ihr die Wirbelsäule hinunter, und der Riemen, in dem an der Innenseite ihres Oberschenkels ein Messer steckte, war bereits feucht. Du wirst heute Nacht nicht sterben, sang sie lautlos vor sich hin. Nicht heute Nacht.
Lara und ihre Schwestern trafen sich in der Mitte der Oase, einem von der Quelle eingerahmten Innenhof, der durch das Wasser ringsum einer grünen Insel glich. Sie gingen zu dem riesigen, mit Seide verhüllten Tisch, der schwer mit Tafelsilber beladen war, das für das hinter den Vorhängen bereits bereitstehende Dinner aus mehreren Gängen von Nöten war. Diener, die allesamt stumm waren, warteten hinter den dreizehn Stühlen und schauten starr auf ihre Füße. Als die Frauen sich näherten, zogen die Diener die Stühle zurück, und Lara setzte sich, ohne hinzusehen, denn sie wusste, dass das roséfarbene Kissen unter ihr liegen würde.
Keine der Schwestern sagte etwas.
Eine Hand griff unter dem Tisch nach ihrer. Lara gestattete ihrem Blick, nach links abzuirren, und sah flüchtig in Sarhinas Augen, bevor sie sich wieder ihrem Teller zuwandte. Alle zwölf Mädchen waren Töchter des Königs, jetzt zwanzig Jahre alt, und eine jede von ihnen geboren von einer anderen seiner Ehefrauen. Lara und ihre Halbschwestern waren an diesen geheimen Ort gebracht worden, um ein Training zu absolvieren, das noch keinem maridrinischen Mädchen je zuvor zuteilgeworden war. Ein Training, das jetzt seinen Abschluss fand.
Laras Magen revoltierte, und sie ließ Sarhinas Hand los, denn als sie die Haut der Schwester spürte, die ihr am nächsten war, kühl und trocken im Gegensatz zu ihrer eigenen, hätte sie sich am liebsten übergeben.
Wieder ertönte der Gong, und die Musikanten verstummten, als die Mädchen sich erhoben. Einen Herzschlag später erschien ihr Vater, dessen silbernes Haar im Lampenlicht glänzte, als er über den Pfad auf sie zukam. Seine azurfarbenen Augen waren identisch mit denen eines jeden anwesenden Mädchens. Obwohl Schweiß in kleinen Bächen an Laras Beinen hinabrann, war sie gut genug ausgebildet, um jedes Detail in sich aufzunehmen. Das Indigoblau seines Mantels. Das abgetretene Leder seiner Stiefel. Das um seine Taille gegürtete Schwert. Und als er sich umdrehte und um den Tisch herumging, sah sie ganz schwach die Umrisse einer Klinge, die an seiner Wirbelsäule versteckt war.
Sobald er Platz genommen hatte, folgten Lara und ihre Schwestern seinem Beispiel, und keine von ihnen gab auch nur den geringsten Laut von sich.
„Meine Töchter.“ Silas Veliant, der König von Maridrina, lehnte sich lächelnd auf seinem Stuhl zurück, wartete darauf, dass sein Vorkoster ihm zunickte, und nahm dann einen großen Schluck Wein. Sie alle ahmten die Bewegung nach, aber Lara schmeckte die dunkelrote Flüssigkeit kaum, als sie ihr über die Zunge glitt.
„Ihr seid mein kostbarster Besitz“, begann er und schwenkte leicht das Glas, um sie alle einzuschließen. „Von meinen zwanzig Abkömmlingen, die hierhergebracht worden sind, habt nur ihr überlebt. Dass ihr das geschafft habt, dass ihr aufgeblüht seid, ist eine beachtliche Leistung, denn das Training, das ihr absolviert habt, hätte selbst die besten Männer auf eine harte Probe gestellt. Und ihr seid keine Männer.“
Nur dieses Training hielt Lara davon ab, die Augen zusammenzukneifen. Hielt sie davon ab, überhaupt irgendeine Regung preiszugeben.
„Man hat euch alle hergebracht, damit ich entscheiden kann, welche von euch die Beste ist. Welche von euch mein Messer in der Dunkelheit sein wird. Welche von euch Königin von Ithicana werden wird.“ Seine Augen verströmten das ganze Mitgefühl eines Skorpions in der Wüste. „Welche von euch Ithicanas Verteidigung wirkungslos machen und es Maridrina auf diese Weise ermöglichen wird, zu seiner früheren Pracht zurückzufinden.“
Lara nickte knapp, und all ihre Schwestern taten das Gleiche. Niemand war besonders gespannt. Zumindest nicht, was die Wahl ihres Vaters betraf. Die Entscheidung war schon vor Tagen gefallen. Marylyn saß am gegenüberliegenden Ende des Tisches, ihr goldenes Haar lag wie eine geflochtene Krone um ihren Kopf, ihr Kleid dazu passend aus mit Goldfäden durchwirkter Seide. Marylyn war die naheliegende Wahl gewesen, brillant, anmutig, schön wie der Sonnenaufgang – und auch so verlockend wie der Sonnenuntergang.
Nein, sie warteten darauf, was als Nächstes kommen würde. Die Wahl, welche von ihnen dem Kronprinzen – inzwischen König – von Ithicana als Braut angeboten werden sollte, war getroffen. Bisher unbekannt war, was aus dem Rest von ihnen werden würde. Sie waren alle von königlichem Geblüt, was bedeutete, dass sie einigen Wert hatten.
Alle Schwestern, Marylyn eingeschlossen, hatten sich in den beiden letzten Nächten auf einem Stapel Kissen zusammengefunden, und eine jede von ihnen hatte Spekulationen über ihr aller Schicksal angestellt. Welchen der Wesire des Königs sie vielleicht ehelichen würden. Welchen anderen reichen Männern sie vielleicht als Bräute angeboten würden. Weder der Mann noch das Königreich spielten dabei eine Rolle. Das Einzige, das jedes Mädchen interessierte, war das Ende ihrer Gefangenschaft an diesem Ort.
Aber in all diesen langen Nächten hatte Lara am Rand der Gruppe gelegen, selbst nichts beigesteuert und die Zeit genutzt, um ihre Schwestern zu beobachten. Um sie zu lieben. Sich daran zu erinnern, wie sie gegen jede von ihnen gekämpft hatte und wie sie sie genauso oft innig umarmt hatte. Ihr Lächeln. Ihre Augen. Die Art, wie sie sich – selbst nachdem ihre Kindheit vorüber war – aneinandergekuschelt hatten wie frisch von ihrer Mutter getrennte Welpen.
Denn Lara wusste etwas, das die anderen nicht wussten: dass ihr Vater beabsichtigte, nur einer Schwester zu erlauben, das Gelände zu verlassen. Und das würde die künftige Königin von Ithicana sein.
Ein mit Käse und leuchtend bunten Früchten verzierter Salat wurde vor sie hingestellt, und Lara begann mechanisch, zu essen. Du wirst leben, du wirst leben, du wirst leben, betete sie sich im Geiste immer wieder vor.
„Seit Menschengedenken hält Ithicana den Handel fest im Griff und erschafft und zerstört Königreiche wie ein dunkler Gott.“ Ihr Vater richtete das Wort an sie alle, und seine Augen loderten hell. „Mein Vater und dessen Vater und dessen Vater vor ihm haben alle danach getrachtet, das Bridge Kingdom in die Knie zu zwingen. Mit Meuchlern, mit Kriegen, mit Blockaden, mit jedem ihnen zur Verfügung stehenden Mittel. Aber kein Einziger von ihnen ist auf die Idee gekommen, eine Frau zu benutzen.“ Er lächelte hinterhältig. „Maridrinische Frauen sind sanft. Sie sind schwach. Sie sind zu nichts anderem gut, als einen Haushalt zu führen und Kinder großzuziehen. Das gilt für alle bis auf euch zwölf.“
Lara zuckte mit keiner Wimper. Keine ihrer Schwestern tat das, und sie fragte sich einen Atemzug lang, ob ihm bewusst war, dass jede Einzelne von ihnen darüber nachsann, ihm wegen seiner beleidigenden Worte einen Dolch ins Herz zu stoßen. Er sollte nur zu gut wissen, dass jede von ihnen dazu in der Lage gewesen wäre.
„Vor fünfzehn Jahren“, fuhr ihr Vater fort, „hat der König von Ithicana eine Braut für seinen Sohn und Thronfolger als Tribut gefordert. Als Bezahlung.“ Er verzog höhnisch die Lippen. „Der Bastard ist inzwischen seit einem Jahr tot, und sein Sohn hat jetzt eingefordert, was ihm zusteht. Und Maridrina ist bereit.“ Er richtete den Blick auf Marylyn, dann auf die Diener, die daraufhin vortraten, um die Salatteller abzuräumen.
Die Nacht brach herein, und Lara nahm in den immer länger werdenden Schatten eine Bewegung wahr. Sie spürte die Anwesenheit der vielen Soldaten, die ihr Vater mitgebracht hatte. Die Diener tauchten mit dampfenden Suppenschalen wieder auf, und der Duft von Zimt und Lauch begleitete sie.
„Ithicanas Habgier, seine Selbstüberschätzung und seine Verachtung für euch wird sein Untergang sein.“
Lara gestattete es sich, den Blick vom Gesicht ihres Vaters abzuwenden und ihre Schwestern eine nach der anderen zu betrachten. Trotz ihres Trainings, trotz ihrer Kenntnisse seiner Pläne hatte er nie beabsichtigt, auch nur eine einzige von ihnen – abgesehen von seiner Auserwählten – nach diesem Essen länger als eine Stunde am Leben zu lassen.
Die Suppenteller wurden vor sie hingestellt, und jede einzelne der Schwestern wartete darauf, dass der Vorkoster ihres Vaters den ersten Schluck nahm und nickte. Dann griffen sie nach ihren Löffeln und begannen pflichtschuldigst, zu essen.
Lara tat das Gleiche.
Ihr Vater glaubte, dass Brillanz und Schönheit die wichtigsten Attribute der Tochter sein müssten, die er auswählte. Dass sie das Mädchen sein müsste, das den schärfsten Sinn für Kampf und Strategie gezeigt hatte. Das Mädchen, das in den Künsten des Schlafzimmers das größte Talent gezeigt hatte. Er hatte geglaubt, zu wissen, welche Eigenschaften die wichtigsten seien – aber eine hatte er vergessen.
Sarhina, die neben ihr saß, versteifte sich.
Es tut mir leid, flüsterte Lara ihren Schwestern stumm zu.
Dann wandte Sarhina sich plötzlich in Krämpfen.
Ich bete, dass ihr alle die Freiheit finden werdet, die ihr verdient.
Der Suppenlöffel in Sarhinas Hand flog über den Tisch, aber keins der anderen Mädchen bemerkte es. Keine von ihnen scherte sich darum, denn sie alle würgten, und Schaum quoll ihnen über die Lippen, während sie zuckten und keuchten und nacheinander vorwärts oder rückwärts oder zur Seite kippten. Dann hörten sie alle auf, sich zu bewegen.
Lara legte ihren Löffel neben die leere Suppenschale und schaute zu Marylyn hinüber, die mit dem Gesicht nach unten in ihrem Teller lag. Nachdem Lara sich erhoben hatte, umrundete sie den Tisch, hob den Kopf ihrer Schwester aus dem Geschirr und wischte ihr behutsam die Suppe vom Gesicht, bevor sie Marylyns Wange auf den Tisch legte. Als Lara das nächste Mal aufsah, hatte sich ihr Vater erhoben und sein Schwert halb gezückt. Er war blass geworden. Die Soldaten, die hinter den Vorhängen herumgelungert hatten, kamen herbeigeeilt und trieben die panischen Diener zusammen. Aber jeder, wirklich jeder starrte Lara an.
„Ihr habt die falsche Wahl getroffen, Vater.“ Lara richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, als sie das Wort an ihren König wandte. Sie sah ihn durchdringend an und gestattete nun auch dem dunklen, gierigen und selbstsüchtigen Teil ihrer Seele, sich zu zeigen. „Ich werde die nächste Königin von Ithicana sein. Und ich werde das Bridge Kingdom in die Knie zwingen.“
2
Lara
Lara hatte gewusst, was als Nächstes kommen würde, aber es ging alles sehr schnell. Und doch war sie sich ziemlich sicher, dass sich jedes Detail bis zum Tag ihres Todes in ihren Geist eingebrannt hatte. Ihr Vater stieß das Schwert zurück in die Scheide, dann beugte er sich vor, um dem Mädchen, das ihm am nächsten saß, die Finger gegen die Kehle zu drücken, wo er sie einige Momente verharren ließ, während Lara das Geschehen leidenschaftslos beobachtete. Dann nickte er den Soldaten um sie herum einmal knapp zu.
Die Männer, deren Aufgabe es gewesen wäre, Lara und ihre Schwestern zu töten, richteten ihre Schwerter stattdessen gegen die Diener, deren zungenlose Münder sich zu stummen Schreien verzogen, während sie versuchten, dem Massaker zu entkommen. Die Musikanten wurden niedergemetzelt, genau wie die Köche in den abgelegenen Küchen und die Hausmädchen, die die Laken auf den Betten aufgeschlagen hatten, in denen nie wieder jemand schlafen würde. Schon bald blieben nur dem König treu ergebene Soldaten übrig, deren Hände vom Blut ihrer Opfer bedeckt waren.
Während all dessen verharrte Lara regungslos. Nur das Wissen, dass sie die einzige verbliebene Tochter war – dass sie das letzte Pferd war, das noch übrig war, um Wetten darauf abzuschließen –, hinderte sie daran, sich aus dem Gemetzel freizukämpfen und in die Wüste zu fliehen.
Erik, der Waffenmeister, trat mit gezogener Klinge zwischen den Palmen hervor. Sein Blick wanderte von Lara zu den reglosen Gestalten ihrer Schwestern, und er schenkte ihr ein trauriges Lächeln. „Es erstaunt mich nicht, dass du noch stehst, kleine Kakerlake.“
Es war ein Spitzname, den er ihr verliehen hatte, als sie hier angekommen war, fünf Jahre alt und mehr tot als lebendig nach dem Sandsturm, der ihre Reisegruppe auf ihrem Marsch durch die Wüste überrascht hatte. „Eis und Feuer mögen die Welt verwüsten, aber die Kakerlake überlebt“, hatte er gesagt. „Genau wie du.“
Sie mochte eine Kakerlake sein, aber dass sie noch immer atmete, verdankte sie ihm. Erik hatte sie vor zwei Tagen spätabends als Strafe für eine minderschwere Missetat auf den Trainingshof geschickt, und sie hatte Mitglieder der Truppe ihres Vaters dabei belauscht, wie sie Pläne für ihren Tod und den ihrer Schwestern geschmiedet hatten. Ein Gespräch, das Erik selbst geleitet hatte. Ihre Augen brannten, als sie ihn musterte – den Mann, der ihr weit mehr ein Vater gewesen war als der silberhaarige Monarch zu ihrer Rechten –, aber sie sagte nichts und schenkte ihm nicht einmal ein Lächeln als Antwort.
„Ist es erledigt?“, fragte ihr Vater.
Erik nickte. „Wir haben alle zum Schweigen gebracht, Eure Majestät. Bis auf mich selbst.“ Dann flackerte sein Blick zu den Schatten, die von den Lampen auf den Tischen nicht erhellt wurden. „Und die Elster.“
Aus diesen Schatten heraus trat nun ihr Intrigenmeister, und Lara beobachtete kühl den dünnen Mann, der jeden Aspekt des Abends dirigiert hatte.
Und die Elster sagte mit der nasalen Stimme, die Lara immer verabscheut hatte: „Das Mädchen hat euch den größten Teil der Schmutzarbeit abgenommen.“
„Lara hätte von Anfang an Eure erste Wahl sein sollen.“ Eriks Stimme war tonlos, aber Trauer erfüllte seine Augen, als er die zusammengesunkenen Mädchen betrachtete, bevor er wieder zu Lara schaute.
Lara wollte nach ihrem Messer greifen – wie konnte er es wagen, um ihre Schwestern zu trauern, wenn er nichts unternommen hatte, um sie zu retten –, aber Tausende Stunden Training befahlen ihr, sich nicht zu bewegen.
Erik machte eine tiefe Verbeugung vor seinem König. „Für Maridrina.“ Dann zog er sich sein Messer über die Kehle.
Lara biss die Zähne zusammen, denn ihr stieg der Inhalt ihres Magens hoch, bitter und widerlich und voll von dem gleichen Gift, das sie ihren Schwestern verabreicht hatte. Doch sie schaute nicht weg, sondern zwang sich, dabei zuzusehen, wie Erik zu Boden sackte. Das Blut floss ihm noch immer in großem Schwall aus der Kehle, bis sein Herz zu schlagen aufhörte.
Die Elster ging um die Blutlache herum und trat vollends ins Licht. „Wie dramatisch.“
Die Elster war natürlich nicht sein richtiger Name. Er hieß Serin, und von allen Männern und Frauen, von denen die Schwestern im Laufe der Jahre ausgebildet wurden, war er der Einzige, der nach eigenem Belieben das Gelände betreten und verlassen hatte. Der Mann, der das Netzwerk von Spionen und Ränken des Königs verwaltete.
„Er war ein guter Mann. Ein treuer Untertan.“ Die Stimme ihres Vaters war ohne jedwede Betonung, und Lara fragte sich, ob er die Worte ehrlich meinte oder ob er sie um der Soldaten willen sprach, die das Geschehen verfolgten. Selbst die entschlossenste Loyalität hatte ihre Grenzen, und ihr Vater war kein Narr.
Die Elster richtete seine schmalen Augen auf Lara. „Eure Majestät, Lara war, wie Ihr wisst, nicht meine erste Wahl. Ihre Leistungen waren in fast allen Bereichen ziemlich schlecht, mit der einzigen Ausnahme der Kampfdisziplin. Ihr Temperament gewinnt fortwährend die Oberhand. Marylyn“ – er deutete auf Laras Schwester – „war die naheliegende Wahl. Brillant und schön. Meisterhaft darin, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, wie sie es in den vergangenen Tagen deutlich demonstriert hat.“ Er stieß einen angewiderten Laut aus.
Alles, was er über Marylyn sagte, entsprach der Wahrheit, aber es war nicht das, was ihre Schwester wirklich ausmachte. Ungebeten fluteten Erinnerungen Laras Geist. Bilder von Marylyn, wie sie behutsam ein von der Mutter verstoßenes Kätzchen pflegte, das jetzt die fetteste Katze auf dem Gelände war. Oder wie sie sich leise alle Kümmernisse ihrer Schwestern angehört und ihnen dann den perfektesten Rat gegeben hatte. Oder wie sie allen Dienern als Kind Namen gegeben hatte, weil sie es grausam fand, dass sie keine besitzen durften. Dann klärten sich die Erinnerungen, und zurück blieb nur der reglose Körper ihrer Schwester und goldenes, von Suppe verkrustetes Haar.
„Meine Schwester war zu gütig.“ Lara drehte den Kopf wieder zu ihrem Vater, und das Herz flatterte ihr in der Brust, obwohl sie ihn herausforderte. „Die zukünftige Königin von Ithicana muss den Herrscher des Landes verführen. Ihn glauben machen, sie sei arglos und aufrichtig. Sie muss ihn dazu bringen, ihr zu vertrauen, während sie ihre Position ausnutzt, um bis zu dem Moment, in dem sie ihn verrät, jede seiner Schwächen herausgefunden zu haben. Marylyn war nicht diese Frau.“
Ihr Vater musterte sie, ohne mit der Wimper zu zucken, und stimmte ihr mit einem kaum merklichen Nicken zu. „Aber du bist es?“
„Ja.“ Ihr Puls brüllte in ihren Ohren, ihre Haut klebrig trotz der Hitze.
„Ihr irrt euch nicht oft, Serin“, sagte ihr Vater. „Aber in diesem Fall glaube ich, dass Ihr auf dem falschen Weg wart und dass das Schicksal eingegriffen hat, um diesen Fehler zu beheben.“
Der Intrigenmeister versteifte sich, und Lara fragte sich, ob er jetzt begriff, dass sein Leben an einem seidenen Faden hing. „Wie Ihr meint, Majestät. Anscheinend besitzt Lara eine Eigenschaft, die ich bei meinen Prüfungen nicht bedacht habe.“
„Die wichtigste Eigenschaft von allen: Skrupellosigkeit.“ Der König musterte sie einen Moment lang, dann drehte er sich wieder zu der Elster um. „Macht die Karawane bereit. Wir brechen noch heute Abend nach Ithicana auf.“ Dann lächelte er sie an, als sei sie unendlich kostbar. „Es wird Zeit, dass meine Tochter ihren künftigen Gemahl kennenlernt.“
3
Lara
Flammen züngelten am Nachthimmel, als sie losritten, aber Lara riskierte nur einen einzigen Blick zurück auf das brennende Gelände, das ihr Zuhause gewesen war, auf die blutbespritzten Böden und die Wände, die immer schwärzer wurden, während das Feuer alle Beweise der Verschwörung verschlang, die seit mehr als fünfzehn Jahren geplant wurde. Einzig das Herz der Oase, wo der von der Quelle umflossene Tisch stand, würde unberührt bleiben.
Es war immer noch fast mehr, als sie ertragen konnte, ihre schlummernden Schwestern umringt von Feuer zurückzulassen, ohnmächtig und hilflos, bis das Betäubungsmittel, das sie ihnen verabreicht hatte, seine Wirkung verlor. Schon jetzt sollte sich ihr Puls, der für eine gefährlich lange Zeit bis fast zum Tod verlangsamt worden war, beschleunigen, und jeder, der genau hinschaute, würde erkennen, dass sie nach wie vor atmeten. Wenn Lara Ausreden vorgeschützt hätte, um noch länger hierzubleiben und sich davon zu überzeugen, dass sie außer Gefahr waren, hätte sie lediglich riskiert, aufzufliegen, und dann wäre ihr ganzer Einsatz vergebens gewesen.
„Verbrennt sie nicht. Lasst sie für die Aasfresser liegen, die ihnen die Knochen sauber abnagen werden“, hatte sie ihrem Vater geraten, und ihr Magen hatte sich zusammengekrampft, bis er gelacht und ihrer makabren Bitte zugestimmt hatte. Ihre Schwestern waren zusammengesunken auf dem Tisch zurückgelassen worden, während die abgeschlachteten Diener einen blutigen Kreis um sie herum bildeten.
Das war es, wo ihre Schwestern erwachen würden: umgeben von Feuer und Tod. Denn nur wenn ihr Vater glaubte, dass sie zum Schweigen gebracht worden waren, hatten sie auch nur die geringste Chance auf eine Zukunft. Lara würde ihre Mission fortführen, während ihre Schwestern sich ihr eigenes Leben aufbauten – frei, um Herrscherinnen über ihr eigenes Schicksal zu sein. All das hatte sie in dem Brief erklärt, den sie Sarhina in die Tasche geschoben hatte, während ihr Vater den Befehl gegeben hatte, das Gelände nach Überlebenden abzusuchen. Denn niemand durfte am Leben bleiben, der auch nur ein Wort über die Spionin flüstern könnte, die jetzt auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in Ithicana war.
Ihre Reise durch die Rote Wüste würde voller Herausforderungen und Gefahren sein. In diesem Moment aber war Lara davon überzeugt, dass ihr nichts davon so sehr zu schaffen machen würde wie das endlose Geplapper von der Elster. Denn da Laras Stute mit Marylyns Mitgift beladen war, hatte man sie angewiesen, hinter dem Intrigenmeister im Damensattel zu reiten.
„Von nun an müsst Ihr die perfekte maridrinische Dame sein“, belehrte er sie, und seine Stimme zerrte an ihren Nerven. „Wir dürfen das Risiko nicht eingehen, dass irgendjemand sieht, wie Ihr euch undamenhaft benehmt, nicht einmal jene, die Seine Majestät für loyal hält.“ Er warf einen vielsagenden Blick auf die Wachen ihres Vaters, die mit einstudierter Mühelosigkeit die Karawane zusammengestellt hatten.
Kein einziger der Männer sah sie an.
Sie wussten nicht, was sie war. Wozu sie ausgebildet worden war. Was außer der Erfüllung eines Kontraktes mit dem feindlichen Königreich ihre Aufgabe war. Aber jeder Einzelne von ihnen glaubte, dass sie kaltblütig ihre Schwestern ermordet hatte. Was in ihr die Frage aufwarf, wie lange ihr Vater diese Männer noch am Leben lassen würde.
„Wie habt Ihr es gemacht?“
Die Worte der Elster rissen Lara einige Stunden später aus ihren Gedanken, und sie zog den weißen Seidenschal fester um ihr Gesicht, obwohl der Mann mit dem Rücken zu ihr saß. „Gift.“ Sie legte einen Hauch von Schroffheit in ihre Stimme.
Er schnaubte. „Hach, sind wir jetzt schnippisch, da wir glauben, wir seien unberührbar?“
Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen, während sie die Hitze der Sonne, die hinter ihnen aufging, deutlich spürte. Dann tauchte sie in den Teich der Ruhe ein, den ihr Meditationsmeister ihr gelehrt hatte, immer dann einzusetzen, wenn sie Strategien entwarf. „Ich habe die Suppenlöffel vergiftet.“
„Wie? Ihr habt nicht gewusst, wo Ihr sitzen würdet.“
„Ich habe alle Löffel vergiftet bis auf die an der Stirnseite des Tisches.“
Die Elster schwieg.
Lara sprach weiter: „Ich habe jahrelang kleine Dosen der unterschiedlichsten Gifte eingenommen, um meine Toleranz aufzubauen.“ Trotzdem hatte sie sich zum Erbrechen gezwungen, sobald sie die Gelegenheit dazu bekommen hatte, und sie hatte sich wieder und wieder übergeben, bis ihr Magen leer gewesen war. Dann hatte sie das Gegenmittel eingenommen, und der Schwindel sowie die Übelkeit waren das einzige verbliebene Zeichen dafür, dass sie überhaupt ein Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.
Der winzige Körper des Intrigenmeisters verspannte sich. „Was wäre gewesen, wenn die Sitzordnung verändert worden wäre? Ihr hättet den König töten können.“
„Sie hat offenbar geglaubt, dass es das Risiko wert sei.“
Lara legte den Kopf schief. Sie hatte das Klimpern der Glocken am Zaumzeug ihres Vaters gehört, als dieser sich ihnen von hinten genähert hatte. Sein Ross war mit Silber geschmückt und nicht wie die Reittiere der Wachen mit Blech.
„Du bist davon ausgegangen, dass ich vorhatte, die Mädchen zu töten, die ich nicht brauche“, sprach er weiter. „Aber statt deine Schwestern zu warnen oder einen Fluchtversuch zu wagen, hast du sie ermordet, um den Platz der Auserwählten einzunehmen. Warum?“
Weil es für die Mädchen ein Leben auf der Flucht bedeutet hätte, wenn sie sich ihren Weg in die Freiheit erkämpft hätten. Ihren Tod vorzutäuschen, war die beste Möglichkeit gewesen. „Ich mag mein Leben in Isolation verbracht haben, Vater, aber die Lehrer, für die Ihr euch entschieden habt, haben mich gut ausgebildet. Ich weiß um die Not, die unser Volk unter Ithicanas Joch auf den Handel erlitten hat. Unser Feind muss in die Knie gezwungen werden, und ich bin die Einzige unter uns Schwestern, die in der Lage ist, das zu tun.“
„Du hast deine Schwestern zum Wohle unseres Landes ermordet?“ Seine Stimme klang erheitert.
Lara zwang ein trockenes Kichern über ihre Lippen. „Wohl kaum. Ich habe sie ermordet, weil ich weiterleben wollte.“
„Ihr habt mit dem Leben des Königs gespielt, um Eure eigene Haut zu retten?“ Serin drehte sich zu ihr um, er war leicht grün im Gesicht. Er hatte sie ausgebildet, was bedeutete, dass es das Recht des Königs wäre, ihm die Schuld an allem zu geben, das sie getan hatte. Und ihr Vater war für seine Unbarmherzigkeit bekannt.
Aber der König von Maridrina stieß nur ein vergnügtes Lachen aus. „Gespielt und gewonnen.“ Er beugte sich vor und schob Laras Schal beiseite, um ihre Wange zu umfassen. „König Aren wird erst begreifen, was er da vor sich hat, wenn es schon viel zu spät ist. Eine schwarze Witwe in seinem Bett.“
König Aren von Ithicana. Aren, ihr zukünftiger Gemahl.
Lara nahm nur am Rande wahr, dass ihr Vater seinen Wachen den Befehl erteilte, das Lager aufzuschlagen, um die Hitze des Tages zu verschlafen.
Einer der Wachposten hob sie von Serins Kamel, und sie setzte sich auf eine Decke, während die Männer das Lager errichteten. Sie nutzte die Zeit, um darüber nachzudenken, was ihr bevorstand.
Lara wusste genauso viel über Ithicana wie die meisten Maridriner – wahrscheinlich sogar mehr. Ithicana war ein Königreich, um das sich ebenso viele Rätsel rankten wie Nebelschwaden: eine Reihe von Inseln, die sich zwischen zwei Kontinenten erstreckten, geschützt von der Stürmischen See und den Verteidigungsanlagen der Ithicaner, um Eindringlinge abzuwehren. Aber das war es nicht, was Ithicana so mächtig machte. Es war die Brücke, die sich über diese Inseln spannte und für zehn Monate des Jahres den einzigen sicheren Weg bildete, zwischen den Kontinenten zu reisen und Waren zu transportieren. Und Ithicana nutzte seinen Vorteil gnadenlos aus, um die Königreiche, die auf den Handel über die Brücke angewiesen waren, hungern zu lassen. Verzweifeln zu lassen. Bis sie bereit waren, jeden Preis zu zahlen, den das Bridge Kingdom für seine Dienste verlangte.
Als Laras Zelt fertig aufgebaut war, wartete sie, bis die Männer ihre Taschen hineingetragen hatten, dann schlüpfte sie ebenfalls in den willkommenen Schatten, wobei sie dem Drang widerstand, ihnen im Vorbeigehen zu danken.
Sie war gerade lange genug allein, um ihren Schal abzulegen, bevor ihr Vater zu ihr ins Zelt kam, dicht gefolgt von Serin.
„Ich muss jetzt damit beginnen, Euch den Code beizubringen“, erklärte der Intrigenmeister und wartete, bis der König saß, ehe er es sich vor Lara bequem machte. „Marylyn hat diesen Code selbst ersonnen, und ich vermute, dass es eine Herausforderung sein wird, ihn Euch in so kurzer Zeit beizubringen.“
„Marylyn ist tot“, erwiderte sie und nahm einen Schluck von dem lauwarmen Wasser aus ihrer Feldflasche, bevor sie sie wieder zuschraubte.
„Erinnert mich nicht daran“, blaffte er sie an.
Ihr Lächeln war erfüllt von einem Selbstbewusstsein, das sie nicht empfand. „Findet Euch damit ab, dass ich alles bin, was von den Mädchen, die Ihr ausgebildet habt, übrig geblieben ist, dann werde ich Euer Gedächtnis nicht auffrischen müssen.“
„Fangt an“, befahl ihr Vater, dann schloss er die Augen. Seine Anwesenheit in ihrem Zelt diente lediglich dem Anstand.
Serin begann mit seinen Unterweisungen im Gebrauch des Codes. Sie musste ihn komplett auswendig lernen, da sie keine Notizen nach Ithicana mitnehmen konnte. Ob sie den Code jemals würde nutzen können, hing davon ab, ob der König von Ithicana ihr die Freundlichkeit erwies und ihr erlaubte, mit ihrer Familie zu korrespondieren. Und Freundlichkeit, das hatte man ihr erklärt, war keine Eigenschaft, für die der Mann bekannt war.
„Wie Ihr wisst, sind die Ithicaner vorbildlich im Knacken von Codes, und alles, was Ihr werdet senden können, wird genau überprüft werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie auch diesen Code durchschauen.“
Lara hob eine Hand und zählte die Punkte an ihren Fingern ab, während sie sprach. „Ich muss also damit rechnen, vollkommen isoliert zu werden, sowohl von den Ithicanern als auch von der Außenwelt. Man wird mir vielleicht erlauben, zu korrespondieren, oder auch nicht, und selbst wenn man es mir erlaubt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unser Code geknackt wird. Ihr habt keine Möglichkeit, mich zu erreichen, um selbst die Nachricht zu überbringen. Ich habe keine Möglichkeit, über ihre Leute etwas zu verschicken, denn es ist Euch bisher nicht gelungen, auch nur einen Einzigen auf Eure Seite zu ziehen.“ Sie ballte die Hand zur Faust. „Abgesehen von einer Flucht, die das Ende meiner Möglichkeiten bedeuten würde, für Euch zu spionieren, wie erwartet Ihr, dass ich Euch die Informationen zukommen lasse?“
„Wenn es eine einfache Lösung gäbe, hätten wir sie bereits gefunden.“ Serin zog ein großes Pergament aus der Tasche. „Es gibt nur einen einzigen Ithicaner, der mit der Außenwelt korrespondiert, und das ist König Aren persönlich.“
Sie nahm das goldumrandete Pergament entgegen, dem das Wappen Ithicanas – eine gewölbte Brücke – eingeprägt war. Dann studierte sie das präzise Schreiben, das Maridrina aufforderte, eine Prinzessin zu liefern, die gemäß den Bedingungen des Fünfzehn-Jahre-Vertrags seine Braut werden sollte. Außerdem enthielt das Dokument eine Einladung, neue Handelsbedingungen zwischen den Königreichen zu vereinbaren. „Ihr wollt, dass ich in einer seiner Nachrichten eine Nachricht verberge?“
Serin nickte und reichte ihr ein Glas mit klarer Flüssigkeit. Unsichtbare Tinte. „Wir werden versuchen, ihm Nachrichten zu entlocken, um Euch diese Chance zu ermöglichen, aber er neigt nicht zu regelmäßiger Korrespondenz. Aus diesem Grund sollten wir uns wieder dem Studium des Codes Eurer Schwester zuwenden.“
Die Lektion war ermüdend, und Lara war erschöpft. Es kostete sie ihre ganze Selbstbeherrschung, nicht vor Erleichterung zu seufzen, als Serin endlich zu seinem eigenen Zelt aufbrach.
Ihr Vater erhob sich gähnend.
„Darf ich eine Frage stellen, Euer Majestät?“, sagte sie, bevor er gehen konnte.
Als er nickte, befeuchtete sie ihre Lippen. „Habt Ihr ihn einmal gesehen? Den neuen König von Ithicana?“
„Niemand hat ihn gesehen. Sie tragen immer Masken, wenn sie Ausländer treffen.“ Dann schüttelte ihr Vater den Kopf. „Aber ich bin ihm einmal begegnet. Das war vor Jahren, als er noch ein Kind war.“
Lara wartete, während ihre Handflächen die Seide ihres Kleides nass werden ließen.
„Es heißt, er sei noch skrupelloser als sein Vater vor ihm. Ein harter Mann, der Ausländern gegenüber keine Gnade zeigt.“ Er suchte ihren Blick, und das untypische Mitleid in seinen Augen ließen ihre Hände eiskalt werden. „Ich habe das Gefühl, dass er dich grausam behandeln wird, Lara.“
„Ich bin dazu ausgebildet worden, Schmerz zu ertragen.“ Schmerz und Hunger und Isolation. Alles, was ihr möglicherweise in Ithicana drohte. Sie war dazu ausgebildet worden, es zu ertragen und ihrer Mission treu zu bleiben.
„Die Grausamkeit wird vielleicht nicht die Form von Schmerzen bringen, die du erwartest.“ Ihr Vater griff nach ihrer Hand und drehte sie um, um ihre Handfläche zu entblößen und zu studieren. „Sei vor allem vor ihrer Freundlichkeit auf der Hut, Lara. Denn die Ithicaner sind überaus gerissen. Und ihr König wird nichts geben, ohne das zu verlangen, was ihm zusteht.“
Ihr Puls beschleunigte sich.
„Das Herz unseres Königreichs ist gefangen zwischen der Roten Wüste und der Stürmischen See, und Ithicanas Brücke ist die einzig sichere Route hinaus“, fuhr er fort. „Weder Wüste noch Meer unterwerfen sich irgendeinem Herrn, und Ithicana … Sie würden unser Volk eher verarmen und verhungern lassen, würden es eher zerstören, als jemals zu erlauben, dass der Handel frei fließt.“ Er ließ ihre Hand los. „Über Generationen hinweg haben wir alles in unserer Macht Stehende getan, um sie zur Vernunft zu bringen. Um ihnen klar zu machen, welchen Schaden ihre Habgier den unschuldigen Bewohnern unserer Reiche zufügt. Aber die Ithicaner sind keine Menschen, Lara. Sie sind Dämonen, die sich in Menschengestalt verstecken. Was du, wie ich befürchte, sehr bald herausfinden wirst.“
Lara beobachtete ihren Vater, als er das Zelt verließ, dann krümmte sie ihre Finger. Am liebsten würde sie sie um irgendwelche Waffen schließen. Um anzugreifen. Um zu verstümmeln. Um zu töten.
Nicht wegen seiner Worte.
So ernst die Warnung ihres Vaters auch war, es war eine, die sie schon ungezählte Male gehört hatte. Nein, es war das Heruntersacken seiner Schultern. Die Resignation in seiner Stimme. Die Hoffnungslosigkeit, die sich kurz in seinen Augen gezeigt hatte. Alles Zeichen dafür, dass ihr Vater trotz allem, was er in dieses Glücksspiel investiert hatte, nicht wirklich daran glaubte, dass sie mit ihrer Mission Erfolg haben würde. So sehr Lara es hasste, unterschätzt zu werden, sie verabscheute es noch mehr, dass jene, die ihr etwas bedeuteten, Schaden nahmen. Und da ihre Schwestern jetzt frei waren, lag ihr nichts mehr am Herzen als Maridrina.
Ithicana würde für seine Verbrechen an ihrem Volk zahlen, und wenn sie mit dem König des Bridge Kingdoms fertig war, würde er nicht einfach nur nachgeben.
Er würde bluten.
Nach weiteren vier Nächten der Reise nach Norden wichen die roten Sanddünen Hügeln mit trockenen Büschen und teils abgestorbenen Bäumen, dann zerklüfteten Bergen, die den Himmel zu berühren schienen. Sie folgten schmalen Schluchten, die Tageshitze wurde milder, die Luft feuchter, und immer öfter bedeckten grüne Flecken die endlose braune Erde. Jetzt sahen sie gelegentlich sogar Blumen mit Blüten in strahlenden Farben. Das ausgetrocknete Flussbett, dem sie folgten, wurde schlammig, und mehrere Stunden später durchquerte die Karawane brackiges Wasser, das nach allen Seiten wegspritzte. Abseits des Flusslaufs blieb die Erde jedoch knochentrocken, das Gelände schroff und anscheinend unbewohnbar.
Männer, Frauen und Kinder hielten in ihrer Arbeit auf den Feldern inne, um die an ihnen vorbeiziehende Gruppe zu beobachten. Sie alle waren mager, trugen fadenscheinige Kleider aus selbst gewebten Tüchern und dazu Strohhüte mit breiter Krempe, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen. Sie lebten von den spärlichen Ernten und dem knochigen Vieh, das sie hielten; eine andere Wahl hatten sie nicht. In früheren Generationen hingegen hatten die Familien mit ihren Gewerben und Geschäften genug verdient, um sich aus Harendell über die Brücke importiertes Fleisch und Getreide leisten zu können. Doch das hatte sich geändert, nachdem Ithicana die Steuern und Zölle erhöht hatte. Jetzt waren solche Importe nur noch für die Reichen erschwinglich, und der arbeitenden Bevölkerung Maridrinas blieb nichts anderes übrig, als den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder diesen trockenen Feldern abzuringen.
Und das schafften diese armen Menschen nur mit knapper Not, wie Lara aufs Neue bewusst wurde, und ihre Brust schnürte sich zusammen, als neben der Karawane Kinder herliefen, deren Rippen unter den zerlumpten Kleidern leicht zu zählen waren.
„Gott segne Seine Majestät!“, riefen sie. „Gott segne die Prinzessin!“ Kleine Mädchen liefen neben Serins Kamel her und reckten sich, um ihr geflochtene Zöpfe aus Wildblumen zu schenken.
Lara nahm sie mit Dank an, drapierte sie sich über die Schultern und dann über den Sattel, als es zu viele wurden. Serin gab ihr einen Sack mit Silbermünzen, die sie verteilen sollte, und es war eine echte Herausforderung, ihre Finger ruhig zu halten, während sie die Münzen in winzige Hände drückte.
Die Kinder lernten sehr bald Laras Namen, und als der schlammige Fluss auf dem Weg zum Meer plötzlich kristallklar über ausgedehnte Stromschnellen floss, riefen sie: „Gesegnet sei Prinzessin Lara! Wacht über unsere schöne Prinzessin!“ Aber es waren die immer lauter gesungenen Worte „Gesegnet sei Lara, Maridrinas Märtyrerin“, die Laras Hände kalt werden ließen. Sie hielten sie wach, noch lange nachdem Serin seinen allabendlichen Unterricht beendet hatte, und füllten ihren Schlaf mit Albträumen, als sie endlich wegdämmerte. Es waren Träume, in denen sie von spottenden Dämonen gefangen gehalten wurde, Träume, in denen all ihre Talente sie im Stich ließen und in denen sie sich nicht befreien konnte, was auch immer sie tat. Es waren Träume, in denen Maridrina lichterloh brannte.
Und mit jedem Tag kamen sie ihrem Ziel näher.
Als die Erde immer fruchtbarer und feuchter wurde, stieß ein größeres Kontingent von Soldaten zu ihrer Karawane, und Lara wurde vom Kamel in eine von zwei weißen Pferden gezogene blaue Kutsche verfrachtet. Das Zaumzeug der Schimmel war mit den gleichen Silbermünzen geschmückt wie das Pferd von Laras Vater. Mit den Soldaten kam auch ein ganzes Gefolge von Dienern, die sich um alles kümmerten, was Lara brauchte, die sie wuschen und frisierten und schmückten. Schon bald würden sie Vencia erreichen, die Hauptstadt Maridrinas.
Das Getuschel der Bediensteten entging Lara natürlich nicht: Dass ihr Vater die zukünftige Braut für Ithicanas König all die Jahre zu ihrem eigenen Schutz in der Wüste versteckt gehalten hatte. Dass sie eine heiß geliebte Tochter sei, geboren von einer bevorzugten Gemahlin, die von ihm persönlich ausgewählt worden war, um die beiden Königreiche in Frieden zu einen. Ihr Charme und ihre Anmut sollten dafür sorgen, dass Ithicana ihrem Herkunftsland, dem Königreich Maridrina, all die Vorteile gewährte, die ein Verbündeter genießen sollte und die es Maridrina ermöglichen würden, zu neuer Blüte zu gelangen.
Die bloße Vorstellung, dass Ithicana so etwas erlauben würde, war lächerlich, aber Lara empfand keine Erheiterung über die Naivität der einfachen Leute. Nicht, wenn sie die verzweifelte Hoffnung in ihren Augen sah. Stattdessen schürte sie bedächtig ihren eigenen Zorn und verbarg ihn unter einem sanften Lächeln und anmutigem Winken aus dem offenen Fenster der Kutsche. Sie brauchte diese Stärke, wenn man bedachte, dass sie auch anderes Getuschel hörte: „Habt Mitleid mit der armen, sanften Prinzessin“, sagten die Diener mit Kummer in den Augen. „Was wird aus ihr werden inmitten dieser Dämonen? Wie soll sie ihre Brutalität überleben?“
„Hast du Angst?“ Ihr Vater zog zu Laras großem Missfallen die Vorhänge der Kutsche zu, als sie die Außenbezirke von Vencia erreichten. Es war die Stadt, in der sie geboren wurde, und sie hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie aus dem Harem fortgeholt und zu der Oase gebracht worden war, um im Alter von fünf Jahren ihr Training zu beginnen.
Sie drehte sich zu ihm um. „Ich wäre eine Närrin, wenn ich keine Angst hätte. Wenn sie herausfinden, dass ich eine Spionin bin, werden sie mich töten und dann aus reiner Bosheit die Handelskonzessionen zurücknehmen.“
Ihr Vater gab einen zustimmenden Laut von sich, dann zog er zwei mit maridrinischen Rubinen besetzte Messer unter seinem Mantel hervor und reichte sie ihr. Lara erkannte in ihnen die zeremoniellen Waffen, die zum Feststaat verheirateter Maridrinerinnen gehörten. Sie sollten von einem Ehemann zur Verteidigung der Ehre seiner Gemahlin benutzt werden, aber typischerweise waren die Klingen stumpf. Dekorativ. Nutzlos.
„Sie sind wunderschön. Danke.“
Er lachte leise. „Schau genauer hin.“
Lara zog die Messer aus ihrer Scheide, prüfte die Klingen und stellte fest, dass sie scharf waren, aber die Balance stimmte nicht. Dann beugte ihr Vater sich vor und drückte auf eins der Juwelen, und die goldene Hülle fiel herunter, um ein Wurfmesser zu entblößen.
Lara lächelte.
„Wenn sie dir nicht erlauben, mit der Außenwelt Verbindung aufzunehmen, wirst du auf den richtigen Zeitpunkt warten müssen und währenddessen ihre Geheimnisse in Erfahrung bringen, bevor du fliehst. Vielleicht kämpfst du dir ja sogar den Weg frei und kehrst mit dem, was du herausgefunden hast, zu uns zurück.“
Sie nickte und ließ die Waffen in ihren Händen vor- und zurückschnellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Unter keinen Umständen würde sie zurückkehren und ihre Invasionsstrategie freiwillig preisgeben. Das wäre Selbstmord.
Nachdem sie von der Absicht ihres Vaters erfahren hatte, sie und ihre Schwestern – mit einer Ausnahme – bei ihrem gemeinsamen Festmahl in der Wüste zu töten, hatte Lara genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, warum ihr Vater die Töchter tot sehen wollte, die nicht dazu bestimmt waren, Königin zu sein. Dahinter steckte mehr als nur der Wunsch, seine Verschwörung geheim zu halten, bis er die Brücke erfolgreich erobert hatte. Ihr Vater wollte, dass diese Verschwörung für immer geheim blieb, denn wenn jemand davon erfuhr, würde das die Möglichkeit, eins seiner anderen noch lebenden Kinder für politische Verhandlungen zu nutzen, schlagartig vernichten. Niemand würde ihm jemals wieder vertrauen. Genauso, wie er ihr niemals vertrauen würde. Was bedeutete, dass auch Lara zum Schweigen gebracht werden würde, sollte sie jemals zurückkehren, erfolgreich oder nicht.
Ihr Vater durchbrach ihre Gedanken. „Ich war dabei, als ihr Mädchen eure ersten Morde begangen habt“, sagte er. „Hast du das gewusst?“
Die Klingen erstarrten in ihren Händen, als Lara sich an jenen Tag erinnerte. Sie und ihre Schwestern waren sechzehn gewesen, als unter Serins wachsamem Blick eine Reihe in Ketten liegender Männer auf das Gelände gebracht worden waren. Es waren Plünderer aus Valcotta gewesen, die man gefangen genommen und hergebracht hatte, um die Kriegerprinzessinnen Maridrinas auf die Probe zu stellen. Töten oder getötet werden, hatte Meister Erik ihnen erklärt, als man sie eine nach der anderen in den Kampfhof gestoßen hatte. Einige ihrer Schwestern hatten gezögert und waren unter den verzweifelten Hieben der Plünderer gefallen. Lara war das nicht passiert. Sie würde niemals das Geräusch des fleischigen, dumpfen Aufpralls ihrer Klinge vergessen, als sie sich von der anderen Seite des Hofes in die Kehle ihres Gegners gebohrt hatte. Ebenso wenig das Erstaunen, mit dem er sie angestarrt hatte, bevor er langsam im Sand zusammengebrochen war und sein Blut eine Lache um ihn herum gebildet hatte.
„Nein, das habe ich nicht gewusst“, antwortete sie.
„Messer sind, wenn ich mich recht erinnere, deine Spezialität.“
Töten war ihre Spezialität.
Die Kutsche holperte über gepflasterte Straßen, und die Hufe der Pferde machten auf dem Stein scharfe, klackernde Geräusche. Lara hörte draußen immer wieder Jubel, und sie zog den Vorhang beiseite und versuchte, den schmutzigen Männern und Frauen zuzulächeln, die die Straßen säumten und deren Gesichter von Hunger und Krankheit bleich waren. Noch schlimmer waren die Kinder unter ihnen. Sie wirkten so stumpf und hoffnungslos und wehrten nicht einmal mehr die Fliegen ab, die sie umschwirrten und sich auf ihrer Haut niederließen.
„Warum tut Ihr nichts für sie?“, fragte sie ihren Vater, der mit ausdrucksloser Miene aus dem Fenster schaute.
Er richtete den Blick seiner blauen Augen auf sie. „Warum, glaubst du, habe ich dich erschaffen?“ Dann griff er in seine Tasche und gab ihr eine Handvoll Silber, das sie aus dem Fenster werfen konnte, was sie auch tat.
Sie schloss die Augen, als ihre verarmten Untertanen um das glänzende Metall kämpften. Sie würde sie retten. Sie würde Ithicana die Kontrolle über die Brücke entreißen, und kein Maridriner würde je wieder Hunger leiden.
Die Pferde verlangsamten ihr Tempo und trabten die steilen, gewundenen Straßen zum Hafen hinunter. Wo das Schiff darauf wartete, sie nach Ithicana zu bringen.
Lara zog den Vorhang vollständig beiseite, um ihren ersten Blick auf das Meer zu erhaschen. In der Luft lag der Duft von Fisch und Salz. Auf dem Wasser war Gischt zu sehen, und das Heben und Senken der Wellen nahm Laras ganze Aufmerksamkeit ein, während ihr Vater ihr die Messer aus den Händen nahm, um sie zur richtigen Zeit zurückzugeben.
Die Kutsche fuhr über einen Markt, der fast kein Lebenszeichen zeigte. Die Stände waren verwaist. „Wo sind denn alle?“, fragte sie.
Das Gesicht ihres Vaters war dunkel und undeutbar. „Sie warten darauf, dass du ihnen die Tore nach Ithicana öffnest.“
Die Kutsche rollte in den Hafen und blieb dann stehen. Ohne jedwedes Zeremoniell half ihr Vater ihr aus der Kutsche. Das Schiff, das auf sie beide wartete, hatte die azurblaue und silberne Flagge gehisst. Maridrinas Farben.
Er führte sie eilends zum Kai hinunter und über eine Laufplanke auf das Schiff. „Die Überfahrt nach Südwacht dauert weniger als eine Stunde. Unten warten bereits Diener darauf, dich zurechtzumachen.“
Lara warf einen letzten Blick zurück auf Vencia, auf die Sonne, die heiß und strahlend darauf herabbrannte, dann richtete sie den Blick auf die Wolken, den Nebel und die Dunkelheit, die auf der anderen Seite der schmalen Meeresenge vor ihr lagen. Ein Königreich, das sie retten musste. Ein Königreich, das sie vernichten musste.