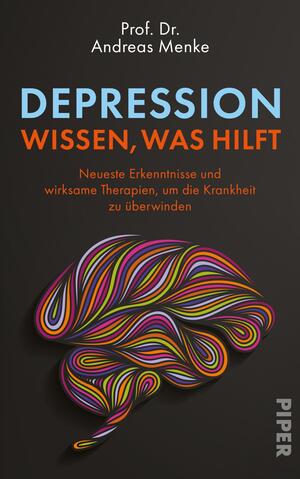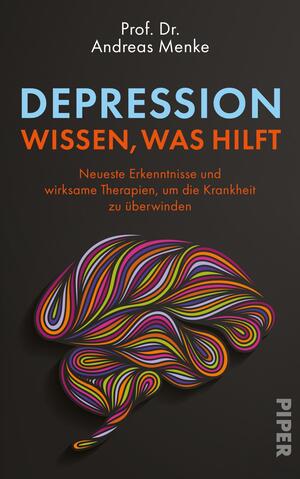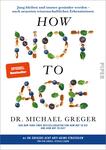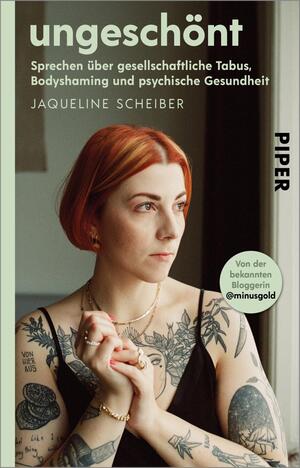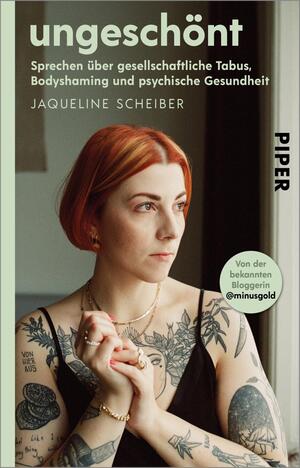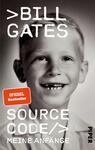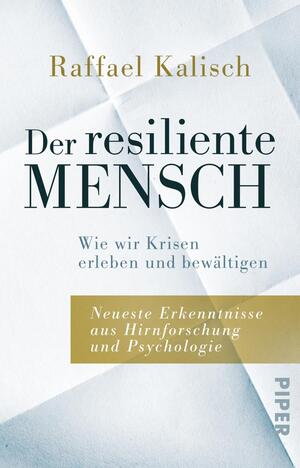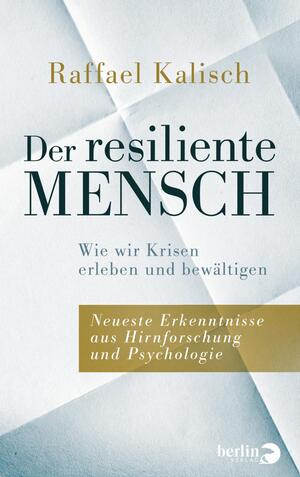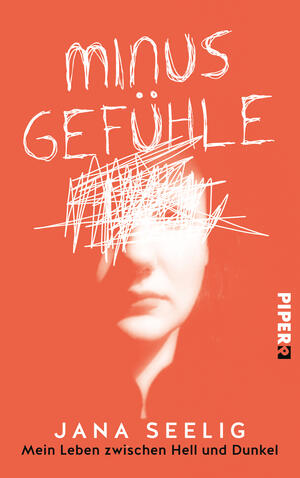„Wenn die Sehnsucht größer als die Angst ist, wird Mut geboren.
Ohne Sehnsucht machen wir uns nicht auf den Weg.“
Rainer Maria Rilke
Prolog
Als ich klein war, fürchtete ich mich vor den Monstern unter meinem Bett. Auf keinen Fall die Füße aus dem Bett hängen lassen, dachte ich allabendlich mit zusammengebissenen Zähnen. Was, wenn ein Monster danach greift? Meine Fantasie kannte keine Grenzen. Heute muss ich darüber lachen, und doch gibt es Momente, in denen ich mich dabei erwische, wie ich ganz schnell meine Füße wieder unter die Bettdecke stecke. Manche Monster verschwinden eben nie ganz.
Wir Menschen haben unterschiedliche Ängste. Das Gefühl gehört zu uns wie Freude, Trauer, Ärger und Wut. Wir haben Angst vor dem Tod, vor Krankheiten, vor finanzieller Unsicherheit, schlimmen Ereignissen oder Einsamkeit. Ängste können aber auch kleiner und weniger existenziell sein. Die Angst vor einer Prüfung, vor dem ersten Date, die Angst, verlassen zu werden, oder auch die Angst, das erste Mal etwas alleine zu tun.
Wer mich kennt, würde wohl nicht sagen, dass ich ein ängstlicher Mensch bin. Horrorfilme nachts alleine angucken? Kein Problem. Alleine im Dunkeln von der Bar durch die Großstadt nach Hause radeln? Ein Klacks. Komische Geräusche im Haus? Ich bin die Erste, die nachsieht, meiner Neugierde sei Dank. Selbst alleine in der U-Bahn fühle ich mich sicher. Na ja, zumindest fast immer. Nachts in der U-Bahn habe ich tatsächlich nie Angst, dafür umso mehr am Tag. Dann nämlich, wenn sie voll ist, es eng wird und sie vielleicht auch noch unverhofft im Tunnel stehen bleibt. Da wird mir plötzlich heiß, Übelkeit steigt auf, und ich will nur noch eins: raus hier. Der Kontrollverlust, die Enge, die fremden Menschen – herzlich willkommen in meinem persönlichen Albtraum!
Diese und andere Ängste gehören zu meinem Leben dazu. Denn ich habe eine Angststörung. Ich fürchte mich vor Dingen, vor denen der Großteil der Menschen keine Angst hat, die der Großteil der Menschen nicht mal bemerkt, während ich immer vor ihnen auf der Hut bin. Das kleine Monster Angst begleitet mich jeden Tag, es ist immer an meiner Seite, mal leise und zurückhaltend, mal laut und aufdringlich. Manchmal sieht es mich nur an, manchmal stellt es sich mir breitbeinig in den Weg. Ganz verschwindet es aber nie, und ich würde fast behaupten, so langsam habe ich es lieb gewonnen. Denn das Monster wetzt nicht nur die Krallen, es warnt mich auch vor stressigen Situationen, zeigt mir, wenn ich mir mal wieder zu viel auflade oder einen Gang zurückschalten sollte. Es ist auf jeden Fall ein netteres Monster als jene unter dem Bett.
Meine Angststörung und ich gehören zusammen. Lange habe ich nicht über sie gesprochen, weil ich nicht „die mit der Angststörung“ sein wollte. Ich bin doch so viel mehr. Journalistin, Freundin, Tochter und Geschäftsfrau, und vor allem Antonia – mit all ihren Facetten. Nur dass ich manchmal eben Angst habe.
Fünfundzwanzig Prozent aller Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Angststörung. Eine große Zahl, doch tatsächlich kenne ich in meinem direkten Umfeld niemanden, der offen über seine Ängste spricht. Die meisten Menschen, die unter einer Angststörung leiden, bleiben lieber anonym. Psychische Erkrankungen gelten immer noch als Schwäche, finden selten Akzeptanz. Während körperliche Krankheiten ernst genommen werden, gilt eine angegriffene Seele oft als Ausrede, als Einbildung oder Luxusproblem. „Reiß dich zusammen, das wird schon wieder.“ Schwäche zuzugeben fällt in unserer Leistungsgesellschaft schwer.
Als Journalistin, die über die Jahre gelernt hat, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat, wollte ich irgendwann auch meine erzählen. Meine Erfahrungen aufschreiben, mein Wissen teilen und zeigen: Auch ich, die ich stark und cool sein kann, bin manchmal schwach. Nicht nur weil es mir geholfen hat, meine Ängste offen anzusprechen, und ich dadurch einen guten Umgang damit gefunden habe, sondern auch weil es anderen helfen kann, wenn jemand zu seiner Schwäche steht und Mut macht, zeigt, dass wir alle irgendwie unsere Päckchen zu tragen haben. Ich möchte andere Betroffene entlasten und dazu beitragen, Angsterkrankungen sowie seelische Leiden zu entstigmatisieren. Schließlich kann es jede*n von uns treffen, auch die nach außen Erfolgreichen und Mutigen. Es braucht im 21. Jahrhundert doch wirklich keine Scham und kein Schweigen mehr, sondern Dialog und Mut.
Ein Buch über meine Angststörung, meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse schien mir dafür der beste Weg zu sein. Ich möchte Menschen ermutigen, ihre Ängste anzunehmen, sie zu umarmen und einen Weg zu finden, sich mit ihnen zu arrangieren, statt ständig gegen sie anzukämpfen. Denn auch ich habe immer wieder gegen die Angst gekämpft, wollte sie bloß nicht zulassen, bloß nicht sichtbar machen, bloß keine Schwäche zeigen, um mich nicht mehr so furchtbar hilflos zu fühlen. Geholfen hat das nicht. Die Angst wurde immer größer, ihre Besuche regelmäßiger.
Nicht umsonst heißt es: Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, mach ihn dir zum Verbündeten. Also habe ich irgendwann versucht, die Angst zu verstehen. Was will sie von mir? Warum ist sie da? Und kann es eventuell sein, dass sie mich vor etwas schützen will? Noch habe ich nicht alle Antworten gefunden, aber die Angst und ich sind auf einem guten Weg. Wir haben Freundschaft geschlossen. Wir gehören zusammen, denn man wird sie nicht los, sie ist ein natürliches Gefühl. Man kann aber lernen, mit ihr zu leben, sie nicht mehr so ernst zu nehmen, sondern sie liebevoll zu begrüßen und ihre Besuche sogar mit Humor zu sehen.
Dieses Buch soll zeigen, wie man trotz Angst froh und frei durchs Leben geht, wie man trotz – oder vielleicht sogar dank – der Angst großartige Dinge schafft und wo die eigenen Grenzen liegen. Was die Angst mit einem macht und warum es okay ist, hin und wieder ein Angsthase zu sein.
Ich nehme dich mit auf meine Reise mit der Angst, berichte, was ich in den letzten Jahren erlebt und gelernt habe, und versuche vor allen Dingen, dir Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie du selbst mit deiner ganz persönlichen Angst umgehen kannst. Am wichtigsten aber ist es mir zu zeigen: Angst zu haben ist okay. Sie gehört zu uns, sie begleitet uns, aber sie macht uns nicht aus.
Monster werden kleiner, wenn man über sie spricht. Also erzähle ich jetzt die Geschichte von Katja und mir.
1
Ich habe sie Katja genannt. Frag mich nicht, wie ich gerade auf Katja gekommen bin, aber ich wusste, die Angst braucht einen Namen. Ich will sie anschreien können. Katja also. Kurz und prägnant. Kein Name, den ich furchtbar gerne mag (ein Sorry an alle Katjas dieser Welt), aber auch ein Name, den ich nicht extrem verabscheue. Außerdem schnell zu rufen. Denn keine*r will im aufkeimenden Panikmodus mit seiner Angst sprechen und dann einen Namen wie Philomena-Dorothea rufen. Da muss es schnell gehen. Katja schoss mir als Erstes durch den Kopf, seitdem spreche ich mit Katja. In Gedanken.
„Alles ist gut, wir brauchen keine Angst zu haben, Katja. Du kannst zurückbleiben, ich schaffe das alleine.“
Katja und ich also. Gemeinsam gehen wir durchs Leben. Katja ist dünn, groß und irgendwie sehr hager. Wie ein schwarzer Schatten steht sie vor mir. Niemand, den man gerne umarmt, sondern jemand, der einen mitzieht und manchmal auch nur schwer wieder loslässt. Ein Monster wie aus einem dieser schlechten Horrorfilme aus den Achtzigerjahren. An vielen Tagen läuft Katja vor mir her, bestimmt den Weg. Sagt: „Hier lang.“ Und obwohl ich rufe: „Nein, ich möchte lieber hier entlang“, zieht sie mich mit. Ätzend finde ich das, aber so ist das zwischen uns nun einmal. An anderen Tagen geht sie neben mir, flüstert mir leise irgendetwas ins Ohr, bis ich sage, sie soll damit aufhören, still sein. Und siehe da: Katja kann auch die Klappe halten. Und dann gibt es Tage, da ist sie gar nicht da. Verschwunden. Das fühlt sich gut an, frei. Unsere Freundschaft ist oft zu eng und zu intensiv, Verschnaufpausen tun gut.
Und ich möchte ehrlich sein: Ein Katja-Besuch alle paar Jahre würde mir reichen. Doch noch kommt sie öfter, als mir lieb ist.
Das Problem bei Katja ist: Sie klopft oft sehr leise an. Dann kann es passieren, dass ich sie nicht höre. Angstpatient*innen kennen das vielleicht: Man will die Angst nicht wahrhaben, selbst wenn die Warnzeichen schon auf Rot stehen. Hat es gerade geklopft? Nee, alles ruhig. Ich werde jetzt sicher keine Angst bekommen. Bis Katja die Tür eintritt – rücksichtslos wie der Elefant im Porzellanladen – und schreit: „Hallooo, du Liebe, ich bin wieder dahaa!“ Wie wenig man unangekündigten Besuch brauchen kann, muss ich keinem sagen.
Nichtsdestotrotz gehören Katja und ich irgendwie zusammen.
Seit über zwanzig Jahren leide ich an einer Angststörung. Dass ich damit nicht alleine bin, war mir lange nicht bewusst. Denn über Besuche von Katja habe ich nur selten gesprochen. Versteht ja sowieso keine*r, warum mir in der U-Bahn schlecht wird, sobald wir im Tunnel stehen – das habe ich zumindest lange Zeit gedacht. Dass genau das Gegenteil der Fall ist, wurde mir erst sehr spät klar. Schließlich ist die Angststörung neben der Depression die am häufigsten diagnostizierte seelische Erkrankung. Während zahlreiche Menschen beim Fliegen damit zu kämpfen haben, trauen sich andere wiederum manchmal wochenlang nicht aus dem Haus. Der eine bekommt in der Supermarktschlange Herzklopfen, die Nächste fährt nur noch Landstraße statt Autobahn. Die Angst hat viele Gesichter.
Ihre Vielfalt macht es aber auch schwierig, sie zu erkennen und zu verstehen. Schließlich ist Angst genau wie die Liebe ein universelles und wichtiges Gefühl. Sie hilft uns durchs Leben und zeigt uns den Weg. Sie schützt uns vor vermeintlich gefährlichen Situationen, oft ist sie eine Reaktion auf negative Erfahrungen, Traumata, Stress oder Überforderung. Bei Angstpatient*innen ist sie jedoch übertrieben und nicht mehr hilfreich, sondern störend. Denn wenn man vor den einfachsten Dingen Angst bekommt, wird der Alltag plötzlich zur Qual.
Erklären kann man das Ganze oft nur schwer, Fragen wie „Wovor hast du eigentlich Angst?“ lassen sich kaum beantworten. Denn rational weiß man, dass man keine Angst zu haben braucht, und doch fühlt man sie. Der Körper schaltet auf Fluchtmodus, die Achterbahn der Gefühle reißt einen unaufhaltsam mit. „Ich muss hier weg“, ist der einzige Gedanke, den man dann noch fassen kann.
So habe auch ich irgendwann Ängste entwickelt, die rational in keiner Weise erklärbar waren, und sich dennoch nicht minder real angefühlt haben.
2
Das Glas füllt sich langsam. Ich blicke von meiner Apfelschorle auf und durch den sonnendurchfluteten Raum. „Ganz schön viel los hier“, denke ich. Aber was soll man auch anderes erwarten an einem Samstag bei IKEA, noch dazu in den bayerischen Schulferien.
Wir sind zu Besuch bei meinen Verwandten in Salzburg und nutzen den Tag für einen gemeinsamen Abstecher zum geliebten Einrichtungshaus. Meine Familie wuselt irgendwo im Restaurant herum, wir machen eine Pause vom Shoppen: ein, zwei Dinge, die man braucht, viele, die man nicht braucht. Das ist auch schon im Jahr 2000 so.
Mein Glas ist endlich voll, auf dem Weg zum Tisch staune ich noch immer über die Möglichkeit, sich unendlich oft nachzufüllen. „Wie die das wohl finanzieren?“, denkt mein vierzehnjähriges Ich, als ich mich mit meinem Tablett an einem jungen Paar vorbeidrücke, das, ohne auf seine Umgebung zu achten, in Richtung Essensausgabe eilt. Ich verdrehe die Augen, balanciere durch die Tischreihen und erreiche endlich mein Ziel.
Meine Cousine, meine Tante, meine Schwester, meine Mutter – sie alle sitzen schon und mampfen ihr Mittagessen. Neben uns schreit ein Baby, die Leute am Tisch vor uns sind gerade mit dem Essen fertig geworden und stehen auf. Es ist laut, Stühle werden gerückt, das Geschirr klirrt. Mit meiner Gabel pikse ich in meine Pommes. Ich beiße in eine Fritte, während wir über die Schule reden, meine Cousine lacht.
Die Worte verhallen im Raum, meine Konzentration lässt nach. „Ganz schön warm hier“, denke ich und blicke über die Menschenmenge auf die Fensterfront, durch die die Sonne in den Raum prallt. Ich ziehe meinen Pulli aus, atme tief ein. Ist den anderen denn gar nicht heiß? Ich esse einen weiteren Bissen, als sich plötzlich mein Hals zuschnürt. Ich kann kaum noch schlucken, das Essen fühlt sich mit einem Mal wie eine zähe Masse an. Mein Blick fällt auf die Gerichte meiner Familie, die Gerüche werden intensiver, ich kämpfe mit einem unangenehmen Völlegefühl. Mir ist übel. Eine ungewohnte Unruhe steigt in mir auf, ich rutsche auf dem Stuhl hin und her, als ich wie von Weitem die Stimme meiner Mutter höre: „Antonia?“ Verschreckt schaue ich auf. „Antonia, geht’s dir gut?“, fragt sie. „Du bist plötzlich so blass.“
Ich schüttle den Kopf. „Mir ist schlecht“, antworte ich. Meine Beine zittern, es fühlt sich an, als würde ich den Halt verlieren, ich schiebe den Teller von mir und halte mich am Tisch fest. Die Lautstärke des Raumes scheint mich zu erdrücken. „Tief einatmen“, denke ich. Der Lärm wird immer unerträglicher.
„Was ist denn los?“ Die anderen hören mit dem Essen und Reden auf und starren mich an.
„Ich glaube, ich muss an die frische Luft“, presse ich heraus. Bevor meine Familie antworten kann, wird mir so heiß und schlecht, dass ich aufspringe und zur Toilette um die Ecke renne.
Noch auf dem Weg muss ich würgen, halte mir die Hände vor den Mund. Ich stürze in die erste freie Kabine. Sekunden später übergebe ich mich.
Zitternd kauere ich auf dem Boden der IKEA-Toilette. Nicht sehr hygienisch, doch mein schwacher Körper kann nicht anders. Mir ist immer noch schlecht, doch die Ruhe hilft. „Toni?“ Ich höre die zaghafte Stimme meiner Schwester. „Toni, geht’s dir gut?“
„Es geht“, sage ich, Tränen laufen meine Wangen hinunter. Ich bin plötzlich furchtbar erschöpft.
„Was war denn los?“
„Ich weiß nicht, mir wurde auf einmal so schlecht.“
„Geht’s ihr wieder besser?“ Nun ist auch meine Mama da.
Ich hieve mich hoch und schließe die Tür auf. „Es geht“, sage ich wieder, meine Stimme zittert, als mich meine Mama in den Arm nimmt.
„Komm, du trinkst jetzt einen Schluck Wasser, und dann gehen wir zügig durch den Laden. Das war bestimmt dein Kreislauf.“
Ich nicke und folge den beiden auf wackligen Beinen wieder in den Speisesaal. Meine Cousine kommt mir schon mit einem Glas Wasser entgegen. „Hier, trink.“ Das kalte Wasser tut gut, zittrig setze ich mich.
Die anderen essen schnell auf, während ich apathisch am Tisch sitze und mein Wasserglas umklammere. Immer wieder atme ich tief ein, die Übelkeit hat nachgelassen, doch wohl ist mir nicht, und auch die Unruhe bleibt. Dreißig Minuten später sitzen wir wieder im Auto, ich bin fix und fertig.
„Ist alles okay?“ Meine Mutter blickt mich besorgt durch den Rückspiegel an. Mit geschlossenen Augen nicke ich, ich will nur noch heim. Meine Katze in den Arm nehmen, mich in mein Bett kuscheln.
Am Abend sind wir wieder zu Hause. Als wir die Haustüre aufsperren, fällt die Anspannung von mir ab. Ich bin in Sicherheit. „Alles wieder okay“, denke ich noch, als ich mich ins Bett fallen lasse. Oder etwa doch nicht?
3
Freude, Liebe, Trauer, Wut oder Angst – wir Menschen fühlen die gesamte Bandbreite an Empfindungen. So gerne wir die negativen Gefühle ausklammern würden, keine*r von uns wird ein Leben ohne Wut oder Trauer leben. Also bleibt uns nur eines: Wir müssen uns unseren Gefühlen stellen, ihren Sinn erkennen und mit ihnen leben.
Dasselbe gilt auch für die Angst. Jede*r von uns fürchtet sich. Sobald wir Menschen in potenzielle Gefahr geraten, setzt die Angst ein. Sie gehört zu unseren menschlichen Urinstinkten, ist mindestens genauso stark wie die Liebe und neben ihr eines der wichtigsten Gefühle für uns. Denn die Angst schützt uns, aus evolutionärer Sicht ist sie sogar lebensnotwendig. Unsere Vorfahr*innen überlebten schließlich nur, weil sie mithilfe ihrer Angst lernten, Gefahren und Risiken zu erkennen und Vorsicht walten zu lassen. Nur durch die Flucht vor der Gefahr sicherten sie ihr Leben – und somit den Fortbestand der Menschheit. Ohne die Angst gäbe es – einfach gesagt – weder dich noch mich.
Während sich unsere Vorfahr*innen Säbelzahntigern und anderen lebensbedrohenden Gefahren ausgesetzt sahen und die Angst ein wichtiger und ständiger Begleiter in unerforschtem Gelände war, ist unser Leben heute jedoch weitaus weniger gefährlich. Das Gefühl der Angst begleitet uns aber nach wie vor. Allerdings kommt es nur noch selten mit einem Paukenschlag, schließlich stehen wir – Gott sei Dank – keinen hungrigen Raubtieren mehr gegenüber und schweben somit nicht mehr täglich in unmittelbarer Lebensgefahr. Die akute Angst aus Urzeiten ist einer theoretischen Angst gewichen. Sie macht sich breit, wenn wir Unsicherheit oder Ungewissheit verspüren. Wir fürchten das Unbekannte, haben also Angst vor etwas, das potenziell passieren könnte.
Es sind zum Beispiel soziale Ängste, die uns umtreiben, existenzielle Sorgen wie der Verlust des Arbeitsplatzes, der Wohnung oder die Furcht vor einer drohenden Krankheit beherrschen unsere Gedanken. Dazu kommen diffuse Befürchtungen wie die, Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls zu werden. Gleichzeitig sorgen wir uns um unsere Liebsten, unsere Beziehung oder fürchten uns vor dem Tod von Angehörigen.
Die Angst hat uns ursprünglich vor dem Aussterben bewahrt. Doch schon damals waren nicht alle Menschen Angsthasen. Auch hier gab es diejenigen, die sich furchtlos in risikoreiche Situationen begaben, während andere lieber einen Bogen um potenzielle Gefahren machten und am Lagerfeuer sitzen blieben. Wir Menschen sind eben unterschiedlich, und das gilt bis heute.
Hinzu kommt, dass wir bezüglich unserer Ängste auch stark gesellschaftlich geprägt sind. Ich als Frau kann und darf öffentlich meine Angst zeigen. Niemand wird mich ansehen und sagen: „Wie, du hast Angst?“ Schließlich blieben auch schon bei unseren Vorfahr*innen die Frauen zu Hause, während die Männer auf die Jagd gingen und sich den Gefahren stellten. Das hat zur Folge, dass von Männern selbst im 21. Jahrhundert noch erwartet wird, dass sie jederzeit Stärke zeigen. Aufgrund von längst antiquierten gesellschaftlichen Normen gilt für sie immer noch das Bild des mutigen, starken Mannes.
Manche Ängste erlernen wir bereits in der Kindheit. Unsere Familie, unser Umfeld oder andere soziale Einflüsse konditionieren uns und bereiten uns auf das Leben vor. So beginnen wir, basierend auf Erfahrungswerten, auf Charaktereigenschaften und frühen Prägungen spezielle Ängste zu entwickeln. Kinder ängstlicher Eltern sind ebenfalls oft ängstlich. Schreit eine Mutter beim Anblick einer Maus, überträgt sich das oft auch auf ihre Kinder. Wenn die Mama schreit, muss die Maus doch gefährlich sein, oder?
Im Erwachsenenalter legen sich diese Ängste häufig wieder, schließlich entwickeln wir uns weiter, sammeln neue Erfahrungen und verstehen, dass Mäuse eigentlich ganz putzig sind.
Ängste können also ganz unterschiedlich sein, sie wirken bei allen Menschen anders, und doch haben sie eines gemeinsam: Sie lassen uns aufmerksamer und vorsichtiger sein, sobald unser Leben in Gefahr scheint, wir uns in einer unbekannten, vermeintlich unkontrollierbaren Situation befinden.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: Ängste sind nicht nur negativ. Sie können uns antreiben, uns unsere Grenzen austesten und uns aktiv werden lassen. Jedes Ereignis, das uns erst Angst gemacht hat, das wir dann aber mutig überwunden haben, stärkt unser Selbstbewusstsein. Wir trauen uns mehr (zu) und lernen, dass Angstsituationen uns auch wachsen lassen. Unsere körperlichen wie geistigen Grenzen werden durch die Angst immer wieder neu gesteckt.
Niemand von uns ist ohne Angst. Doch es gibt Menschen, die Situationen bereits als Bedrohung erleben, die objektiv betrachtet noch überhaupt keine Gefahr darstellen. Wetten, du kennst solche ängstlichen Personen auch? Schließlich ist jede*r von uns mindestens einmal schon einem Menschen begegnet, der Angst vor dem Zahnarzt hat, schreiend vor einer Spinne davonrennt oder beim Fliegen Schweißausbrüche bekommt. Nichts davon ist wirklich lebens- oder existenzbedrohend, und doch treibt allein der Gedanke an die Situation diese Menschen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Zumindest treibt er ihnen Schweißperlen auf die Stirn und sorgt für zittrige Beine.
Solche lästigen Alltagsängste können eine*n jede*n befallen, selbst Menschen, die das Rampenlicht lieben, schwitzen auf dem Zahnarztstuhl. Wirklich! Sie führen dazu, dass Menschen viel zu selten oder viel zu oft zum Arzt gehen, Autobahnfahrten meiden oder nur mit schweißnassen Händen überstehen und aus Angst vor möglichen Einbrecher*innen ihre Wohnung übertrieben verriegeln und überall Kameras aufstellen. Doch sie schränken nicht wirklich ein – meist finden die Geplagten Wege, ihre Phobien in den Griff zu bekommen. Und wenn sie nur den oder die Nachbar*in darum bitten, die Spinne aus der Wohnung zu tragen. Sie lernen, sich zu beruhigen, sich Hilfe zu suchen oder eine Zahnärztin zu googeln, die auf Angstpatient*innen spezialisiert ist.
Mit derartigen Ängsten kann man leben. Mit manch anderen allerdings nicht. Denn es gibt auch Menschen wie mich. Richtige Angsthäsinnen, die zwar in vielen Situationen mutig sind, in völlig unbegründeten Situationen aber Gefahr spüren. Die keine Angst vor dem Tod haben, Spinnen ohne Zittern aus dem Haus tragen, dafür aber in den Fluchtmodus wechseln, wenn der Aufzug plötzlich ruckelt. Deren Herz schneller schlägt, sobald sich der Verkehr staut oder sie sich in einer Menschenmenge befinden. Deren Alltag zu einer Herausforderung wird, weil sie ständig von Angst befallen werden, und das in Situationen, in denen nun wahrlich keine Gefahr droht.
Unter den Achtzehn- bis Fünfundsechzigjährigen leiden laut statistischem Bundesamt in Deutschland derzeit 14,2 Prozent an einer Angsterkrankung. Ihr Körper reagiert auf Situationen, die objektiv betrachtet völlig ungefährlich sind. Das sind Menschen, die Angst vor schweren Krankheiten haben und bei den kleinsten Anzeichen von Veränderung die Hautärztin oder den Frauenarzt aufsuchen. Menschen, die sich nicht mehr trauen, mit dem Auto zu fahren, die jeden Stau meiden, die die Enge der U-Bahn kaum ertragen. Menschen, die Angst vor fremdem Essen oder vor Gesprächen mit ihren Mitmenschen haben. Die das Erbrechen in der Öffentlichkeit fürchten, Begegnungen mit anderen Menschen als Qual empfinden und das Haus aus Angst vor der lauten, verstörenden Welt da draußen nicht mehr verlassen wollen.
Wenn die Angst zu groß wird, der Alltag stark beeinträchtigt ist und der Angsthase eigentlich die Welt entdecken will, die Angst ihm aber permanent das Stoppschild hinhält, ist es so weit: hallo, Angststörung!
Angststörungen sind grundverschieden, haben aber zumindest eines gemeinsam: Sie belasten das Leben der Betroffenen.
Wie viele Menschen wirklich unter übersteigerter Angst leiden, weiß kaum einer, denn Angstpatient*innen leben lieber unerkannt. Dabei hilft es, die Monster der Angst zu vertreiben, indem man offen über sie spricht, sie nicht für sich behält, sondern mit Menschen an seiner Seite gegen sie ankämpft.
Mutig ist also nicht, wer vermeintlich furchtlos durchs Leben geht, sondern wer sich seinen Ängsten stellt, ihnen ins Gesicht blickt und fragt: „Hallo Angst, was willst du eigentlich?“