

Abenteuer Elbsandsteingebirge – Im Reich der wilden Felsen Abenteuer Elbsandsteingebirge – Im Reich der wilden Felsen - eBook-Ausgabe
„Sie geht der Vergangenheit von Burgen und Schlössern auf den Grund, taucht ein in unheimliche und doch faszinierende Nebelmeere und fantasievolle Geschichten, die sich um das einmalige Naturparadies ranken.“ - Dresdner Neueste Nachrichten
Abenteuer Elbsandsteingebirge – Im Reich der wilden Felsen — Inhalt
Streifzüge durch eine sagenhafte Landschaft
Carmen Rohrbach führt den Leser auf facettenreichen Wanderungen durch das wildromantische Elbsandsteingebirge und den Nationalpark Sächsische Schweiz. Schon als Kind war sie von dieser Region fasziniert und entdeckte dort als Teenager das Klettern für sich.
Auf ihren Touren kommt sie mit Rangern, Hüttenwirten und Wanderern ins Gespräch und berichtet über die Entstehung der geheimnisvollen Landschaft.
Mal in Begleitung ihres Bruders, mal mit ihrem Partner folgt sie dem Malerweg, wandert durch Täler, zu Felsnadeln und auf Tafelberge. Sie geht der Vergangenheit von Burgen und Schlössern auf den Grund, taucht ein in Nebelmeere und fantasievolle Geschichten, die sich um das einmalige Naturparadies ranken.
„Carmen Rohrbach ist eine ausgezeichnete Beobachterin.“ DIE ZEIT
Mit 24 Seiten Farbbildteil und einer Karte
Leseprobe zu „Abenteuer Elbsandsteingebirge – Im Reich der wilden Felsen“
Vorwort
Die frühe Sonne beleuchtet abenteuerliche Felsgestalten, mystisch umspielt von Nebelschleiern. Rauschend stürzen Bäche zwischen Klüften hinab in dunkle Täler. An senkrechte, von Flechten bunt gefärbte Felsen klammern sich Moose und Farne, weben einen grünen Pelz. Bizarre Felsnadeln ragen hinauf in den Himmel. Es ist eine Märchenlandschaft, wie nicht von dieser Welt.
Erinnerungen steigen aus dem Dunkel der Vergangenheit in mir auf, und eine Ahnung von Glück erfasst mich. Jahrzehnte sind vergangen, seit ich in diesem zerklüfteten Felsengebirge meine [...]
Vorwort
Die frühe Sonne beleuchtet abenteuerliche Felsgestalten, mystisch umspielt von Nebelschleiern. Rauschend stürzen Bäche zwischen Klüften hinab in dunkle Täler. An senkrechte, von Flechten bunt gefärbte Felsen klammern sich Moose und Farne, weben einen grünen Pelz. Bizarre Felsnadeln ragen hinauf in den Himmel. Es ist eine Märchenlandschaft, wie nicht von dieser Welt.
Erinnerungen steigen aus dem Dunkel der Vergangenheit in mir auf, und eine Ahnung von Glück erfasst mich. Jahrzehnte sind vergangen, seit ich in diesem zerklüfteten Felsengebirge meine jugendlichen Kletterabenteuer erlebte. So jung war ich, mit der Sehnsucht nach fernen Ländern im Herzen. Ein Kind noch, dennoch bereits mit glühendem Verlangen erfüllt. Über den Horizont hinaus wollte ich wandern, die einschnürenden Grenzen überwinden, ein Leben in Freiheit führen.
Das Klettern im Elbsandsteingebirge gab mir Kraft, meine Träume nicht aufzugeben. In der Natur gewann ich inneren Halt, die schmerzhafte Sehnsucht zu zügeln, mein verzehrendes Begehren zu ertragen, nach der Ferne, nach den Bergen der Welt. Während des Kletterns konnte ich mich ganz dem gewagten Spiel am senkrechten Fels, der artistischen Balance am rauen Gestein hingeben, mit den Füßen Vertiefungen ertasten, Vorsprünge mit den Händen greifen, mich immer höher und höher hangeln und dann – oben am Gipfel angekommen – mich auf den sonnenwarmen Fels setzen, die Beine über dem Abgrund baumelnd, schweigend über die Baumwipfel blicken und weit hinaussehen zu den in der Ferne bläulich schimmernden Höhenzügen des Erzgebirges und den Bergen der Lausitz. In diesen Augenblicken war meine innere Unruhe gestillt, und zugleich fühlte ich mich lebendig wie sonst nie. Das gemeinsame Schweigen mit den Kletterkameraden verband uns, wir mussten nicht über unsere Gefühle reden, hätten wohl auch nicht die Worte dafür gefunden.
Meine Erinnerungen an das Elbsandsteingebirge reichen aber noch weiter zurück, in meine früheste Kindheit, deren Farben jedoch verschwommen sind. Die Konturen sind von Unschärfe verzerrt, die Formen kaum noch sichtbar. Darum kann ich nicht beurteilen, ob ich mich wirklich erinnere oder ob mein Rückblick erst durch die Schwarz-Weiß-Fotos im Familienalbum genährt worden ist. Die Aufnahmen zeigen Wanderungen mit den Eltern. Ich war noch zu klein, um mithalten zu können. Mein Vater hatte einen Tragekorb gebastelt, geflochten aus Weidenzweigen, und ihn sich mit Gurten auf den Rücken gebunden. Darin saß ich, etwa zwei Jahre alt, fröhlich lachend, und streckte meine Hände nach den Felsgipfeln aus.
Andere Bilder zeigen mich, als ich fünf Jahre zählte, mit Alma und Bruno, den Eltern meiner Mutter, bei einem Ausflug auf der Bastei. Schon damals war die Bastei mit ihrer bereits im Jahr 1850 erbauten 76 Meter langen Brücke, die sich mit sieben gemauerten Bögen über zerklüftete Felsen spannt, ein beliebtes Ausflugsziel. Berühmt für ihren grandiosen Blick ins weite Tal der Elbe, auf der Dampfer zu sehen waren, winzig klein wie Spielzeuge.
Als fünfjähriges Kind war ich wohl weniger an diesen Aus- und Fernblicken interessiert, jedenfalls habe ich keine Erinnerungen daran. Ich erinnere mich dagegen lebhaft an Langeweile und Enttäuschung, denn diese Spritztour war ganz und gar nicht nach meinem Geschmack. Die Großeltern hatten ihre Sonntagskleider an, und auch ich war herausgeputzt worden. Mit Opas Auto, einem alten Opel, einem der wenigen, die es in der DDR gab, fuhren wir bis zum Parkplatz an der Bastei, liefen eine breite Fahrstraße entlang, spazierten über die Brücke, schauten ringsum, und dann ging es hinein in die Gaststätte, wo ich einen Kuchen essen musste. Schon damals mochte ich nichts Süßes. Viel lieber wäre ich in der Felsenwelt herumgestromert, die greifbar vor mir lag und mir dennoch verschlossen blieb. Ich sah Leute dort wandern, das wollte ich auch. Zwischen die Felsen und in die tiefen Täler wollte ich hinein, nicht sie von oben betrachten. Ich vermute, die Großeltern haben mich nicht allzu oft auf ihre Autofahrten mitgenommen. Sicherlich habe ich meinen Ärger heftig kundgetan. Von Anfang an hatte ich einen eigensinnigen Charakter und war kein fügsames Kind.
Bis ich 14 Jahre alt wurde, lebte ich dann mit meinen Eltern und Geschwistern weit entfernt in Freyburg im Unstruttal. Nachdem wir in die Lausitz zurückgekehrt waren, erblickte ich die bizarren Felsen erstmals wieder bei einem Klassenausflug im neunten Schuljahr. Wir hatten die Strecke von Bischofswerda bis zur Bastei mit Fahrrädern zurückgelegt. Es war ein sonniger Tag mit klarer Fernsicht. 200 Meter fiel der Basteifelsen senkrecht in die Tiefe ab. Unten vollführte die Elbe eine schwungvolle Doppelschleife und glitzerte silbern im Sonnenlicht. Die Tafelberge Lilienstein und Königstein erhoben sich majestätisch aus der Ebene. Links vom Königstein war der Pfaffenstein sichtbar mit seinen bewaldeten Hängen. In der Ferne konnte man die Kammlinie des Erzgebirges erahnen. Westlich ragte das Felslabyrinth der Schrammsteine auf und im Süden der Große Winterberg. Im Norden erstreckte sich das Lausitzer Bergland mit seiner höchsten Erhebung, dem 586 Meter hohen Valtenberg. Dort in der Lausitz waren wir mit unseren Rädern gestartet.
In den zerklüfteten Felsen nahm ich eine Bewegung wahr. Ich sah genauer hin. Das konnte doch nicht sein – es waren Menschen. Sie hingen an senkrechten Wänden.
„Was machen die dort?“, fragte ich unseren Klassenlehrer.
„Ach so, das sind Kletterer“, antwortete er lakonisch.
„Was? Warum? Wieso? Was wollen sie in den Felsen?“
„Das ist Sport!“
Zwar wusste ich, dass Menschen auf hohe Berge steigen, aber noch nie zuvor hatte ich gehört, dass man sich an senkrechten Felsen emporarbeiten kann. Obwohl die Lausitz an das Elbsandsteingebirge grenzt, wusste ich nicht, dass es den Klettersport gibt. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir erst seit wenigen Wochen wieder hier wohnten.
„Ich möchte das auch machen!“, rief ich spontan aus. Denn blitzschnell hatte ich begriffen, was das für eine Lust sein musste, sich zwischen Himmel und Erde zu bewegen.
Mein Lehrer aber meinte: „Das ist eine ganz besondere Kunst. Die kann man nur lernen, wenn man sehr früh damit anfängt. Das ist so wie im Zirkus, die Artisten müssen von klein auf üben.“
Nanu, dachte ich, meint er denn, mit 14 sei ich zu alt?
Egal ob ich nun zu alt war oder nicht, ich wusste, ich wollte es unbedingt probieren. Mir war jedoch klar: Allein konnte ich es nicht schaffen, ich brauche jemanden, der es mir zeigte. Nicht ich, sondern meine Schwester entdeckte die „Pilztürmer“, die sich nach einem der Felsen so genannt hatten. Meine Schwester wandte sich bald wieder anderen Interessen zu, ich aber lernte klettern, und es wurde zu einer meiner Leidenschaften.
Jahre später konnte ich tatsächlich meine Träume von damals verwirklichen und die Berge der Welt sehen: den Himalaja in Nepal, in Afrika den Kilimandscharo. Am Kraterrand übernachtete ich in einem Zelt und stieg erst nach drei Tagen wieder hinunter in die heiße afrikanische Steppe. Der Mount Kenya, ebenfalls in Afrika, hat senkrechte Felswände. Mit Bergsteigerfreunden umrundete ich den Berg, war fasziniert von der eindrucksvollen Vulkanlandschaft, bestaunte die pittoresken, baumhohen Senecien, und schließlich kletterte ich mit den Kameraden mit Seil und Haken auf diesen fast 5000 Meter hohen Gipfel.
Nur im Elbsandsteingebirge, meiner ursprünglichen Heimat, bin ich nicht mehr geklettert. Weil ich versucht hatte, über die Ostsee nach Dänemark zu schwimmen, bekam ich nach Haft und Ausweisung keine Einreise mehr in die DDR, war als „unerwünschte Person“ diskreditiert. Nachdem Ost und West endlich wieder ein Deutschland waren, galten meine Reisen in den Osten stets dem Besuch von meiner Mutter und meinen Geschwistern. Bei diesen Familientreffen stand mir nicht der Sinn nach Klettertouren, zudem hatte ich nach all den Jahren keinen Kontakt mehr zu den ehemaligen Kameraden.
Warum aber jetzt ein Buch über das Elbsandsteingebirge? Dieser Felslandschaft muss ein Zauber innewohnen. Als seien unsichtbare Fäden gesponnen worden, tauchen vergessen geglaubte Erinnerungen in meinem Gedächtnis auf, vernehme ich wieder geheimnisvolle Töne, werde vom murmelnden Geräusch eines Gebirgsbachs berührt, höre das Rauschen der Bäume in tiefen Felsschluchten, als sei es erst gestern gewesen.
Jedoch: Dass ich mich entschloss, mein neues Buch dem Elbsandsteingebirge zu widmen, verdanke ich meinem Bruder Holger. Nachdem wir in Kasachstan im Alatau-Gebirge waren und darüber gemeinsam ein Buch geschrieben hatten, schlug er vor, das geglückte Gemeinschaftswerk im Elbsandsteingebirge zu wiederholen. Allerdings wollten wir nicht felsklettern, sondern uns wandernd das Gebiet erschließen.
In meinem Buch verwende ich für die Felsenheimat ausschließlich die Bezeichnung „Elbsandsteingebirge“. Gewiss, der Name „Sächsische Schweiz“ ist allgemein gebräuchlich und hat sich fest etabliert. Es waren in der Tat zwei Schweizer, die diesen Ausdruck geprägt haben. Adrian Zingg (1734–1816) und Anton Graff (1736–1813) waren nach Dresden gekommen und unterrichteten dort an der Kunstakademie. Da lag es nahe, dass die beiden Maler das unweit entfernt liegende Felsengebirge für sich entdeckten, dort Motive für ihre Landschaftsmalerei fanden und einen Namen kreierten, der ihre Heimat – die Schweiz – mit ihrer Wahlheimat – Sachsen – verband.
Die Schweizer hatten einen publikums-, also werbewirksamen Begriff geschaffen, mit dem der Fremdenverkehr angekurbelt werden konnte. Das zuvor wenig beachtete Gebiet wurde interessant, weil die Schweiz als Urlaubsort bereits bekannt und berühmt war. Wenn es so etwas wie die Schweiz quasi vor der Haustür geben sollte, machte das neugierig. Wer wollte sie nicht mitten in Sachsen erleben und bestaunen? Noch heute wird diese werbende Wirkung für den Tourismus benutzt. Deshalb lässt sich dieser für mich falsche Begriff nicht mehr wegdiskutieren. Ich aber verwende ihn nicht! Zum einen mag ich keine Vergleiche, weder bei Menschen, Büchern noch bei Landschaften. Jedes Ding, jede Person ist für sich einzigartig und unvergleichbar. Das Elbsandsteingebirge ist einmalig und braucht keine aufwertende Metapher. Zudem liegt die richtige Bezeichnung offen zutage, man braucht nicht extra eine zu erfinden. Sie ergibt sich aus den geologisch-geografischen Gegebenheiten. Da ist der Strom, die Elbe, die diese ganz besondere Mittelgebirgslandschaft gestaltend durchfließt. Und woraus bestehen diese Felsen? Aus Sandstein, vor Jahrmillionen aufgeschichtet und verfestigt. Kann es einen treffenderen Namen geben als „Elbsandsteingebirge“?
Es ist kein hohes Gebirge, sondern ein zerklüftetes und zerschnittenes Tafelland, das wie von Riesenhand gemeißelt erscheint, zuvor aber von den Kräften im Erdinneren gehoben, geschoben, gequetscht, gedrückt und zerbrochen wurde. Sodann hat es die Erosion in Jahrmillionen wie ein Bildhauer geformt. So sind Skulpturen aus Sandstein entstanden: Türme, Säulen, Nadeln, Klippen und Riffe, Tafelberge, Plateaus und Felsentore, aber auch Schluchten, Klüfte und Höhlen.
Der höchste Berg ist der Hohe Schneeberg, auf Tschechisch Dĕčínský Snĕžník, der mit 723 Metern im böhmischen Teil aufragt. Nach Norden neigt sich das Bergland, niedergedrückt durch die Lausitzer Granitplatte. Am niedrigsten ist es in der Gegend von Pirna mit etwa 200 Höhenmetern.
Die Elbe hat sich in Tausenden von Jahren ihren Weg mitten durch das Felsenreich gebahnt und es in rechts- und linksseitiges Gebiet geteilt. Auf der linken Seite liegt das Bielatal mit berühmten Kletterfelsen wie den Herkulessäulen und den meisten Tafelbergen, die aus der Ebene wie Inseln herausragen. Rechtselbig erstreckt sich der 1990 gegründete Nationalpark. Diese Region ist noch immer ein kaum von Menschen besiedeltes Fels-Waldgebiet.
Was ist das Besondere am Elbsandsteingebirge? Warum wirkt gerade diese Landschaft auf uns Menschen so anziehend? Warum erscheint sie uns so einzigartig? Ich denke, diese Wirkung ergibt sich aus der Gesamtheit ihrer Merkmale: Da ist zum einen die Entstehung über schier unvorstellbar lange Zeiträume aus einem kreidezeitlichen Meer. Zum anderen sind das die bizarren Felsskulpturen, von den Kräften der Natur modelliert, gestaltet und verändert. Und wenn wir genau hinschauen, können wir diesen fortwährenden Prozess wahrnehmen. Weiterhin finden wir in diesem waldreichen Felsengebiet eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt, die andernorts schon selten geworden oder ganz verschwunden ist. Es ist die Heimat von im Verborgenen lebenden Vögeln wie Schwarzstorch, Uhu, Sperlingskauz, Wanderfalke und weiteren 250 Vogelarten.
Im Buch ließen sich Wiederholungen nicht vermeiden. Geologische und geschichtliche Fakten habe ich bei den voneinander unabhängigen Wanderbeschreibungen mehrmals mitgeteilt, damit diejenigen Leser, die das Buch bei ihren eigenen Touren dabeihaben, sich in dem jeweiligen Kapitel umfassend informieren können.
Wie bereits in meinem Buch Mein Ammersee war ich auch im Elbsandsteingebirge im Sommer, Herbst, Winter und Frühling unterwegs. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Reize, ihre eigene Ausstrahlung und Schönheit. Wir müssen nicht in die Ferne reisen und exotische Länder besuchen, auch in unserer Heimat können wir uns an ursprünglicher Natur erfreuen und Abenteuer erleben. Vielleicht weckt mein Buch bei Ihnen den Wunsch, das Elbsandsteingebirge und das märchenhafte Elbtal mit eigenen Augen zu sehen und wandernd in die Natur einzutauchen. Bevor Sie sich aber auf den Weg begeben, möchte ich Sie beim Lesen mitnehmen auf meine Art des Unterwegsseins.
Wanderungen im Sommer
Die Zuordnung der Wanderungen zu den einzelnen Jahreszeiten ist zufällig. Ich habe sie nicht danach ausgewählt, welche sich für den Sommer oder den Winter, den Herbst oder Frühling besser eignen würden. Im Elbsandsteingebirge ist es zu jeder Zeit möglich zu wandern, allerdings ist es nicht zu empfehlen, an kalten Wintertagen eine schwere Route zu gehen, denn dann sind die Stufen vereist und die Felsen gefährlich glatt.
Mein Buch ist kein Wanderführer, davon gibt es bereits ein reiches Sortiment, sondern eine Erlebnisschilderung, die meine Freude an der Natur mit Ihnen, meinen Lesern, teilen und Ihnen diese faszinierende Felsenwelt näherbringen möchte.
Die Auswahl der beschriebenen Sommertouren entstand auf Empfehlung meines Bruders Holger und in Absprache mit unseren Begleitern, seinem Sohn Daniel und dessen Freundin Karolina.
Bielatal: Zu den Herkulessäulen im Reich der wilden Felsen
Äste brechen. Bäume wogen im Sturm, werden entwurzelt und übereinandergeworfen wie Mikadostäbchen. In der Luft ist ein Brausen und Toben. Wildes Geheul hallt durch den Wald, bricht sich an den Felsen, wird von ihnen vielfach verstärkt zurückgeworfen. Es ist die „Wilde Jagd“, die durch das Bielatal tobt. So erzählt es eine der Sagen, die sich hier im Reich der Felstürme zugetragen haben soll. Entstanden ist sie in früheren Zeiten, als sich Menschen den Naturgewalten ausgeliefert fühlten und es noch Raubritter gab, die in Burgen hausten. Von den meisten dieser Burgen künden nur noch Ruinen auf Felsklippen.
Von der „Wilden Jagd“ des auf ewig verfluchten Ritters und der Meute seiner Bluthunde bleiben wir verschont. Dafür sucht uns am späten Nachmittag ein heftiges Gewitter heim. Vorerst aber spannt sich ein blauer Himmel über uns. Keine Wolke ist zu sehen, und die Sonne scheint angenehm warm auf den von Bäumen beschatteten Wanderweg. Wir sind zu fünft. Außer meinem Bruder Holger sind sein Sohn Daniel, der aus Amerika zu Besuch ist, und dessen Freundin Karolina mit von der Partie. Ich bin aus Bayern angereist. Zudem gehört zu uns Ora, Holgers Jagdhündin, die durchaus als Persönlichkeit zu zählen ist.
Holger hat unseren Aufenthalt vorbereitet, eine Unterkunft für mehrere Tage in einer Pension auf der Ostrauer Höhe gebucht. So heißt eine der Hochflächen über dem rechten Elbufer. Auch Tourenvorschläge hat Holger ausgearbeitet. Deren erster führt uns ins Bielatal, benannt nach dem gleichnamigen Fluss, der bei Königstein in die Elbe mündet. Die Quelle der Biela befindet sich am Hohen Schneeberg. Dieser Berg ist mit 723 Metern der höchste Gipfel des Elbsandsteingebirges. Er liegt auf tschechischer Seite in Böhmen. Aus der slawischen Sprache stammt auch der Name des Flusses. Denn Biela leitet sich von běla wóda her. Übersetzt bedeutet es: „weißes Wasser“, wahrscheinlich weil es durch starkes Gefälle weiß schäumend bergab eilt. Es gefällt mir sehr, dass unsere gemeinsame Tour mich ins Bielatal führt, denn gerade mit diesem Tal verbinden sich für mich unvergessliche Klettererlebnisse.
Das Tal erstreckt sich links der Elbe von Süd nach Nord und folgt in seinem Verlauf der Biela, die es aus dem Felsen herausgekerbt hat. Es ist das Reich imposanter Felsformationen, geschaffen von der Verwitterung durch Wasser mithilfe von Frost und Wind. Türme, Säulen, Nadeln reihen sich aneinander, getrennt durch Klüfte, Spalten, Schluchten. Bizarr ragen diese steinernen Formen aus bewaldeten Hängen und bilden einen starken Kontrast zu dem lieblich anmutenden Flusstal.
Es ist ein sonniger Tag im Juli. Von unserer Unterkunft rechts der Elbe fahren wir über die Elbbrücke ins Rosenthal, stellen das Fahrzeug auf einem der zahlreichen Parkplätze ab und beginnen die Wanderung das Tal aufwärts zunächst auf einem asphaltierten, breiten Weg Richtung Schweizermühle.
Bereits im 15. Jahrhundert wurde hier die Wasserkraft für ein Hammerwerk genutzt. Mächtige Hämmer wurden bewegt, um Eisenerz zu verarbeiten. Nicht weit entfernt, bei Berggießhübel wurde Magnetit gewonnen, hochwertiges Eisen. Die urkundlich älteste Hammerhütte im Bielatal datiert von 1410. Die Verarbeitung des Eisens und die zahlreichen Verhüttungsanlagen haben wesentlich zur Besiedlung des Tals beigetragen. Davon ist heute nichts mehr spürbar. Kaum noch jemand wohnt hier, das Tal wirkt abgeschieden und verlassen.
Nachdem die Verhüttung unrentabel geworden war, gab es einmal noch einen Aufschwung, als 1837 eine Kaltwasserheilanstalt eingerichtet wurde. Patienten und zahlungskräftige Kurgäste ließen sich nach dem Heilverfahren von Vincenz Prießnitz (1799–1851) behandeln. Nach ihm ist auch der „Prießnitz-Wickel“ benannt, ein kalter Umschlag, den ich aus meiner Kindheit kenne. Bei Fieber legte meine Mutter mir unangenehm eiskalte Lappen um die Waden, die erneuert wurden, sobald sie heiß und trocken geworden waren.
Die Heilanstalt wurde von Oberhüttenmühle in Schweizermühle umbenannt, weil sich inzwischen die Bezeichnung „Sächsische Schweiz“ werbewirksam für das Elbsandsteingebirge eingebürgert hatte. Heute wird hier niemand mehr mit kalten Güssen behandelt. Der Name und einige Gebäude sind erhalten geblieben, andere dem Verfall preisgegeben. Übrigens hat Sebastian Kneipp (1821–1897), der ein ähnliches Heilverfahren entwickelt hat, fast zeitgleich mit Vincenz Prießnitz gelebt, ist aber ungleich bekannter.
Wir verlassen den breiten Talgrund und folgen einem bewaldeten Pfad linksseitig den Hang hinauf. Mein Bruder löst Ora von der Leine, was diese freudig begrüßt. Sie eilt voraus, kehrt bald darauf um. Schaut, ob wir folgen, und spurtet wieder nach vorn, legt also die Strecke mehrfach zurück. Der Weg schlängelt sich hinauf, dann wieder abwärts. Ein Verirren ist nicht möglich. Wegmarkierungen – für meinen Geschmack überreich – geleiten uns durch den Wald. Sowohl ein blauer Strich als auch ein gelber Punkt, auf Baumstämme und Steine gepinselt, weisen uns die Richtung. An Weggabelungen gibt eine Fülle von Schildern Auskunft. Obwohl es also gar nicht nötig wäre, befragen Daniel und Karolina ihre Smartphones. Holger und ich dagegen haben eine Wanderkarte dabei. Für die Wegfindung brauchen wir sie nicht. Mir gefällt es aber, auf einer Karte zu betrachten, wie dort die Landschaft mit ihren Höhenlinien, Schraffierungen, Tälern und Felsgipfeln dargestellt ist. Die digitalen Karten von Google dagegen sind zu abstrakt und vereinfacht, wie ich bei einem Blick darauf feststelle, eine Vorstellung von der Wirklichkeit geben diese schematischen Darstellungen nicht.
Ab und zu führt der Pfad aus dem Wald heraus zu einem der Felsplateaus mit freiem Blick über die Bäume hinweg. Wie Perlen an einer Schnur reihen sich diese Fernblicke aneinander. Auf einem dieser Aussichtspunkte steht ein Pavillon am Rand eines Felsabbruchs und bietet so einen Rundblick in alle Himmelsrichtungen. Er wurde bereits 1880 gebaut und trägt die Bezeichnung „Kaiser-Wilhelm-Feste“. Und tatsächlich ähnelt der viereckige Steinbau, oben mit seinen Zinnen, einer Bastion. Der Architekt hat das Bauwerk dem damaligen Herrscher Kaiser Wilhelm I. gewidmet. Natürlich musste diese kleine Bergfeste seitdem immer mal wieder restauriert werden. Das bisher letzte Mal im Jahr 2018, als das Dach erneuert wurde. Das gesamte Material schleppten die Bauarbeiter auf ihrem Rücken schmale Wanderwege bergauf.
Auf unserer Karte, obwohl neueren Datums, ist noch der alte Name verzeichnet. Auf den Smartphones unserer jugendlichen Begleiter heißt das Bauwerk Bielablick. Der Name passt, denn unten windet sich die Biela durch den Wald, aus dem bizarre Felsgestalten herausspitzen. Einige von ihnen sind so fragil, dass sie jederzeit zusammenstürzen und umfallen könnten. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass es geschehen wird, denn das Elbsandsteingebirge ist in ständiger Veränderung begriffen.
Weiter geht es gemütlich auf markierten Wegen. Karolina und Daniel geben das Tempo vor, und Ora läuft zwischen ihnen und uns, also Holger und mir, hin und her, bemüht, ihre „Herde“ zusammenzuhalten. Kommen uns Wanderer entgegen, ruft mein Bruder seinen Hund mit einem für meine Ohren kaum hörbaren Pfiff zurück, besser gesagt mit einem Zischen durch die Zähne. Ora zögert nie und trollt sich sofort an seine Seite. Er hat sie gut trainiert. Bei der Jagd muss er sich auf sie verlassen. Niemals würde sie einer Reh- oder anderen Wildfährte folgen, wie es andere Hunde tun, es sei denn, Holger erlaubt es ihr ausdrücklich. Ich habe erlebt, wie sie mucksmäuschenstill unter dem Hochsitz lag, ohne sich zu rühren oder gar zu bellen, selbst wenn Rehe dicht an ihr vorbeizogen. Ihr Körper vibrierte, angespannt wie eine Stahlfeder. Wie gern wäre sie aufgesprungen, um das Wild zu verfolgen, doch sie verwendete alle ihre Kraft und Energie darauf, es nicht zu tun. Eine beachtliche Leistung von einem Hund – und meinem Bruder, der sie zu einer verlässlichen Gefährtin erzogen hat.
Wäre ich allein, würde ich nicht so rasant unterwegs sein, nicht weil ich körperlich zu schwach dazu wäre, sondern weil ich es schade finde, die Umgebung nicht mit all meinen Sinnen wahrnehmen zu können. Mir macht die Wanderung dennoch Spaß, weil ich mich auf das sportliche Unterwegssein einstellen kann. Daniel hatte mir zuvor erzählt, dass er in seiner Wahlheimat, den USA, mit seiner Freundin anspruchsvolle Touren in den Bergen gemacht hat, deshalb sind sie bestens trainiert.
Wald beschattet den Pfad und verbirgt die Sicht, doch dann zweigt der Weg rechts ab, hinaus in die Felsregion – und da sehe ich sie! Was für faszinierende Gebilde. Mächtige Felsnadeln ragen wie verwitterte Standbilder in den Himmel. Leicht windschief und mit viel zu schweren Köpfen. Dadurch wirken sie stark und zerbrechlich zugleich. Es sind die markanten Wahrzeichen des Bielatals: die Herkulessäulen! Es sind zwei, die Große und die Kleine. Zwei schlanke, frei stehende Türme mit einem oben wie aufgesetzt wirkenden Kopf. Den Namen erhielten sie 1826 von dem Heimatforscher Carl Merkel, der sich an der Antike orientierte. Die Berge, die beidseits der Straße von Gibraltar aufragen, wurden damals als „Säulen des Herkules“ bezeichnet. Eigentlich müsste es Herakles heißen, aber der Held aus der griechischen Sagenwelt wurde später von den Römern, die fast alle Götter und Sagengestalten der Griechen übernommen haben, Herkules getauft, und dieser Name hat den ursprünglichen verdrängt.
Die Säulen sind 20 Meter hoch und erheben sich zudem auf einem 35 Meter messenden Talsockel. Aus Ablagerungen im kreidezeitlichen Meer entstanden, ist der linkselbische Sandstein im Bielatal besonders hart und deshalb ziemlich widerstandsfähig gegen Verwitterung. Geologen bezeichnen ihn als Labiatussandstein. So erklärt sich, dass die vom Plateau losgelösten Felsformationen dermaßen standfest sind. Jedenfalls bis zum jetzigen Zeitpunkt. Irgendwann werden die fragilen Türme niederstürzen, bis dahin gelten sie als beliebte Kletterfelsen. Das Bielatal ist reich an ihnen, über 250 sollen es sein, und an jedem gibt es mehrere Aufstiegsmöglichkeiten, von Kletterern als „Wege“ bezeichnet, obwohl die senkrechten Routen nichts mit Wegen zu tun haben. An der Kleinen Herkulessäule allein gibt es 14 Wege, entsprechend der sächsischen Schwierigkeitsskala reichen sie von IV bis VIIIb.
Einen davon, den „Alten Weg“, bin ich in meiner Jugend geklettert. Ich erinnere mich daran, als sei es gerade erst gewesen, denn es war das erste Mal, dass ich es gewagt hatte vorzusteigen. Wer nachsteigt, ist durch das Seil des Voraussteigenden gesichert. Zudem muss er nicht selbst die Route finden und Sicherungen anbringen, sondern folgt ganz einfach dem Verlauf des Seils. Rutscht man ab, spannt sich sofort das Seil. Das Risiko ist beim Vorausstieg ungleich größer. Wer da den Halt verliert, fällt und fällt, bis ihn, wenn er Glück hat, eine der vorher angebrachten Sicherungen ruckartig bremst. Wer aber immer nur nachsteigt, dem entgeht das wahre Klettergefühl, der tritt nicht wirklich in Austausch mit dem Fels, lernt nicht, all die Probleme und Schwierigkeiten zu bewältigen.
Die Freunde protestierten damals. Behaupteten, der Weg sei zu schwer. „Du hast zu wenig Erfahrung! Klettere doch lieber nach, da bist du sicher. Das schaffst du nie!“
Ihr Widerspruch feuerte mich erst recht an. Als Einziger hielt Stefan zu mir: „Lasst es sie doch wenigstens versuchen!“
Ich wollte! Mich selbst testen, mein Können, meine Grenzen ausloten. Und meine Angst überwinden. Denn Angst, die hatte ich! Es wäre so einfach, so viel bequemer, mich immer nur mit dem Nachstieg zu begnügen. Doch Angst ist dazu da, sich ihr zu stellen, so dachte ich schon damals. Im Nachstieg war ich bereits bis zum sechsten Grad geklettert, da sollte doch eine Vier im Vorstieg zu schaffen sein!
Nach wenigen Metern fühlte ich mich wie eine Zirkusartistin ohne Netz. Verzweifelt tastete ich das Gestein nach Vertiefungen ab, suchte verkrampft, wo ich eine Sicherung anbringen könnte. Am besten in einer „Sanduhr“, also einer Aushöhlung, um die ich eine Schlinge hätte legen können. Wir kannten damals noch keine „Friends“, verschieden große und kleine Metallteile, um sie in Spalten und Rissen zu verankern, und sie sind im Elbsandsteingebirge bis heute verboten, um das Gestein zu schonen. Wir verwendeten Band- und Knotenschlingen.
Ich spürte, wie mich die Wand nach draußen drängte, mich abwerfen wollte, wie es ein störrisches Pferd mit einem unliebsamen Reiter tut. Meine Knie wurden weich, die Beine fingen an zu zittern. Eisiges Erschrecken, weil ich mir vorstellte, aus dieser Höhe ungesichert herabzustürzen wie ein Stein. Dann wäre ich vielleicht tot, in jedem Fall schwer verletzt. Die Angst verwandelte sich in hilflose Wut. Beide Arme ausgebreitet, die Finger an winzige Vorsprünge gekrallt, mit den Fußspitzen auf einer schmalen Felsleiste, so klebte ich an der Wand und kam nicht vor und nicht zurück. Meine Finger wurden feucht, drohten abzurutschen. Gleich würde ich stürzen.
„Du schaffst es!“, hörte ich Stefans Stimme. „Lehn dich nicht so dicht an den Fels!“
Er kann gut reden, dachte ich verzweifelt.
„Biege deinen Körper mehr nach außen, dann stehst du sicherer, und du kannst den nächsten Griff sehen“, erklang es wieder von unten. „Da rechts, dort ist ein Tritt. Ein wenig höher! Ja! Noch höher! Jetzt hast du ihn, und nun gleich weiter! Mit der linken Hand nach oben, dort ist ein Loch, tief genug für deine Finger.“
Endlich entdeckte ich einen Metallring, den jemand ins Gestein gebohrt hatte, und konnte den Karabiner mit der Schlinge einhängen, die erste Sicherung. Ich atmete tief. Fühlte mich gerettet. Das Zittern hörte auf.
Jede weitere Sicherung, die ich anbringen konnte, gab mir neuen Mut. Allerdings – zuvor hatte ich nicht geahnt, wie schwer das Seil ist, das nach unten hängt und das ich hinter mir herzog. Je höher ich stieg, umso schwerer und schwerer wurde es. Es störte mich sehr. Ich verfluchte das Gewicht des herabhängenden Seils. In luftiger Höhe am Fels balancierend, behinderte es mich beträchtlich. An schwierigen Stellen drohte es mich herabzuziehen.
Der Überhang am „Kopf“ der Herkulessäule war eine letzte Herausforderung. Auch die schaffte ich. Auf dem Gipfel angekommen, sicherte ich mich am dort verankerten Ring und holte Stefan nach. An der Felskante tauchte sein Kopf auf. Die schwarzen Haare hingen ihm wirr ins Gesicht, er strahlte, und seine blauen Augen leuchteten: „Haste aber doll gemacht!“
Ich war verliebt in Stefan, den Physikstudenten. Leider sah er in mir, der damals 16-Jährigen, ein kleines Mädel.
Der Felsgipfel ist nur wenige Meter groß. Als die andere Seilschaft auch nach oben geklettert war, fanden vier Menschen kaum genug Platz. Die Rücken aneinandergestemmt, die Beine über dem Abgrund baumelnd, waren wir erfüllt vom Erlebnis und ließen den Moment schweigend in uns schwingen.
Und da bin ich also wieder! Nach so vielen Jahren – und erlebe meine Jugend, als sei sie gerade erst gewesen.
Es geht weiter über die Felsen, auf abenteuerlichen Wegen fast in Gipfelhöhe an den Säulen vorbei, aber durch einen tiefen Abgrund getrennt. Auf Stiegen und Leitern müssen wir noch einmal hoch hinauf und dann wieder tief hinab. Ein Pfad ist es eigentlich nicht, nur ein schmaler Raum zwischen Felswand und Kluft. In einer Felsnische hat der Wanderverein eine Holzbank installiert, von der aus man in Ruhe die Herkulessäulen betrachten kann. Gerne würde ich dort auf der Bank rasten und Daniel und Karolina von meinem damaligen Klettererlebnis berichten. Doch die beiden eilen voran. Halten nicht inne. Mir erschließt sich nicht, warum sie so durch die eindrucksvolle Natur hasten, als seien sie mit sich selbst im Wettkampf. Als ich Daniel zurufe: „Schau mal, dort oben war ich“, und auf die Felsspitze zeige, meint er, sich kurz umblickend: „Ach, ja? Wirklich?“
Rechts und links körpernah von Fels umgeben, steigen wir in eine Felsspalte hinein, immer weiter abwärts, dann ist kein Fels mehr, nur noch eine tiefe Kluft, über die eine Metallleiter gespannt ist. Für Ora allein nicht zu bewältigen. Wie gut, dass sie Holger voll vertraut. Sie würde ihm wohl überallhin folgen. Mein Bruder steigt rückwärts die Sprossen hinab, und der Hund rutscht ihm von oben Stück für Stück in die Arme. Nach dieser Felsenge führt uns ein bequemer Pfad in einen Wald. Ein Abzweig vom abwärtsgerichteten Hauptpfad weist erneut hinauf in die Felsregion, und ein Wegweiser macht neugierig. „Schwedenhöhle“ steht auf dem Schild. Wir wollen sie uns ansehen und klettern hinauf, um zu schauen, was es mit dieser Höhle auf sich hat. Es heißt, in ihr hätten sich während des Dreißigjährigen Krieges Einheimische vor schwedischen Söldnern versteckt, deshalb der Name.
Neben der Felsenhöhle leuchtet Roter Fingerhut. An der über einen Meter hohen Staude hängen dicht an dicht purpurfarbene Blüten. In ihrer Form und Größe ähneln sie tatsächlich einem Fingerhut.
Der Eingang ins Felsenloch ist weit genug, sodass ein Mensch aufrecht hineingehen kann, verengt sich aber bald, und nach einer Kurve scheint der Gang zu Ende zu sein. Zwängt man sich aber durch die Enge, kann man dem Gang noch 20 Meter weit in den Fels hinein folgen, bis er sich zu einer hohen Kammer weitet. Ich habe eine Stirnlampe dabei, mit der wir die Höhle erkunden könnten. Doch meine Begleiter drängen zum Weitergehen. Noch drei bis vier Stunden Weg liegen vor uns. Der Himmel hat sich zwischenzeitlich verdüstert, ab und zu ist fernes Donnergrollen zu vernehmen.
Auf schmalem Waldpfad steigen wir hinab und dann wieder hinauf. Nur noch selten ist ein Blick durch die Bäume ins Tal zu erhaschen oder zu den Felsen über uns. Ab und zu fallen Regentropfen durch das Geäst auf uns herab. Als wir endlich unser Tagesziel, die „Grenzplatte“, erreicht haben, hat sich der Himmel wieder aufgehellt. Das Gewitter scheint sich anderswo auszutoben.
Die Grenzplatte ist ein Felsplateau mit einer weiten Aussicht. Sie befindet sich im südlichsten Zipfel des Elbsandsteingebirges noch auf deutscher Seite, jenseits liegt Tschechien. Deshalb der ungewöhnliche Name, weil hier die Grenze verläuft. Wir blicken nach Böhmen und hinunter ins Tal mit dem Ort Ostrov, der früher Eiland hieß. Im Wanderführer steht geschrieben, dass Ostrov ein bekannter Erholungsort sei mit Freibad, zahlreichen Pensionen und Gaststätten, der auch viele deutsche Besucher anziehe. Doch von unserem felsigen Aussichtsplatz sehe ich nur einige Häuser, die aus den Baumwipfeln herausragen.
Der Rückweg führt auf der gegenüberliegenden Talseite der Biela durch Wald und auf einem in Rot markierten Pfad zur Ottomühle. In dieser Mühle wurde früher das Getreide der Rosenthaler Bauern gemahlen. Bereits 1735 hat man den Mühlbetrieb eingestellt. Die ehemalige Mühle ist als Restaurant und Hotel umgebaut worden, hat allerdings geschlossen. Dafür versorgt ein Kiosk an der Straße gegenüber der Mühle die Wanderer mit Getränken und Essen. Wir nehmen an einem der bereitgestellten Holztische Platz, holen uns etwas zu trinken und packen unsere Wegzehrung aus. Während wir uns stärken, lassen wir unsere Blicke über die imposante Felskulisse auf der linken Talseite schweifen. Mir fallen wieder einige der kuriosen Namen ein, wie Gnomenberg, Wilde Zacke, Liebesknochen, Waldschrat.
Ein mächtiger Donnerschlag unterbricht das gemütliche Schauen und mahnt zum Aufbruch. Regen prasselt herab. Vor uns liegen noch einige Kilometer von der Ottomühle zur Schweizermühle, in deren Nähe unser Fahrzeug steht. Wind peitscht uns die Regenumhänge um die Waden, Wasser tropft in die Schuhe. Donner und Blitze beschleunigen unseren Schritt. Glücklicherweise haben wir eine breite Forststraße gewählt, sodass uns herabstürzende Äste und Bäume nicht treffen können. Endlich sind wir am Auto angelangt. Schlagartig hört das Unwetter auf.
„Das Buch ist eine eindrucksvolle, sehr persönliche Betrachtung des Gebirges. Die Kapitel sind ganz praktisch nach den besten Wanderrouten gegliedert, die man im Frühling, im Sommer, Herbst oder Winter entdecken kann.“
„Sie geht der Vergangenheit von Burgen und Schlössern auf den Grund, taucht ein in unheimliche und doch faszinierende Nebelmeere und fantasievolle Geschichten, die sich um das einmalige Naturparadies ranken.“
„Ein interessantes Buch, dessen Touren zum Nachwandern einladen.“
„Die Texte sind gespickt mit interessanten Fakten und Geschichten über die Region sowie mit Geheimtipps und Tricks, die dem Leser helfen, eigene Wanderungen zu planen. Rohrbachs Schreibstil ist dabei äußerst lebhaft und fesselnd. Es gelingt ihr, Begeisterung für die Natur und die Berge auf eine ansteckende Art und Weise zu entfachen.“
„Gemeinsam tauchen die Geschwister Rohrbach bei ihren facettenreichen Wanderungen durch das Elbsandsteingebirge ein in Nebelmeere und fantasievolle Geschichten, die sich um dieses Naturparadies ranken. Und sie nehmen ihre Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in eine scheinbar ferne Welt, die aber gar nicht so weit weg liegt und bequem mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen ist.“
„Ein schönes Buch – nützlich zum Entdecken und Stöbern.“
„Besser und schöner kann eine Hommage an diese einzigartige Landschaft nicht ausfallen!“
„Sehr zu empfehlen – auch als Geschenk!“















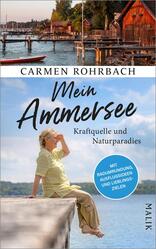
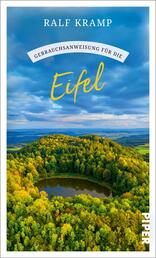


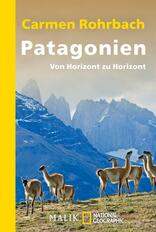












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.