
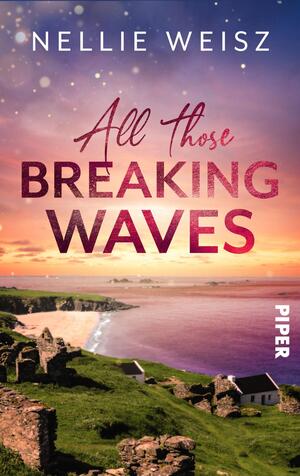
All those Breaking Waves All those Breaking Waves - eBook-Ausgabe
Roman
— Bewegender New-Adult-Liebesroman auf Great Blasket IslandAll those Breaking Waves — Inhalt
Der bewegende New-Adult-Roman über den Mut zu träumen, zu leben und zu lieben – Für Fans von Carina Schnell und Kira Mohn
„Ich schließe die Augen und genieße es, wie die Brise durch mein Haar streif, es liebevoll verwuschelt. Genieße den Geschmack von Salz auf meiner Zunge und das Geräusch der brechenden Wellen. Das Gefühl von Freiheit.“
Eigentlich wollte Emma nach dem Studium in einer Beratungsfirma Karriere machen. Doch dann erhält sie überraschend ein Angebot für einen Sommerjob auf einer kleinen Insel im Westen Irlands. Emmas Schwester Nora, die vor einem Monat gestorben ist, hat die Bewerbung heimlich für sie eingereicht. Um Noras letzten Wunsch zu erfüllen, reist Emma nach Great Blasket Island. Dort angekommen erwarten sie nicht nur Herausforderungen wie der verschlossene Fährmann Kian, sondern auch viele kleine Wunder: Robben beim Sonnenbaden am Strand beobachten, neben majestätischen Walen schwimmen und nachts in absoluter Dunkelheit Milliarden von Sternen am Himmel zählen. Verdächtig oft ist Kian dabei an ihrer Seite und immer wieder knistert es zwischen ihnen. Doch kann Emma mutig sein und sich auf ihn einlassen, obwohl ihre Zeit auf der Insel begrenzt ist?
„Ich habe schon einige Bücher von Nellie Weisz gelesen und muss sagen, dass dieses definitiv mein neues Lieblingsbuch von ihr wird. Diese Story ist wirklich rundum perfekt gelungen und trifft in traurigen und auch in lustigen Momenten genau den richtigen Ton. Einfach wunderschön und sicher mehr als fünf Sterne wert!“ ((Leserstimme auf Netgalley))
Leseprobe zu „All those Breaking Waves“
Prolog
Liebe Emma,
mit großer Begeisterung haben wir deine Bewerbung gelesen und freuen uns, dir hiermit die Stelle als Verwalterin auf Great Blasket Island anbieten zu können. Zu deinen Aufgaben wird die Bewirtschaftung der zwei Ferienhäuser sowie des Cafés für die Tagesgäste gehören. In den Sommermonaten wirst du tagsüber von einer Hilfskraft vom Festland unterstützt.
Im Haupthaus in der ersten Etage über dem Café befindet sich eine möblierte Einzimmerwohnung mit Bad und Kochnische, die du kostenfrei bewohnen kannst. Lebensmittel werden täglich mit der [...]
Prolog
Liebe Emma,
mit großer Begeisterung haben wir deine Bewerbung gelesen und freuen uns, dir hiermit die Stelle als Verwalterin auf Great Blasket Island anbieten zu können. Zu deinen Aufgaben wird die Bewirtschaftung der zwei Ferienhäuser sowie des Cafés für die Tagesgäste gehören. In den Sommermonaten wirst du tagsüber von einer Hilfskraft vom Festland unterstützt.
Im Haupthaus in der ersten Etage über dem Café befindet sich eine möblierte Einzimmerwohnung mit Bad und Kochnische, die du kostenfrei bewohnen kannst. Lebensmittel werden täglich mit der Fähre geliefert und sind ebenfalls inkludiert. Zusätzlich erhältst du einen monatlichen Lohn in Höhe von eintausend Euro. Falls du mit den Bedingungen einverstanden bist, würden wir uns über einen gemeinsamen Skype-Termin in den nächsten Tagen freuen, um dich persönlich kennenzulernen und Rückfragen deinerseits zu klären.
Viele Grüße und bis hoffentlich bald
Patrick und Fiona O’Connor
Kapitel 1
„Du willst was machen? Hast du den Verstand verloren?“ Meine beste Freundin Clara spricht so laut, dass sich die ältere Dame am Nachbartisch zu ihr umdreht und missbilligend die Nase rümpft.
„Genau dasselbe hat meine Mutter auch gesagt“, erwidere ich trocken und nehme einen Schluck von meinem Kaffee. Die Wärme des Getränks durchdringt mich, doch selbst sie kann den Knoten in meinem Magen nicht lösen, der sich dort seit dem Gespräch mit meiner Mutter eingenistet hat.
„Aber du hast dir monatelang den Arsch aufgerissen, um den Job bei dieser Beratungsfirma zu bekommen. Das kannst du doch nicht einfach so hinschmeißen!“ Mit einem Scheppern stellt sie ihre Kaffeetasse auf dem Untersetzer ab.
„Genau dasselbe hat meine Mutter auch gesagt“, wiederhole ich und nehme noch einen Schluck Kaffee, um den schalen Nachgeschmack meiner Worte hinunterzuspülen.
Clara zieht die Augenbrauen zusammen, sodass sich eine steile Falte auf ihrer Stirn bildet.
„Okay, meinen Allerwertesten hat sie nicht explizit erwähnt“, gebe ich zu. Dafür hat sie mir einige andere Worte an den Kopf geworfen, die noch immer in mir widerhallen. Der Knoten in meinem Magen zieht sich fester.
„Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich für einen krass unterbezahlten Job auf einer Insel zu bewerben, wo sonst nur Schafe leben? Und warum wusste ich nichts davon, Emma?“, fragt meine beste Freundin und sieht aus, als würde sie die Welt nicht mehr verstehen. Als würde sie mich nicht mehr verstehen. Wie könnte ich es ihr verdenken? Immerhin war es bis vor Kurzem mein größtes Ziel, einen Job bei der Walter Consulting Group zu ergattern, einer der größten und renommiertesten Beratungsfirmen Deutschlands. Ich habe unbezahlte Praktika gemacht, bei jeder Möglichkeit Social Networking betrieben und mich einem knallharten Auswahlverfahren gestellt.
„Weil ich mich nicht für die Stelle auf der Insel beworben habe“, sage ich und spreche schnell weiter, als Clara erneut die Stirn runzelt: „Nora hat die Bewerbung für mich eingereicht. Ich hatte keine Ahnung.“
Die Worte hängen zwischen uns in der Luft, und für einen Moment fühlt es sich so an, als würde eine dritte Person mit uns am Tisch sitzen. Wieder ist da diese inzwischen vertraute Enge in meiner Brust, die mich jedes Mal überfällt, wenn ich an meine Schwester denke. An meine Schwester, die vor einem Monat, zwei Tagen und sechs Stunden gestorben ist.
„Nora? Warum hat sie …? Wann …? Ich verstehe nicht.“ In Claras hellbraunen Augen schimmert es mit einem Mal verdächtig. Ich senke den Blick und kämpfe gegen das Brennen hinter meinen eigenen Augenlidern an.
Ich habe es ihr versprochen. Keine Tränen. Sie hat es mich schwören lassen. Ihre Worte hallen noch immer in meinem Kopf wider: „Es ist okay, wenn du traurig bist. Aber nicht zu lange. Nur eine angemessene Zeit, sagen wir am Tag selbst und von mir aus auf der Beerdigung, wenn es gar nicht anders geht. Danach musst du nach vorne schauen. Versprich mir, dass du keine Tränen wegen mir vergießen wirst. Ich will, dass du mit einem Lächeln an mich denkst. Dass du dich an all die verrückten Sachen erinnerst, die wir zusammen erlebt haben. Kannst du das für mich tun?“
Wie hätte ich es ihr abschlagen können? Auch wenn es mich jeden Tag unmenschlich viel Kraft kostet, die Fassade aufrecht zu erhalten. Mich an mein Versprechen zu erinnern und mit einem Lächeln an Nora zu denken. Nora, die Künstlerin. Nora, die eine Träumerin gewesen ist. Nora, die mich immer damit aufgezogen hat, dass meine Lebensplanung schrecklich spießig sei. Nora, die mein Leben mit Verrücktheit und Lachen gefüllt hat. Nora, die mir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde fehlt.
„Meine Schwester hat die Bewerbung vor sechs Wochen abgeschickt, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich habe ihre E-Mail im Anhang der Antwort gefunden. Sie muss sich in meinen Account gehackt und die Mail danach aus dem Postausgang gelöscht haben.“
Gehackt ist hierbei eine große Übertreibung. Da ich für alle Dienste, die ein Passwort erfordern, stets dieselbe Kombination nutze, die aus dem Namen meines ersten Haustiers Goldie, dem Goldhamster – mit meinen fünf Jahren war ich begeistert von meinem Einfallsreichtum – und meinem Geburtstag, dem fünften August, besteht, muss man kein Genie sein, um sich Zugang zu meinem Account zu verschaffen.
Ich umfasse meine Kaffeetasse fester, damit Clara nicht bemerkt, dass meine Finger leicht zittern. Noras E-Mail zu lesen hat meine Gefühle Achterbahn fahren lassen; kribbelnde Loopings und freier Fall inklusive. Es hat sich so gut angefühlt, sie in jeder Zeile zu spüren. Mir vorzustellen, wie sie die Unterlippe zwischen die Zähne gezogen und nachdenklich darauf herumgekaut hat, während sie die Mail verfasste. Die Liebe zu spüren, die überall zwischen den Zeilen hindurchgeblitzt ist. Mich durch ihre Augen zu sehen, hat etwas mit mir gemacht. Es hat das feste Konstrukt, in das ich meine Zukunft gegossen habe, ins Wanken gebracht. Mit jedem Wort haben sich feine Rillen hineingegraben, die sich zu Rissen vertieft und mich in einem Chaos aus Bauruinen zurückgelassen haben.
Clara lacht leise in sich hinein. „Das klingt total nach Nora.“ Ihre Stimme ist belegt. Offenkundig kämpft auch sie gegen ihre Gefühle an.
Meine Schwester ist schon seit Kindertagen meine beste Freundin gewesen. Doch als ich vor drei Jahren mit dem BWL-Studium an der Goethe-Uni in meiner Heimatstadt Frankfurt angefangen habe und Clara sich gleich am ersten Tag neben mich gesetzt hat, ist aus unserem Duo ein Trio geworden. Nora hat uns oft zu einer der zahlreichen Vernissagen ihrer Freunde mitgenommen oder uns in irgendwelche Cafés geschleppt, in denen sonst nur Künstlerinnen und Künstler mit Notizblöcken, Skizzenbüchern und Instrumenten bewaffnet abgehangen haben. Für uns zwei biedere BWL-Studentinnen hat es sich jedes Mal wie ein Ausflug in ein Paralleluniversum angefühlt. Ich weiß, dass Clara sie vermisst, obwohl wir nicht darüber reden. Ich weiß, dass Clara gern über sie reden würde. Doch ich bin noch nicht so weit. Heute ist das erste Mal, dass ich ihren Namen laut ausgesprochen habe.
Ich stelle die Kaffeetasse etwas zu schwungvoll auf dem Untersetzer ab. Der Inhalt schwappt über den Rand und läuft in dunkelbraunen Rinnsalen am schneeweißen Porzellan hinab.
Nicht heulen! Du hast es ihr versprochen.
„An dem Abend, bevor Nora …“ Ich muss nicht aussprechen, von welchem Abend ich rede, Clara versteht mich auch so und schluckt hart. „An dem Abend hat sie sich von mir verabschiedet und gesagt, dass ich mutig sein soll. Ich habe es damals nicht verstanden, doch jetzt ergibt es Sinn. Sie wollte, dass ich den Job auf dieser Insel antrete.“
Clara neigt den Kopf von links nach rechts. „Ich verstehe, dass du ihr diesen letzten Wunsch erfüllen willst, aber es geht hier trotzdem um deine Zukunft. Willst du das wirklich für einen Sommerjob auf einer verwilderten Insel irgendwo im Nirgendwo aufs Spiel setzen?“
„Es ist nicht irgendwo im Nirgendwo, sondern in Irland“, korrigiere ich sie mit einem Grinsen. „Und ich bin mir sicher, dass die Schafe der Botanik als natürliche Rasenmäher regelmäßig einen akkuraten Schnitt verpassen.“
„Du weißt schon, was ich meine.“ Sie macht eine wegwerfende Handbewegung und sieht mir fest in die Augen. Ich halte ihrem Blick so lange stand, bis sie schließlich frustriert schnaubt. „Und was ist mit mir? Du kannst mich doch nicht einfach hier zurücklassen!“ Sie deutet mit dem Löffel auf mich, von dem sie eben noch Milchschaum geleckt hat. Dazu zieht sie eine Schnute wie eine Dreijährige, der man mitgeteilt hat, dass ein Eisbecher mit Sahne nicht als Abendessen durchgeht.
Ich muss lachen und stoße aufmunternd mit meiner Schulter gegen ihre. „Es sind nur sechs Monate, du wirst gar nicht merken, dass ich weg bin“, behaupte ich, obwohl sich bei dem Gedanken, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen, Wehmut in mir breitmacht. Clara hat mir geholfen, die letzten Wochen durchzustehen. Sie war immer für mich da, auch wenn ich nicht über das sprechen konnte, was mich beschäftigt hat.
„Du wirst das echt durchziehen, oder?“ In Claras Blick liegt jetzt nicht mehr nur Irritation, sondern auch ein Funke Bewunderung.
„Sieht so aus.“ Mein Herz pocht einige Takte schneller.
„Wann geht es los?“ In einer beinahe kapitulierenden Geste legt sie den Löffel auf dem Untersetzer neben ihrer Tasse ab.
„In einem Monat soll ich anfangen.“ Es klingt wie eine Ewigkeit und gleichzeitig wie ein Wimpernschlag.
„Verdammt, Ems. Ich werde dich schrecklich vermissen.“ Clara beugt sich zu mir herüber und umarmt mich so stürmisch, dass ich beinahe vom Stuhl rutsche.
„Du kannst mich jederzeit besuchen kommen“, sage ich und puste eine ihrer wilden dunkelbraunen Locken aus meinem Gesicht.
Sie schnaubt an meiner Halsbeuge. „Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten!“
Die Tatsache, dass es auf der Insel keine Elektrizität und somit weder W-Lan noch eine warme Dusche gibt, behalte ich vorerst lieber für mich.
***
Es ist bereits später Nachmittag, als ich die Haustür zu der kleinen Dreizimmerwohnung aufschließe, die ich mir mit meiner Mutter teile. Ich schäle mich aus meiner Daunenjacke und streife meine halbhohen schwarzen Stiefel von den Füßen, bevor ich nach meiner Umhängetasche greife. Darin befindet sich ein brandneuer Reiseführer über das Land, das ich bald als mein neues Zuhause bezeichnen kann. Voller Vorfreude laufe ich über den Flur; die Dielen knarzen unter meinen Fußsohlen.
„Emma?“ Die Stimme meiner Mutter lässt mich an der Türschwelle zu meinem Zimmer verharren.
Kurz erwäge ich, so zu tun, als ob ich sie nicht gehört hätte, aber das würde mich vermutlich nur vorübergehend vor einer weiteren Konfrontation retten. Also seufze ich lautlos und mache auf dem Absatz kehrt, um stattdessen ins Wohnzimmer zu gehen.
Meine Mutter sitzt auf dem anthrazitfarbenen Stoffsofa, das so zerschlissen und der Bezug an manchen Stellen so dünn ist, dass die Farbe eher an ein dreckiges Weiß erinnert. Vor ihr auf dem kniehohen Couchtisch steht eine Teetasse. Als ich eintrete, wendet sie mir den Kopf zu. An dem langärmligen knallroten Oberteil, das sie trägt, kann ich ablesen, dass sie eben erst von ihrem Nebenjob in der Bäckerei gekommen ist. Ich verkneife mir ein Stöhnen, denn ihre Arbeitstage dort sind lang und beschwerlich und sie abends dementsprechend gerädert und dünnhäutig. Mit anderen Worten: die besten Voraussetzungen für ein weiteres Gespräch über meinen in ihren Augen absurden Plan, den Job in Irland anzunehmen.
„Hast du noch mal darüber nachgedacht?“, fragt sie und läutet übergangslos die nächste Runde ein.
„Da gibt es nichts, worüber ich nachdenken müsste. Ich habe mich schon entschieden, dass ich den Job annehmen werde. Es ist nur für einen Sommer. Ich weiß nicht, warum du so ein Drama daraus machen musst.“ Ich bleibe absichtlich im Türrahmen stehen, anstatt mich zu ihr aufs Sofa zu setzen. Es soll ihr ein klares Zeichen senden, dass ich dieses Gespräch so kurz wie möglich halten will.
„Weil es nicht nach dir klingt. Alles stehen und liegen zu lassen, um auf einer verlassenen Insel zu leben, ist etwas, das deine Schwester getan hätte, aber nicht du.“ Sie sieht mich mit einem flehenden Ausdruck in den Augen an. „Du warst doch immer die Vernünftige von euch beiden.“
Noras Art, von einem Tag zum nächsten zu leben und sich keine Gedanken um die Zukunft zu machen, hat meiner Mutter in der Vergangenheit bereits einige graue Haare beschert. Die Erinnerung an meine ältere Schwester verursacht mir einen Stich in der Magengegend. Seit Nora gestorben ist, hat meine Mutter jedes Thema gemieden, das auch nur im Entferntesten mit ihr zu tun haben könnte. Und ich kann sie sogar verstehen, denn mir geht es genauso. Es ist schon schwer genug, nur an sie zu denken, ohne in Tränen auszubrechen. Über sie zu sprechen, würde das Fass im wahrsten Sinne des Wortes zum Überlaufen bringen.
„Und weil ich die Vernünftige bin, werde ich im September zurückkommen und meinen Job bei der Walter Consulting Group antreten. Der Plan hat sich nicht geändert. Ich habe ihn nur um ein halbes Jahr nach hinten verschoben“, erkläre ich ihr voller Zuversicht. Dabei warte ich in Wahrheit noch auf die Rückmeldung von der Personalerin.
„Das sagst du jetzt, aber wer weiß, was passiert, wenn du erst mal dort bist. Pläne können sich ändern. Das Leben ist manchmal unberechenbar.“
Dafür ist Nora selbst das beste Beispiel.
Die Worte hängen zwischen uns in der Luft, auch wenn meine Mutter sie nicht ausspricht. Sie war noch nicht einmal achtzehn, als sie mit Nora schwanger wurde. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und ohne die Unterstützung ihrer Familien hat sie nie den Luxus gehabt, eigene Träume für ihr Leben zu entwerfen. Weder Noras noch mein Vater haben durch Präsenz oder finanzielle Unterstützung geglänzt. Also hat meine Mutter Tag und Nacht geschuftet, um ihren Töchtern einen besseren Lebensstil bieten zu können. Deshalb hat sie uns schon in der Schulzeit dazu gedrängt, etwas Sinnvolles zu studieren. Was zumindest bei einer ihrer beiden Töchter gefruchtet hat.
„Egal, was du sagst, meine Entscheidung steht fest. Ich muss das machen“, sage ich und fühle mich wie eine Schallplatte mit Sprung. Das ganze Gespräch ist ein Déjà-vu.
Meine Mutter seufzt tief und knetet sich mit der rechten Hand die verspannten Schultern. Mit einem Mal sieht sie eher erschöpft als aufgebracht aus. Als würde auch sie das Gespräch ermüden. „Ich weiß, dass du denkst, dass du es Nora schuldig bist, aber das bist du nicht.“
Genau da irrt sie sich.
„Wenn du sonst nichts weiter mit mir besprechen willst, würde ich jetzt gern in mein Zimmer gehen.“ Ich höre, wie abweisend ich klinge, und augenblicklich macht sich das schlechte Gewissen in mir breit. Immerhin weiß ich, dass meine Mutter es nur gut meint. Auch wenn sie und ich aktuell sehr unterschiedliche Ansichten darüber haben, was gut für mich ist.
Sie schüttelt den Kopf, doch der entschlossene Ausdruck in ihren Augen verrät mir, dass wir das Gespräch nicht zum letzten Mal geführt haben. Ich wende mich ab und laufe den Flur entlang.
Die Vorfreude, die mich eben noch erfüllt hat, ist verpufft. Wie so oft in den vergangenen Wochen wünsche ich mir, dass meine Schwester hier wäre. Nora hatte ein Talent dafür, angespannte Situationen durch ihre überschwängliche Art aufzulösen. Statt sich mit meiner Mutter zu streiten, hätte sie vermutlich irgendeinen Gute-Laune-Song auf volle Lautstärke gedreht und sie so lange dazu genötigt, mit ihr durchs Zimmer zu tanzen, bis sie nachgegeben hätte. Erinnerungen an wildes Herumgehüpfe und Noras schrille Stimme, die den Refrain von A-has Take on Me vollkommen schief mitsingt, zaubern unwillkürlich ein Lächeln auf mein Gesicht. Egal, ob es eine verhauene Klassenarbeit war, mein erster Liebeskummer oder einfach ein richtig ätzender Montag, für meine Schwester war kein Anlass zu klein, um mich auf die Füße zu ziehen und mich zu den Klängen der Musik herumzuwirbeln.
Als ich mein Zimmer betrete, ist die Stille darin nur umso drückender. Denn Nora ist nicht mehr hier, um meine dunklen Tage heller zu machen.
***
Die nächsten Wochen ziehen so schnell an mir vorbei, als hätte jemand mein Leben auf doppelte Geschwindigkeit gestellt. Schon zwei Tage nach meiner Zusage an die O’Connors haben wir uns in einem Skype-Call persönlich kennengelernt. Patrick und Fiona sind beide Mitte vierzig und leben in Dublin. Früher kümmerten sie sich selbst um die Ferienwohnungen auf der Insel, doch seit sie vor zehn Jahren Eltern von zwei Jungen geworden sind, verbringen sie nur noch in den Ferien Zeit auf Great Blasket Island. Sie haben mir jedoch versprochen, mich nach meiner Ankunft persönlich auf der Insel herumzuführen.
Das Ehepaar ist unglaublich sympathisch und herzlich und könnte rein optisch dem Cover einer Werbebroschüre über Irland entsprungen sein. Beide haben rotes Haar; Fionas hat einen leichten Blondstich, der es im warmen Licht der Deckenlampe wie Kupfer leuchten ließ. Sommersprossen bedecken nicht nur ihre Nasenspitze und Wangen, sondern zeichnen auch wilde Muster auf die milchweiße Haut ihrer Arme. Patrick trug ein grün-schwarz kariertes Holzfällerhemd aus Flanell, das über seinen breiten Schultern spannte. In Kombination mit seinem Rauschebart könnte er der kleine Bruder von Hagrid sein, dem Wildhüter aus Harry Potter.
Das Gespräch mit den beiden bestätigt mich darin, dass es die richtige Entscheidung war, das Jobangebot anzunehmen. Dieses Gefühl kann mir nicht einmal meine Mutter vermiesen, die immer noch keine Gelegenheit auslässt, um auf mich einzureden.
Daran ändern auch meine Beteuerungen nichts, dass ich nach dem halben Jahr zurückkehren und wie geplant in der Beratungsfirma anfangen werde. Zu meiner grenzenlosen Erleichterung hat die Personalerin bei der Walter Consulting Group mir tatsächlich angeboten, den Start meiner Trainee-Stelle einfach auf Oktober zu verschieben.
Da sich die Gespräche mit meiner Mutter immer nur im Kreis drehen, versuche ich, ihr bis zu meiner Abreise möglichst aus dem Weg zu gehen. Was sich in der kleinen Dreizimmerwohnung als gar nicht so einfach herausstellt.
Meist bietet mir Clara einen willkommenen Anlass, um die Wohnung zu verlassen. Beinahe täglich treffen wir uns in der Bibliothek, um an unserer Bachelorthesis zu schreiben. Mein Zeitplan hat sich durch die Reise nach Irland um einen ganzen Monat verkürzt, weshalb ich im Gegensatz zu Clara, die sich meistens Katzenvideos auf YouTube ansieht oder durch das Angebot verschiedener Online-Shops stöbert, auch tatsächlich arbeite.
Mit der Deadline für die Thesis im Nacken vergehen die Tage wie im Flug. Plötzlich ist es Ende März und der letzte Abend vor der Abreise angebrochen. Zum gefühlt hundertsten Mal packe ich den Hartschalenkoffer, der mir im Leerzustand riesig vorgekommen ist, sich in gefülltem Zustand jedoch nicht einmal dann schließen lässt, wenn ich mich daraufsetze. In meiner Verzweiflung beschließe ich, Clara anzurufen und sie um Hilfe zu bitten. Bei dem Gedanken, wie wir nebeneinander wie gestrandete Robben über dem orangefarbenen Koffer hängen, muss ich grinsen.
„Hast du kalte Füße bekommen?“, begrüßt mich meine beste Freundin, kaum dass sie den Anruf entgegengenommen hat.
„Nope.“
Sie gibt ein enttäuschtes Seufzen von sich. „Na ja, kann ja noch kommen.“
„Dafür stecke ich in einer anderen Art von Krise.“ Ich mache eine dramatische Pause. „Mein Koffer geht nicht zu“, gestehe ich, gefolgt von einem frustrierten Schnauben. „Kannst du vorbeikommen?“
Clara lacht. „Ich bin gleich mit meinen Eltern und meinem Bruder zum Familienessen verabredet, also kann ich dir leider nur in virtueller Form zur Seite stehen.“
„Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. “
„Dann lass mal den Profi ran“, verlangt sie und schaltet auf Videocall um.
Ich tue es ihr gleich und richte die Frontkamera auf den geöffneten Koffer, aus dem meine Klamotten herausquellen wie heißer Käse aus einem Sandwichmaker. Stück für Stück halte ich die eingepackten Gegenstände in die Kamera und Clara nickt sie mit einem fachmännischen Gesichtsausdruck ab oder verbannt sie auf den Stapel, der zu Hause bleiben muss. Bei den meisten Teilen, die auf diesem Haufen landen, erhebe ich keinen Einspruch, wie zum Beispiel bei dem zehnten T-Shirt und dem über tausend Seiten dicken Wälzer, den ich für regnerische Tage eingepackt habe – wozu gibt es schließlich E-Reader?
Als sie meine zugegebenermaßen ziemlich ramponierten Wanderschuhe ebenfalls verbannen will, protestiere ich. Clara rümpft zwar die Nase, lässt mich nach dem Einwand, dass ich mir auf der verwilderten Insel, wie sie zu sagen pflegt, sonst im Handumdrehen die Knöchel verknacksen werde, schließlich doch gewähren.
„Dafür musst du als modischen Ausgleich das Kleine Schwarze einpacken, das du bei der Weihnachtsfeier vom Fachbereich letztes Jahr getragen hast. Darin sahst du verdammt heiß aus.“ Sie wackelt anzüglich mit den Augenbrauen.
„Wen soll ich denn auf der Insel bezirzen? Die Schafe?“
„Natürlich einen Kilt tragenden Highlander. Hast du nie die Bücher von Diana Gabaldon gelesen?“ Ein träumerischer Ausdruck erscheint in ihren Augen.
„Erstens gibt es in Irland keine Highlander, die stammen nämlich aus Schottland, und zweitens bin ich nur für ein halbes Jahr da. Das Letzte, was ich da im Handgepäck wieder mit nach Hause bringen will, ist Liebeskummer.“
„Die Nächte da oben im Norden können kalt werden, und es hat schließlich keiner verlangt, dass du ihn gleich heiraten sollst.“ Auf Claras Lippen stiehlt sich ein breites Grinsen.
Ich schüttle den Kopf. „Danke für deine Hilfe, aber ich glaube, den Rest schaffe ich allein.“
„Vergiss das Kleine Schwarze nicht!“, ruft sie mir noch zu, bevor ich das Gespräch beende.
Probehalber klappe ich den Koffer zu und teste den Reißverschluss. Diesmal lässt er sich problemlos schließen. Mein Blick wandert zu dem geöffneten Kleiderschrank und bleibt an dem schwarzen Kleid mit dem beinahe unanständig tiefen Rückenausschnitt hängen. Auch wenn ich bezweifle, dass sich auf der Insel eine Gelegenheit bieten wird, es zu tragen, kann es nicht schaden, es einzupacken.
Nachdem ich den Koffer erfolgreich verschlossen und von meinem Bett zurück auf den Boden gewuchtet habe, gibt mein Magen ein lautes Knurren von sich. Ein Blick auf den Wecker, der auf meinem Nachttisch steht, verrät mir, dass es bereits acht Uhr abends ist und damit weit nach meiner gewöhnlichen Essenszeit.
Lautlos husche ich durch den dunklen Flur und biege nach rechts in die Küche ab. Das monotone Brummen des Kühlschranks begrüßt mich. Als ich den Lichtschalter betätige, gesellt sich das Summen der LED-Deckenlampe dazu. Ansonsten liegt der Raum verlassen vor mir. Ich bin mir nicht sicher, ob mich diese Tatsache erfreut oder betrübt. Die letzten vier Tage bin ich meiner Mutter erfolgreich aus dem Weg gegangen, und es kommt mir falsch vor, morgen ohne einen richtigen Abschied aufzubrechen.
Nach einem kurzen Blick zurück zur Tür und dem dahinterliegenden Flur, an dessen Ende sich das Zimmer meiner Mutter befindet, wende ich mich dem Tresen aus weiß lackiertem Holz zu. Ich hole mir einen Teller aus einem der Hängeschränke und platziere eine Scheibe Brot darauf, die ich großzügig mit Gouda belege. Gerade als ich vier Gurkenscheiben gleichmäßig auf dem Käsebrot verteilen will, ertönt ein leises Räuspern in meinem Rücken, das mich zusammenzucken lässt. Mit dem Teller in der Hand drehe ich mich um und sehe meine Mutter, die im Türrahmen steht. Sie trägt ihre schwarze Regenjacke und weiße Turnschuhe.
„Na, hast du für morgen alles gepackt?“, fragt sie. Das Lächeln auf ihren Lippen wirkt gezwungen.
Augenblicklich spannen sich meine Schultern an. „Ich musste ein paarmal umpacken, aber jetzt ist alles drin“, erwidere ich zurückhaltend. Jedes falsche Wort könnte ihr Munition für einen weiteren Vortrag liefern.
Doch sie nickt nur. Für einen Moment ist es still im Raum. Lediglich das Brummen der Elektrogeräte erfüllt die Luft.
„Ich muss gleich ins Krankenhaus zur Spätschicht. Falls wir uns morgen früh nicht mehr sehen sollten, wünsche ich dir schon mal einen guten Flug. Und melde dich bitte, wenn du angekommen bist.“ Sie nestelt an dem Verschluss ihrer Jacke herum.
„Ja klar. Mach ich.“ Ihre plötzliche Zurückhaltung irritiert mich. Innerlich hatte ich mich bereits auf ein erneutes Streitgespräch und einen Abgang mit knallenden Türen eingestellt.
Meine Mutter bleibt weiterhin im Türrahmen stehen, so als würde ihr noch etwas auf dem Herzen liegen. Schließlich hebt sie den Kopf und sieht mich direkt an. „Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Fall nicht von einer der Steilklippen oder lass dich von einem Schaf niedertrampeln.“ Ihr ernster Tonfall weicht einem Lächeln.
Ich schnaube. „Na herzlichen Dank für dein Vertrauen in meine Überlebensfähigkeiten.“
„Muss ich dich wirklich an den Vorfall im Streichelzoo erinnern?“ Sie zieht amüsiert eine Augenbraue hoch.
„Da war ich acht, und diese Ziege hat einen persönlichen Rachefeldzug gegen mich gestartet. Ich hatte keine Chance.“
Meine Mutter kaschiert ihr Lachen mit einem Hüsteln, doch ich sehe, wie sich feine Fältchen um ihre Augenwinkel graben.
Ich war damals zusammen mit Nora und meiner Mutter im Zoo. Meine Schwester hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Ziege mit den beeindruckendsten Hörnern zu streicheln. Um das Mistvieh anzulocken, hat sie mir meinen Müsliriegel geklaut und ihn der Ziege als Köder vor die Nase gehalten. Ich hingegen war deutlich mehr an dem Verbleib meines Essens interessiert als an dem Tier, weshalb ich den Riegel todesmutig von der Ziege zurückerobert habe. Das fand diese wiederum wenig amüsant. Kaum hatte ich ihr den Rücken zugekehrt, hat sie mich von hinten attackiert und mir ihre Hörner in den Allerwertesten gerammt. Ich konnte danach zwei Wochen lang nicht sitzen. Seit diesem Tag hege ich ein gesundes Misstrauen gegenüber Ziegen.
Meine Mutter wird wieder ernst. „Bitte versprich mir noch etwas.“ Sie wartet ab, bis ich zögerlich nicke, bevor sie fortfährt: „Versprich mir, dass du deine Ziele nicht aus den Augen verlierst. Und dass du wieder zu mir zurückkommst. Ich … ich kann dich nicht auch noch verlieren.“ Ihre Stimme klingt erstickt und auch meine Kehle schnürt sich zu.
Ich stelle den Teller mit dem Käsebrot auf dem Tresen ab und durchquere mit zwei großen Schritten den Raum, um meine Mutter in eine feste Umarmung zu ziehen. Energisch blinzle ich gegen die Tränen an, die sich in meinen Augenwinkeln bilden. „Du wirst mich nicht verlieren. Versprochen“, flüstere ich in ihre Halsbeuge.
Kapitel 2
„Wir beginnen in wenigen Minuten mit dem Landeanflug. Bitte klappen Sie den Tisch vor sich hoch und bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position.“ Die Stimme der Flugbegleiterin dröhnt kratzig aus den Lautsprechern über mir und ich wende meinen Kopf reflexartig dem ovalen Fenster rechts von mir zu. Doch anstelle saftig grüner Wiesen ballen sich lediglich dunkelgraue Wolken hinter der Kunststoffscheibe zusammen, auf der sich vereinzelte Eiskristalle gebildet haben.
Als das Flugzeug plötzlich um mehrere Meter nach unten sinkt, kralle ich meine Finger in die Armstützen meines Sitzes. Meine Sitznachbarin, eine ältere Dame in einem grau melierten Tweed-Kostüm und mit Nickelbrille auf der Nase, bekreuzigt sich und murmelt lautlose Worte vor sich hin. Vermutlich das Vaterunser.
Ob jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um meinen Austritt aus der Kirche zu bereuen?
Erneut sackt das Flugzeug ohne Vorwarnung nach unten. Die Maschine wird von den Böen durchgeschüttelt, in den Ablagefächern über meinem Kopf klappert es wenig vertrauenerweckend. Mir wird flau im Magen und ich hefte meinen Blick auf die grauen Schwaden hinter der Scheibe, die ineinanderfließen und zerreißen, nur um einen Bruchteil später zu einer neuen Formation zusammenzufinden. Erleichtert atme ich aus, als wir endlich die Wolkendecke durchbrechen und ich durch die Schlieren, die der Regen auf der Scheibe hinterlässt, die Landebahn erkennen kann. Der Pilot fliegt eine große Schleife und setzt nach weiteren zehn Minuten in der Luft, die sich anfühlen, als hätte man mich in einen Mixer geworfen, mit einem Hopser auf dem Boden auf. Beifall flutet die Kabine. Meine Sitznachbarin hebt den Kopf und lächelt zufrieden, so als hätten wir es ihren Gebeten zu verdanken, dass wir in einem Stück in Cork gelandet sind.
Draußen peitschen Regentropfen gegen das Fenster, ein tristes Grau hüllt die Umgebung ein. Ich bin kurz versucht, die Frau neben mir zu fragen, ob sie in ihrem Gebet für eine sichere Landung nicht auch den Wunsch nach besserem Wetter hätte unterbringen können.
Eine Dreiviertelstunde später verlasse ich das Flughafengebäude. Es regnet noch immer in Strömen. Fluchend ziehe ich mit der rechten Hand den Rollkoffer hinter mir her, während ich mit der linken die Kapuze von meiner Regenjacke gegen die Windböen verteidige, die sie mir immer wieder vom Kopf fegen wollen. Wenigstens stimmt mein Timing, denn ich erwische den Linienbus in die Stadt in der letzten Sekunde und lasse mich erleichtert auf einen der Schalensitze fallen.
Warme Heizungsluft bläst mir aus dem Fußraum entgegen und trocknet meine Jeans, die durch den Regen, der aktuell waagerecht anstatt senkrecht vom Himmel prasselt, vollkommen durchnässt ist. Das Wetter in Irland macht seinem Ruf alle Ehre und lässt mich wünschen, vor dem Abflug dem Outdoorladen auf der Frankfurter Zeil einen Besuch abgestattet zu haben.
Ich lasse meinen Kopf gegen die Scheibe sinken und beobachte die Landschaft, die draußen vorbeizieht. Felder und Bäume erstrecken sich zu beiden Seiten der Straße, die von vereinzelten Häusern und Bauernhöfen unterbrochen werden.
Bald erreichen wir die ersten Ausläufer der Stadt Cork. Der Bus überquert einen Fluss, der nicht mehr als ein graues, sich aufbäumendes Band ist. Die einzigen Farbtupfer bilden die bunten Regenschirme vorbeieilender Fußgänger. Je näher wir dem Stadtkern kommen, desto mehr kleine, verwinkelte Gassen zweigen von der Hauptstraße ab. Einige erinnern mich mit ihren Backsteinfassaden und den bunten Holzverkleidungen an die Winkelgasse in Harry Potter. Leider habe ich keine Gelegenheit, mich auf die Suche nach Bertie Botts Bohnen oder Mister Ollivanders Zauberstabgeschäft zu begeben, da ich den Anschlussbus nach Dingle erwischen muss.
Als ich nach dreieinhalb Stunden endlich in dem kleinen Küstenort Dingle ankomme, den ich schon aufgrund seines unfassbar süßen Namens direkt ins Herz schließe, prickelt Aufregung durch meine Adern. Nach der angenehm kuscheligen Heizungsluft im Bus fühlt sich der von Regentropfen durchsetzte Wind wie eine Ohrfeige an. Fröstelnd ziehe ich die Regenjacke über meiner viel zu dünnen Bluse fester zusammen. Heute Morgen erschien es mir wie eine grandiose Idee, die rot-weiß gepunktete Lieblingsbluse meiner Schwester anzuziehen, um einen Teil von ihr bei mir zu tragen. Jetzt wünschte ich mir, ich hätte mich stattdessen für einen ihrer Haargummis entschieden.
Eine Windböe reißt meine Kapuze nach hinten und lässt meine dunkelbraunen Haare durch die Luft tanzen. Fluchend stopfe ich sie zurück unter den beschichteten Stoff und blicke mich suchend auf dem Bussteig um. Doch egal, wohin ich sehe, ich kann weder Fionas noch Patricks roten Haarschopf entdecken. Ich will gerade mein Handy aus der Jackentasche friemeln, um die Uhrzeit zu überprüfen – vielleicht ist der Bus zu früh gewesen? –, als mich plötzlich jemand von hinten anspricht.
„Bist du die Hausmeisterin?“ Die Stimme klingt durch den Regen und meine Kapuze nur gedämpft an mein Ohr, was es nicht unbedingt leichter macht, die in einem verwaschenen Englisch ausgesprochenen Worte zu verstehen. Der irische Akzent hat mal so gar nichts mit meinem Schulbuchenglisch gemein.
Ich wirble herum und stehe einem Mann in einem leuchtend gelben Regenmantel gegenüber, der seine Kapuze so tief ins Gesicht gezogen hat, dass ich nur sein Kinn erkennen kann, das mit dunklen Bartstoppeln bedeckt ist.
„Was?“, frage ich überrumpelt.
Seine Schultern heben sich erst, bevor er sie zusammen mit einem ungeduldigen Seufzen wieder sinken lässt. „Bist du das Mädchen der O’Connors?“, hakt er nach und klingt dabei genervt. Als wäre jede Sekunde, die er gemeinsam mit mir verbringen muss, eine zu viel.
Bei der Bezeichnung Mädchen runzle ich die Stirn und verschränke reflexartig die Arme vor der Brust. Mit zweiundzwanzig Jahren bin ich kein kleines Mädchen mehr, und die Art, wie er es betont, lässt es klingen, als wäre ich eine Dienstmagd.
„Ich bin Emma und werde mich für die O’Connors um die Cottages auf Great Blasket Island kümmern“, erwidere ich und versuche mich trotz seines ruppigen Auftretens an einem freundlichen Lächeln.
Er nickt, denkt aber offenbar nicht einmal darüber nach, mir ebenfalls seinen Namen zu verraten. Stattdessen dreht er sich um und läuft davon. Erst als er das Ende des Bussteigs erreicht hat, bemerkt er, dass ich ihm nicht folge.
„Kommst du jetzt, oder was?“ Ich muss sein Gesicht nicht sehen, um zu erkennen, dass er genervt ist. Vom Regen. Von der Situation. Und vermutlich am meisten von mir.
Trotz macht sich in mir breit. Was denkt sich der Typ eigentlich? Er hat mir bis jetzt weder seinen Namen genannt noch mir eine Erklärung dafür geliefert, warum er und nicht wie verabredet Patrick und Fiona am Busbahnhof auf mich gewartet haben.
„Meine Mutter hat mir beigebracht, nicht mit fremden Männern mitzugehen“, erwidere ich und recke herausfordernd das Kinn.
Ich sehe, wie sich seine Schultern erneut heben, als er tief einatmet, wahrscheinlich, um seine Ungeduld zu zügeln. Was ihm jedoch misslingt. „Patrick und Fiona ist etwas dazwischengekommen. Sie haben mich geschickt, um dich abzuholen. Wenn du dann jetzt so freundlich wärst?“ Er macht eine einladende Geste in Richtung der Straße, die er eben überqueren wollte.
Ich muss mich beherrschen, um nicht zu schnauben. Freundlich? Das muss er gerade sagen.
Zögernd kaue ich auf meiner Unterlippe herum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich Patrick und Fiona einfach ohne ein Wort der Erklärung versetzt haben. Erst gestern Abend haben sie mir eine Nachricht geschickt, um mir einen guten Flug zu wünschen und sich die Ankunftszeit des Busses in Dingle bestätigen zu lassen.
Ich zerre mein Handy aus der Jackentasche hervor und schalte das Display ein, auf der Suche nach einem entgangenen Anruf oder einer Textnachricht. In der Statusleiste blinkt mir das Symbol eines Miniatur-Flugzeugs entgegen. Natürlich! Ich Dussel habe vergessen, nach der Landung den Flugmodus auszuschalten.
Das hole ich nun umgehend nach und keine Sekunde später zappelt mein Handy wie ein Fisch auf dem Trockenen. Fünf entgangene Anrufe und eine Textnachricht von Fiona blinken mir auf dem Display entgegen. Ich öffne die Nachricht und lese, dass Patricks Vater heute Morgen aufgrund eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sie mich deshalb nicht in Empfang nehmen können. Sie würden mir aber jemanden schicken, der mich abholt und auf die Insel bringt. Sie selbst wollen so bald wie möglich nachkommen, um mir alles zu zeigen.
Schnell tippe ich eine Antwort, dass sie sich keine Sorgen um mich machen sollen, und richte Genesungswünsche an Patricks Vater aus.
Ein paar Meter entfernt tritt mein Fahrer ungeduldig von einem Fuß auf den anderen, die in knöchelhohen Outdoorschuhen stecken. Eine unmissverständliche Aufforderung an mich, endlich in die Gänge zu kommen.
Mit einem unterdrückten Seufzen schultere ich meinen Rucksack, greife nach dem Rollkoffer und folge dem Mann, der sich schon wieder in Bewegung gesetzt hat. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite umrundet er einen zerbeulten Pick-up. Er ist derart in die Jahre gekommen, dass ich nicht einmal die Farbe bestimmen kann.
Mein Fahrer lässt die Klappe zur Ladefläche herunter. Als sein Blick meinen Koffer streift, breitet sich ein spöttisches Grinsen auf seinen Lippen aus. „Das ist dein Gepäck?“
„Ja, was soll damit sein?“ Automatisch gehe ich in Abwehrhaltung.
„Ach nichts, ich hoffe nur für dich, dass du vor deiner Abreise viel Zeit im Fitnessstudio verbracht hast.“ Meine eher zierliche Statur verrät ihm offensichtlich, dass dem nicht so ist, und sein spöttisches Grinsen wird mitleidig.
Der Typ wird mir mit jeder Sekunde unsympathischer.
Da er keine Anstalten macht, meinen Koffer zu verladen, ist das anscheinend mein Signal, mich selbst darum zu kümmern. Also umfasse ich den Griff mit beiden Händen und wuchte den fünfundzwanzig Kilo schweren Koffer auf die Ladefläche. Den Blick des unverschämten Typen im Nacken, verkneife ich mir jegliches Stöhnen und Fluchen, das mir auf den Lippen liegt.
Nachdem ich das Ungetüm von einem Gepäckstück endlich sicher verstaut habe, drehe ich mich mit einem triumphierenden Grinsen um. Nur um festzustellen, dass ich allein im Regen stehe. In diesem Augenblick erwacht der Motor des Pick-ups zum Leben. Ich versetze der Ladeklappe einen Stoß, sodass sie einrastet, und sprinte zur Beifahrertür, bevor der Wagen sich ohne mich in Bewegung setzt. Zuzutrauen wäre es dem Typ.
In der geöffneten Tür verharre ich. „Weißt du, meine Mutter hat mich auch immer davor gewarnt, zu Fremden ins Auto zu steigen, von denen ich nicht einmal den Namen kenne“, sage ich an meinen Fahrer gewandt, denn es wurmt mich, dass er mir seinen Namen noch immer nicht verraten hat.
„Dann wirst du wohl zu Fuß gehen müssen. Deine Entscheidung“, erwidert er ungerührt.
Kurz denke ich tatsächlich darüber nach, doch zum einen hätte ich mich dann umsonst mit meinem Koffer abgemüht und zum anderen habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich ohne ihn auf die Insel kommen soll. Also lasse ich mich leise vor mich hin fluchend auf den Beifahrersitz fallen.
Im Inneren des Wagens empfängt mich Stille, die nur durch das Prasseln der Regentropfen durchbrochen wird, die gegen die Windschutzscheibe klatschen. Ein paarmal versuche ich, meinen schweigsamen Fahrer in ein Gespräch zu verwickeln, doch da das Einzige, was ich ihm entlocken kann, brummende Töne sind, stelle ich meine Bemühungen bald wieder ein. Normalerweise habe ich kein Problem damit, mich mit Fremden zu unterhalten, doch dieses Exemplar zu meiner Rechten scheint eher vom Typ menschenfeindlicher Einsiedler statt redseliger Einheimischer zu sein. Immerhin hat er die Heizung angestellt, sodass die nasse Kälte langsam aus meinen Knochen weicht.
Als wir nach zwanzig Minuten endlich das kleine Dorf Dunquin erreichen, von dem aus die Fähre nach Great Blasket Island ablegt, seufze ich beinahe vor Erleichterung auf. Wir passieren einige einsame Häuschen mit windschiefen Dächern, bevor der Wagen auf die Küstenstraße abbiegt. Wenig später setzt mein Fahrer den Blinker und kommt auf einem Schotterparkplatz zum Stehen. Durch den noch immer anhaltenden Regen erkenne ich vor uns einen Wegweiser, auf den jemand mit blauer Farbe die Umrisse eines Bootes gemalt hat. Er zeigt in Richtung eines asphaltierten Weges, der offensichtlich hinab zum Pier führt. Vermutlich ist die Aussicht vom Kliff bei klarem Wetter traumhaft, doch aktuell kann ich nicht mehr als ein Potpourri an Grautönen erkennen, die sich wie eine Vielzahl an Schleiern übereinanderlegen, bis sie undurchdringbar scheinen.
Froh, endlich dem beklemmenden Schweigen im Inneren des Wagens entfliehen zu können, öffne ich die Beifahrertür und springe hinaus auf den Schotterplatz. Obwohl mich die massive Autotür vor den heftigsten Windböen abschirmt, spüre ich, wie der Wind an meinen Kleidern zerrt. Gerade will ich mich zur Ladefläche vorkämpfen, um meinen Koffer zu holen, als mir auffällt, dass sich mein Begleiter nicht vom Fleck gerührt hat. Hat Fiona nicht geschrieben, dass er mich bis zur Insel bringt?
„Soll ich den Rest schwimmen?“, frage ich nur halb im Scherz. So wie ich den Typ einschätze, würde er mir vermutlich am liebsten einen Rettungsring in die Hand drücken und mich in den Atlantik schubsen.
Sein Mundwinkel zuckt verdächtig, als würde er sich dieses Szenario gerade bildhaft vorstellen, bevor er in trockenem Ton erwidert: „Das kann ich dir nur bedingt empfehlen. Hier gibt es Haie. Aber die sind bei der Strömung wohl dein geringstes Problem.“
Ich lache ironisch. Da sich sein Gesicht allerdings nicht aufhellt und seine Worte als Scherz enttarnt, versickert mein Lachen wie der Regen im Gully am Straßenrand. Das kann nur ein Scherz sein! Wenn es in Irland Haie gäbe, hätte ich bestimmt davon gehört, oder? Ich beschließe, das bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit zu googeln.
„Okay, und wie komme ich jetzt auf die Insel?“, frage ich und verschränke die Arme vor der Brust.
„Mit dem Boot“, erwidert er, macht aber keine Anstalten, aus dem Wagen auszusteigen. Inzwischen ist meine Jeans erneut vom Regen durchnässt.
„Wärst du dann vielleicht so freundlich, mich mit einem Boot dorthin zu fahren?“, frage ich und spreche betont langsam, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden.
„Nein.“ Wieder zuckt sein Mundwinkel. Der mörderische Blick, den ich ihm als Antwort zuwerfe, scheint ihn zusätzlich zu erheitern.
Sollten die Iren nicht eigentlich für ihre Gastfreundschaft bekannt sein? Zumindest stand es so in dem Reiseführer über meine neue Heimat auf Zeit. Offensichtlich bin ich an den einzigen Iren geraten, der die berühmte Ausnahme der Regel bildet. In diesem Augenblick, durchnässt und gerädert von der langen Anreise, will ich am liebsten das Handtuch werfen und direkt wieder umkehren. Zurück nach Frankfurt. Zurück in mein bequemes Leben.
„Wir können bei dem Wellengang nicht fahren. Wenn wir jetzt aufbrechen, würdest du über Bord gehen, noch bevor wir das Festland hinter uns gelassen haben. Und dann müsste ich den O’Connors erklären, warum sie sich eine neue Hausmeisterin suchen müssen.“ Er blickt hinauf zum wolkenverhangenen Himmel, ehe er fortfährt: „Das Unwetter sollte in einer halben Stunde weitergezogen sein, dann können wir übersetzen.“
Ich schlucke den Kommentar herunter, dass ich in dem von ihm beschriebenen Szenario dafür gesorgt hätte, nicht als Einzige über Bord zu gehen, und starre ihn unschlüssig an.
„Wenn du dann so freundlich wärst, wieder ins Auto zu steigen und die Tür zu schließen?“ Mein Begleiter trommelt mit den Fingern auf das mit Leder bezogene Lenkrad.
Während ich mich auf den Beifahrersitz fallen lasse und die Tür etwas fester als nötig zuschlage, murmle ich ein leises „Mistkerl“ vor mich hin.
Ich meine, ihn lachen zu hören, doch als ich ihm einen raschen Seitenblick zuwerfe, ist seine Miene so undurchdringlich wie zuvor.
Durch meine Lüftungsaktion ist die Wärme im Inneren des Wagens in der Zwischenzeit verpufft und ich spüre, wie ich unter meinen nassen Klamotten eine Gänsehaut bekomme. Ich hebe die Hände vor die Lippen und hauche meinen warmen Atem hinein, doch er kann die viel tiefer gehende Kälte nicht vertreiben.
Im nächsten Moment erwacht der Motor des Wagens mit einem Stottern zum Leben und mein Begleiter macht sich an den Reglern der Heizung zu schaffen, bis mir wenige Sekunden später wieder lauwarme Luft entgegenströmt.
„Danke“, murmle ich und halte meine klammen Finger direkt vor das Gebläse. Mit jeder Sekunde, die vergeht, wird die Luft wärmer. Meine Fingerspitzen prickeln und ich muss mich zusammenreißen, um nicht genüsslich zu stöhnen.
„Nichts zu danken, das war reiner Eigennutz“, erwidert er in geschäftsmäßigem Ton. Irritiert von seiner Antwort ziehe ich die Augenbrauen zusammen. Doch bevor ich nachfragen kann, was er damit gemeint hat, fährt er fort: „Ich wollte lediglich verhindern, dass du dich erkältest und ich morgen schon wieder auf die Insel fahren muss, um dir eine Hühnersuppe vorbeizubringen.“ Dieses Mal klingt seine Stimme weniger feindselig. Fast freundlich genug, um ihm zu glauben, dass er wirklich die Art von Kerl ist, die einer Frau heiße Suppe bringt, wenn sie krank ist. Aber auch nur fast.
„Wohnst du hier in Dunquin?“, frage ich und nicke vage mit dem Kopf in Richtung der paar Häuser, die in einigen hundert Metern Entfernung auf der gegenüberliegenden Straßenseite nur als weiße Schemen zu erkennen sind.
„Ja.“ Seine Kiefermuskulatur spannt sich an.
„Ist bestimmt ganz nett hier, wenn es mal nicht regnet“, sage ich, motiviert durch die paar Sätze, die wir eben miteinander gewechselt haben, und die fast schon als Gespräch durchgehen könnten.
Seine Antwort ist nicht mehr als ein unbestimmtes Brummen, das ich als Zustimmung deute.
„Und du hast ein eigenes Boot?“ Ich versuche, mich nicht von seiner abweisenden Art einschüchtern zu lassen.
„Es gehört meinem Vater. Von April bis September fahre ich zu den Stoßzeiten einmal pro Stunde die Tagestouristen zur Insel.“
„Dann teilst du dir die Überfahrten mit ihm? “, frage ich in der Hoffnung, etwas mehr über ihn und seine Familie herauszufinden.
„Es gibt nur mich“, erwidert er und seine Stimme ist so abweisend, dass sich mein Magen zusammenzieht.
„Oh.“ Es ist mehr ein Laut als eine Antwort. Denn die Kombination aus seinen Worten, seinem versteinerten Gesichtsausdruck und den verkrampften Schultern verrät mir deutlich, dass ich voll in ein Fettnäpfchen getreten bin. Was auch immer hinter dem offensichtlich angespannten Verhältnis zu seinem Vater steckt, es ist mehr als offensichtlich, dass er es mir nicht erzählen will. Während mein Begleiter stumm bleibt, durchsuche ich mein Gehirn verzweifelt nach einer harmloseren Frage.
„Du fährst einmal pro Stunde zur Insel raus? Lohnt sich das überhaupt?“ Ich klammere mich an dem unverfänglichen Informationsbrocken fest, den er mir vorhin zugeworfen hat.
Glücklicherweise beißt er an und seine düstere Stimmung verklingt langsam, als er antwortet: „Im Sommer ist hier die Hölle los. Da ist die Fähre oft schon Tage im Voraus ausgebucht.“
Ich habe mir einige Fotos von Great Blasket Island im Internet angesehen und stets wirkte die Insel menschenleer. Unendliche grüne Wiesen, die sich bis zu den Steilküsten erstrecken, lediglich von ein paar grasenden Schafen bevölkert.
„Hast du dir die Jobbeschreibung überhaupt durchgelesen, bevor du dich beworben hast?“ Ein amüsiertes Schnauben begleitet seine Frage.
Mein Herz zieht sich schmerzhaft zusammen und ich spüre das vertraute Brennen hinter meinen Augenlidern. Ich schüttle das Gefühl der Trauer, das sich wie wabernder Nebel über mein Bewusstsein legen will, energisch ab. Natürlich habe ich mir die Jobbeschreibung nicht durchgelesen. Ich habe mich nicht einmal für den Job beworben. Das hat meine Schwester getan; die einzige Person, die mutig genug war, so eine Aktion durchzuziehen. Die einzige Person, für die ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Das kann und will ich dem Fremden neben mir jedoch nicht anvertrauen.
„Kaffeekochen und nebenher ein bisschen mit den Gästen plaudern werde ich gerade noch so hinbekommen. Danke für dein Vertrauen.“ Ich verziehe den Mund zu einem säuerlichen Lächeln.
Der Blick, der mich aus seinen hellblauen Augen trifft, ist eine Mischung aus Spott und Mitleid, und ich frage mich unwillkürlich, worauf ich mich hier eingelassen habe.
„Hast du in deiner Umzugskiste auf Rädern eigentlich auch richtige Klamotten?“, fragt er mit einem Seitenblick, der meine durchweichten Sneaker, die Jeanshose und die dünne Regenjacke einschließt.
„Ich habe einen Regenschirm im Koffer“, erwidere ich und komme mir ziemlich naiv vor, schon während die Worte meine Lippen verlassen.
Das als Räuspern getarnte Lachen meines Begleiters verstärkt dieses Gefühl. „Dir ist schon bewusst, dass es hier in Irland mindestens die Hälfte der Zeit regnet und die andere Hälfte stürmt? Manchmal sogar beides gleichzeitig. Habt ihr in Deutschland kein Internet?“
„Woher weißt du, dass ich aus Deutschland komme?“ Ich greife die einzige Frage auf, die mich zumindest nicht direkt beleidigt hat.
Jetzt lacht er offen, sein Blick hat wieder diesen amüsiert mitleidigen Ausdruck angenommen, so als wäre die Antwort auf meine Frage derart offensichtlich, dass es keiner Worte bedarf.
Im nächsten Moment dreht er den Schlüssel im Zündschloss und das Knattern des altersschwachen Motors erstirbt. Ohne ein weiteres Wort öffnet er die Fahrertür und steigt aus.
Irritiert von seinem plötzlichen Abgang starre ich ihm nach, wie er den Pick-up umrundet. Bevor ich zu einer Entscheidung gelangt bin, ob ich ihm folgen oder sitzen bleiben soll, steht er auch schon neben der Beifahrertür und öffnet sie. Kalte Luft drängt in den Wagen und ich ziehe meine Jacke enger um meinen Oberkörper.
„Was ist jetzt? Ich dachte, du willst so schnell wie möglich auf deine Insel.“ Mein Begleiter hebt eine Augenbraue und trommelt mit den Fingern gegen den Türrahmen, was ein dumpfes Geräusch erzeugt. Seine dunkelbraunen Haare, die ihm bis zu den Wangenknochen reichen, fallen ihm ins Gesicht. Und für den Bruchteil einer Sekunde verspüre ich den Drang, meine Hand auszustrecken und sie ihm zurück hinter die Ohren zu schieben. Ich schüttle das merkwürdige Verlangen von mir ab.
„Du hast doch gesagt, dass wir wegen des Sturms nicht fahren können.“
„So ein Glück, dass der Sturm mittlerweile vorbeigezogen ist.“ Er spricht die Worte betont langsam und deutlich aus, während es in seinen Augen blitzt.
Ich löse meinen Blick von seinem Gesicht und sehe durch die von Schlieren durchzogene Frontscheibe nach draußen. Tatsächlich hat sich das dunkle Grau am Himmel in ein helleres verwandelt, so als hätte der Sturm einige der Nebelschleier hinfort getragen. Die Wärme im Inneren des Wagens und unser Gespräch haben mich derart abgelenkt, dass ich die Welt jenseits der Scheiben gar nicht mehr wahrgenommen habe.
Peinlich berührt steige ich aus, den Kopf gesenkt, damit mein Begleiter meine geröteten Wangen nicht bemerkt. Doch diese Sorge stellt sich als unbegründet heraus, da er schon längst nicht mehr neben mir steht. Als ich mich suchend umsehe, entdecke ich ihn auf dem asphaltierten Weg, der zum Pier hinab führt, mein Rollkoffer steht neben ihm. Die Frage, ob ich tatsächlich einen Funken Gentleman aus ihm hervorkitzeln konnte oder er mich einfach nur so schnell wie möglich loswerden will, möchte ich mir lieber nicht beantworten.
„Danke, wie überaus aufmerksam von dir.“ Ich kann mir den Spruch nicht verkneifen, als ich ihn einhole und die rechte Hand um den Griff des Koffers schließe.
Er schnaubt, doch es klingt nicht unfreundlich.
Zögernd folge ich ihm den Weg entlang, der nach wenigen Metern im Nichts zu verschwinden scheint.
Kian ist 23 Jahre alt und lebt schon seit seiner Kindheit in dem kleinen Fischerdorf Dunquin im Westen Irlands. Als Fährmann ist er Emmas einzige Verbindung zur Außenwelt. Zu Beginn wirkt er sehr verschlossen, teils sogar etwas schroff. Doch mit der Zeit lernt Emma ihn näher kennen und schafft es einen Blick unter die harte Schale zu werfen, unter der sich ein sehr einfühlsamer und fürsorglicher junger Mann verbirgt. Kian ist es, der Emma in schweren Zeiten zur Seite steht und ihr gebrochenes Herz Stück für Stück wieder zusammensetzt.
Emma ist 22 Jahre alt und ist ein sehr zielstrebiger und strukturierter Mensch. Für ihre Zukunft hat sie bereits einen genauen Plan, der durch das Eingreifen ihrer Schwester gehörig durcheinander gewirbelt wird. Eigentlich ist Emma sehr extrovertiert, seit dem Tod ihrer Schwester lässt sie jedoch niemanden mehr an sich heran. Erst Kian schafft es, zu ihr durchzudringen. Emma ist außerdem ein großer Harry Potter Fan. Sie sammelt die Bücher in unterschiedlichen Sprachen zuhause in ihrem Bücherregal in Frankfurt. Ihr Guilty pleasure sind Rosamunde-Pilcher-Filme.
Wie bist Du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Die Inspiration für „All those breaking Waves“ entstammt einer real existierenden Jobanzeige. Jedes Jahr wird ein neuer Caretaker für Great Blasket Island gesucht, der oder die sich um das Café für die Tagesgäste und die beiden Ferienwohnungen kümmert. Die Vorstellung ein halbes Jahr auf eine einsame Insel zu ziehen, fand ich unglaublich faszinierend. Dank Emma konnte ich quasi Teil dieses Abenteuers sein.
Worum geht es in dem Buch?
Mut spielt in dem Buch eine große Rolle. Mutig genug zu sein, um sich von den Erwartungen anderer Menschen zu lösen und seine eigenen Träume zu verfolgen. Mutig genug zu sein, sich anderen gegenüber zu öffnen und auch Mal ein Risiko einzugehen.
Was ist das Besondere am Setting?
Die Geschichte spielt auf einer kleinen Insel im Westen Irlands. Auf Great Blasket Island gibt es keinen Strom und außer Emma leben nur eine Handvoll Schafe dort. Es übernachten auch einige Touristen in den Cottages, aber die Natur nimmt einen großen Part ein. Während ihrer Zeit auf der Insel erlebt Emma viele kleine Wunder wie einen Ausflug zu einer Kolonie von Papageientauchern, eine Bootsfahrt Seite an Seite mit Walen, einen Spaziergang durch am Strand dösende Robben und vieles mehr.
Wie würdest du die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren Emma und Kian beschreiben?
Es handelt sich um eine Haters-to-Lovers Geschichte und damit einhergehend um eine Slowburn-Romance. Die beiden bekommen sich gerade zu Beginn immer wieder in die Haare, was zu lustigen Schlagabtauschen führt. Doch wenn es darauf ankommt, ist Kian für Emma da und zeigt ihr durch kleine und große Gesten, dass er sich um sie sorgt. Beide haben Angst davor, verletzt zu werden und es ist schön zu beobachten, wie sich gegenseitig langsam öffnen.



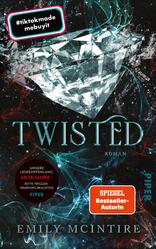
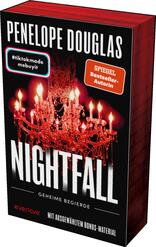




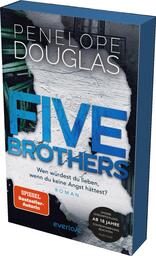















DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.