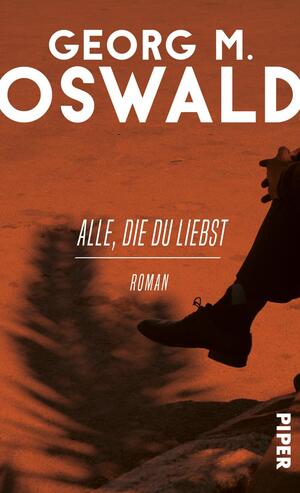
Alle, die du liebst - eBook-Ausgabe
Roman
„…ein furioser Familienroman aus der Arschlochperspektive…“ - SPIEGEL Online
Alle, die du liebst — Inhalt
Der Anwalt Hartmut Wilke ist gewohnt zu bekommen, was er möchte. Zum Beispiel Ines, seine um zwanzig Jahre jüngere Freundin. Doch seit einiger Zeit laufen die Dinge nicht mehr so gut für ihn. Die Regeln, nach denen er zu spielen gewohnt war, scheinen nicht mehr zu gelten. Beruflich strauchelt er, und in seinem unerbittlichen Scheidungskrieg hat er den letzten Rückhalt nicht nur seiner Frau, sondern auch seiner Kinder verloren. Da erreicht ihn überraschend eine Postkarte seines ältesten Sohns. Erik, der Wilkes Ansprüchen nie gerecht werden konnte, betreibt eine Strandbar auf Kiani Island im Indischen Ozean und lädt ihn dorthin ein. Wilke möchte sich mit ihm aussöhnen und macht sich mit Ines auf die Reise. Aber ganz anders als erwartet, wird der Aufenthalt dort zu einem endgültigen Wendepunkt in Wilkes Leben.
Leseprobe zu „Alle, die du liebst“
1.
Ich wollte meinen Sohn wiedersehen, egal wie schwierig es werden würde, und Ines unterstützte mich dabei. Wir landeten in Mombasa und stiegen nach der Passkontrolle und einigen eher umständlichen Formalitäten in eine zweimotorige Propellermaschine, die uns nach Malindi flog. Mit uns waren etwa zwanzig Leute an Bord. Wir kauerten auf kleinen, mit dünnem, grauem Kunststoff überzogenen Metallsitzen. Das Dröhnen der Triebwerke erfüllte die Kabine und machte jede Unterhaltung unmöglich. Ines und ich hatten während des vorangegangenen Nachtflugs kaum ein [...]
1.
Ich wollte meinen Sohn wiedersehen, egal wie schwierig es werden würde, und Ines unterstützte mich dabei. Wir landeten in Mombasa und stiegen nach der Passkontrolle und einigen eher umständlichen Formalitäten in eine zweimotorige Propellermaschine, die uns nach Malindi flog. Mit uns waren etwa zwanzig Leute an Bord. Wir kauerten auf kleinen, mit dünnem, grauem Kunststoff überzogenen Metallsitzen. Das Dröhnen der Triebwerke erfüllte die Kabine und machte jede Unterhaltung unmöglich. Ines und ich hatten während des vorangegangenen Nachtflugs kaum ein Auge zugetan und waren völlig erschöpft. Auch die Tabletten zur Malariaprophylaxe hatten damit zu tun. Wir nahmen sie gemäß ärztlicher Anordnung schon seit einigen Tagen ein. Obwohl sie angeblich ohne Nebenwirkungen sein sollten, fühlten wir uns schlapp, und unsere Mägen rebellierten.
Dumpf vom Lärm verbrachte ich die Flugzeit damit, meine Mitreisenden anzustarren. Da waren vier weiße, durchtrainierte Männer mit Bürstenhaarschnitten. Sie trugen Zivil, dennoch hielt ich sie für amerikanische Militärs. Eine Gruppe von fünf oder sechs schick und teuer gekleideten jungen Männern und Frauen wirkten auf mich, als hätten sie, wie ich, die Nacht durchgemacht, allerdings freiwillig und auf Partys. Sie sahen arabisch aus, waren aber gekleidet wie westliche Jeunesse dorée. Sie wussten, wie man sich miteinander unterhielt, ohne sich zu hören, und schienen ihren Spaß zu haben. Neben uns saß die einzige Schwarze in der Maschine, eine ernste junge Frau mit drei kleinen Kindern. Die übrigen Passagiere waren Paare oder einzelne Reisende. Ich dachte an einen Satz des Tropenarztes, der uns geimpft und die Medikamente verschrieben hatte: „Sie sollten einen guten Grund für diese Reise haben. Abenteuerlust würde ich nicht dazu zählen.“
Wir hatten einen weitaus besseren: Erik, meinen Sohn. Ines und ich waren getrennt zum Tropenarzt gegangen. Als wir unser Reiseziel nannten, hielt er sie für eine Entwicklungshelferin, mich für einen Sextouristen. Er sagte es nicht so direkt, fragte Ines aber, für welche Organisation sie arbeite, und mich, ob auch eine HIV-Rate von über fünfzig Prozent meinem Reisewunsch nichts anhaben könne.
Ich versuchte, Überlegungen anzustellen, aus welchen Gründen die anderen in diesem Flugzeug saßen, kam damit aber natürlich nicht sehr weit. Um die Mittagszeit setzte die Maschine sanft auf der Landebahn des Malindi Airport auf.
Als wir auf die Gangway ins Freie traten, hielten wir Ausschau nach Erik, aber sahen ihn nirgends.
„Ich hab’s geahnt“, sagte ich, und im selben Augenblick tat es mir leid.
Ines sah mich kritisch an. „Er hat versprochen, uns abzuholen. Also wird er schon kommen.“
Das Flugfeld war fast ganz leer, es herrschte kaum Betrieb. Ein paar Arbeiter in abgerissenen Kleidern wuchteten das Gepäck aus dem Frachtraum auf einen wackeligen Kofferwagen, bis er völlig überladen war, und fuhren ihn, seltsamerweise ohne auch nur ein Stück zu verlieren, zum Flughafengebäude.
„Siehst du ihn irgendwo?“, fragte ich Ines, als könne sie Erik leichter entdecken als ich, obwohl sie ihn nur von ein paar Fotos im Internet kannte.
„Nein, wahrscheinlich ist er da drin“, erwiderte sie.
Sie deutete auf den Teil des Flughafengebäudes, in dem sie die Ankunftshalle vermutete. Bereits jetzt spürte ich, wie meine sorgfältig ausgewählte Tropenkleidung begann, mir am Körper zu kleben. Es herrschte eine stechende Hitze. Aus meinem Rucksack, den ich als Handgepäck dabeihatte, zog ich eine sandfarbene Kappe und setzte sie mir auf. Ich kam mir idiotisch vor in diesen Klamotten, aber wir hatten nichts dem Zufall überlassen und uns in einem Outdoor-Laden ausstaffieren lassen. Der Verkäufer war nicht davon abzubringen gewesen, uns als Abenteurerpärchen zu betrachten, das sich in seinem Jahresurlaub mit Vorliebe ungewohnten, ja gefährlichen Situationen aussetzte. Vereinzelt und in kleinen Grüppchen standen wir auf dem Rollfeld herum und waren unschlüssig, ob wir abgeholt würden oder uns selbst auf den Weg machen sollten. Zu unserer Überraschung kamen keine Stewards, sondern zwei Soldaten in Kampfanzügen und weinroten Baretts vom Flughafengebäude auf uns zu und winkten uns, wenig zuvorkommend, zu sich. Wir bewegten uns in ihre Richtung und traten in eine recht übersichtliche Halle ein. Auch dort konnte ich Erik nirgends entdecken. Das Gepäck unseres Fluges lag auf einem großen Haufen neben einem Tisch, hinter dem sich einer der beiden Soldaten aufstellte. Der andere wies uns barsch an, uns in eine Reihe zu stellen. Ich war erleichtert, als ich in dem Berg von Koffern unsere beiden erspähte. Wir nahmen sie auf und warteten, bis wir dran waren. Der Mann hinter dem Tisch winkte zuerst, ohne sie anzusehen, Ines mit herrischer Geste weiter. Dann kommandierte er mich mit dem Zeigefinger zu sich und verlangte mit knappen, energischen Handzeichen, ich solle meinen Koffer vor ihm auf dem Tisch öffnen.
Ich war oft genug auf Reisen, um zu wissen, dass es keinen Sinn hat, sich mit dem Sicherheitspersonal anzulegen. Ich lächelte ihn verbindlich an, um ihn milde zu stimmen, doch erwartungsgemäß reagierte er nicht darauf. Er ließ mich die Zahlenschlösser öffnen. Vielleicht fühlte er sich durch meine ausgestellte Freundlichkeit sogar ein wenig provoziert. Er bedeutete mir zurückzutreten und begann, aufreizend langsam, meine Sachen zu inspizieren. Ein Stück nach dem anderen lüpfte er zwischen Daumen und Zeigefinger hoch und begutachtete es, teils spöttisch, teils so, als überlegte er, es für sich zu behalten. Er wartete nur auf meinen Protest, aber den Gefallen tat ich ihm nicht. Ein Adapter hatte sein besonderes Interesse geweckt, er behielt ihn in der linken Hand, während er mit der rechten ein Paar Kopfhörer aus der Seitentasche zog. Beides hielt er mir mit einem Stirnrunzeln entgegen, so als habe sich ein schlimmer Verdacht bestätigt.
„Adapter. Headphones“, sagte ich, wobei es mir nicht vollständig gelang, meinen Ärger zu unterdrücken. Meine Erklärung schien ihn nicht zufriedenzustellen. Wir sahen uns ein wenig länger in die Augen, als der Situation angemessen gewesen wäre. Ich glaubte, leisen Spott in seiner Miene zu finden. Ohne den Blick von mir zu nehmen, ließ er die Sachen in den Koffer fallen und schickte mich mit dem gleichen herrischen Winken weiter wie zuvor Ines. Ich selbst musste meinen Koffer wieder schließen, was mir nicht auf Anhieb gelang. Der Soldat trieb mich, jetzt unfreundlich und ziemlich lautstark, zur Eile an. Ich zog den Koffer vom Tisch, er knallte zu Boden, Ines sprang herbei. „Lass nur, ich mach das schon!“, fuhr ich sie an, überflüssigerweise. Der Soldat dachte nicht daran, uns zu helfen oder sich auch nur zu entschuldigen. Er ignorierte uns ostentativ und war schon mit den Nächsten beschäftigt. Ich baute mich auf, holte tief Luft, bevor mich Ines am Arm zog.
„Das bringt doch nichts“, sagte sie.
Wütend und zugleich erleichtert, die erste Hürde hinter uns zu haben, schleppten wir unsere Habe bis zur nächsten Schlange, die zur Passkontrolle anstand.
Ein sehr junger, schmächtiger Soldat ging von einem der Wartenden zum nächsten und drückte jedem ein fotokopiertes Blatt in die Hand. Was darauf stand, war kaum leserlich, ich faltete es zusammen und legte es in meinen Pass. Es dauerte ewig, bis wir an die Reihe kamen. Eine dralle Frau mit aufwendig ondulierten Haaren in einer andersfarbigen Uniform verglich finster und streng unsere Passfotos mit unseren Gesichtern. Als wir schon glaubten, es gäbe nichts auszusetzen, tauchte ein älterer, höherrangiger Soldat hinter ihr auf und stellte ihr barsche Fragen, auf die sie, wie es schien, keine guten Antworten hatte. Er zupfte ihr die Pässe aus der Hand, gab sie uns zurück und redete laut auf uns ein. Ich verstand die Worte Visa, permission und fifty dollars. Wir hatten die Visa in Deutschland bezahlt und entsprechende Stempel in unseren Pässen. Ich setzte an, ihm das zu erklären, aber er ließ mir nicht die Zeit dazu, sondern entriss mir den Pass wieder, nahm den Zettel heraus, strich ihn mit wilden Bewegungen auf dem Pult vor sich glatt und hielt ihn mir dicht vor die Nase.
„No permisson! You pay!“
Köpfe drehten sich in unsere Richtung. Die gedemütigten Blicke der ondulierten Frau sagten mir, ich solle besser verstehen.
„How much?“, fragte ich umstandslos. Dies war natürlich nichts weiter als ein Erpressungsversuch. Aber das Theater musste ein Ende haben.
„Fifty dollars, each“, sagte er, wie jemand, der zufrieden ist, dass seinen Anweisungen endlich Folge geleistet wird. Ich zog meinen Geldbeutel aus der Seitentasche meiner Hose. Auf der Homepage des Bundesaußenministeriums mit den Reisewarnungen, die ich eingehend studiert hatte, war zu lesen, dass man genau das nie tun sollte: seine Geldbörse in aller Öffentlichkeit herausziehen, um ihr große Scheine zu entnehmen. Aber war es vielleicht für irgendjemanden eine Überraschung, dass wir, gut gekleidete Europäer mit großem Gepäck, nach hiesigen Verhältnissen unermesslich reich waren? Ich zog zwei Fünfzig-Dollar-Noten heraus. Eine davon entsprach in etwa dem durchschnittlichen Monatslohn in diesem Land. Vielleicht war der Soldat gerade dabei, den seinen zu verdreifachen, und demonstrierte vor aller Augen, mit mir sei das ohne große Anstrengung zu machen. Ich gab dem Mann die Scheine.
„Die steckt der sich sofort in die eigene Tasche“, knurrte ich.
„Dann kriegen er und seine Familie vielleicht mal was Vernünftiges zu essen“, hielt Ines dagegen.
„Oder er versäuft’s“, sagte ich.
Wir durften in die Ankunftshalle, wo in einem weiten Halbkreis Dutzende Männer Pappschilder mit Namen in lateinischer und arabischer Schrift hochhielten. Ich achtete nicht weiter auf sie, denn Erik musste hier irgendwo stehen. Aber ich fand ihn nicht. Ich zog mein Smartphone aus der Tasche und wählte seine Nummer, die Nummer, unter der ich ihn in den vergangenen Wochen während der Reisevorbereitungen immer problemlos erreicht hatte. Jetzt nahm er nicht ab. Ich sprach ihm auf die Mailbox und bemühte mich, dabei so wenig vorwurfsvoll oder gar verzweifelt zu klingen wie möglich.
„Er wird jeden Moment zurückrufen“, sagte ich zu Ines, die die Stirn runzelte. Ich hatte ihr schon gesagt, Erik sei jederzeit für Überraschungen gut, aber dass er uns derart hängen ließ, nachdem die letzten Wochen ganz im Zeichen der Wiederannäherung gestanden hatten, erstaunte mich. Erik wollte, dass wir ihn besuchen kommen. So jedenfalls hatte er sich immer wieder geäußert. Schließlich sollte ich das Leben kennenlernen, das er sich hier, fernab meines eigenen, aufgebaut hatte. Je länger wir herumstanden, desto mehr wurden wir, devot und doch hartnäckig, von Männern bedrängt, die uns ihre Fahrdienste anboten. Viele von ihnen machten einen erbärmlichen Eindruck, arm und in Lumpen. Irgendwoher tauchte plötzlich ein lächelnder junger Kerl auf, kam direkt auf uns zu und griff nach meinem Koffer.
„Kiani, Sir. I’ll bring you to Kiani. Mister Jack is awaiting you. Come my way.“
Ich war irritiert. „Mister Jack“ war ein Name, den Erik einige Male erwähnt hatte. Angeblich war Mister Jack eine Art Immobilien-Tycoon. Der Mann, der ihm die Strandbar verkauft hatte, die Erik nun betrieb. Sein „Geschäftspartner“, wie er ihn nannte. Zugegeben, mir stellten sich bei dieser Bezeichnung die Nackenhaare auf.
„You know Erik? Erik Wilke? He’s my son.“
„Yes, sure I know Mister Erik. I know Mister Jack, Mister Erik. I’ll bring you to him.“
Ich sah Ines fragend an, die mit den Achseln zuckte und nicht abgeneigt schien, sich auf sein Angebot einzulassen. Das animierte die Umstehenden, es ebenfalls noch einmal zu versuchen, bis einer von ihnen, deutlich besser gekleidet als die anderen, zu uns durchdrang und seine Konkurrenten mit Gefuchtel und Flüchen verscheuchte. Er schlug nach dem jungen Mann, der sich wegduckte und schrie:
„You want to go to Mister Erik, you come with me, he sent me! This man is a crook, he can’t say who sent him.“
Das Weiße in seinen Augen war stark gerötet, ich fragte mich, ob er betrunken war oder unter Drogen stand.
„You are Hartmut Wilke, and Mister Erik is the owner of the Boko-Boko-Bar and a good friend of Mister Jack and your son and he sent me to pick you up because he can’t come, so you come with me and I bring you to Kiani, my name is James, I carry your luggage.“ Er griff nach unseren Koffern.
Wir ließen ihn gewähren.
„How did your colleague know we are going to Kiani? And why?“, fragte ich ihn.
„He is not my colleague. He knew because you look like. And because everybody knows.“
Die Antwort bestätigte mich in der Annahme, wir seien leichte Beute und als solche einfach zu erkennen. Konnten wir denn sicher sein, dass James die Wahrheit sagte? Wir hatten nichts außer seiner, allerdings glaubwürdigen, Behauptung. Woher sollte er meinen Namen haben, wenn nicht von Erik? Doch unabhängig davon sorgte ich mich um seine Fahrtüchtigkeit. Er war sehr wahrscheinlich von irgendetwas high. Zielstrebig, in jeder Hand einen Koffer, führte er uns aus dem Flughafengebäude hinaus zu einem japanischen Kleinbus. Der Wagen wäre in Deutschland sofort aus dem Verkehr gezogen worden. Für hiesige Verhältnisse schien er vollkommen in Ordnung zu sein.
Wir fuhren auf einer Landstraße nach Norden. Ich sah, wie James sich ein paar Blätter in den Mund schob, auf denen er dann lange herumkaute. Er beschleunigte den Wagen so lange, bis ein Alarmsignal ertönte, ähnlich dem synthetischen Glockenton beim Anschnallen. Musste er aus irgendeinem Grund kurz das Tempo drosseln, stieg er gleich danach wieder so lange aufs Gas, bis der Ton erklang.
Ines fragte ihn, ob es ihm etwas ausmache, langsamer zu fahren.
„No, no, no. No problem“, sagte er, behielt aber das Tempo unvermindert bei. Ich startete einige Versuche, mich mit ihm zu unterhalten, aber wir kamen recht schnell an unsere sprachlichen Grenzen. Ich wollte mit ihm über die Sicherheitslage im Land sprechen, über die Überfälle auf Touristen, die Entführungen und die Attentate auf die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern. Ich hatte die Warnungen der offiziellen Stellen im Internet gelesen, aber Erik hatte mir stets versichert, sie seien völlig überzogen.
„In Deutschland sterben jedes Jahr fünftausend Menschen auf den Straßen. Fährst du deshalb nicht mehr Auto? In der Region sind in den letzten zwei Jahren ein paar Überfälle passiert, ja, aber das waren jeweils ganz bestimmte Situationen, in denen sich Leute unnötig in Gefahr gebracht haben. Oder es handelte sich um Stammesfehden. Insgesamt gab es ein paar Dutzend Tote. Das ist kein Grund, nicht mehr ins Land zu kommen. Okay, es ist Afrika, aber es ist wunderschön!“
Als ich anzweifelte, was er sagte, erklärte er, falls wir kämen, würde er für unsere Sicherheit garantieren.
„Hier auf Kiani kann euch nichts geschehen, bei mir seid ihr absolut safe.“
Ines war nicht gerade der ängstliche Typ, und die Fotos, die uns Erik von seinem Haus, dem Strand, den Straßen von Kiani mailte, bildeten eine malerische, tropische Idylle ab, die sich mit den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes kaum in Einklang bringen ließ. Letztlich mussten wir uns auf das verlassen, was Erik uns erzählte, und wir mussten uns entscheiden, ob wir ihm unser Vertrauen schenkten oder nicht. Und genau darum ging es ja wohl bei dieser ganzen Reise, um Vertrauen, das enttäuscht worden war und wiederhergestellt werden sollte. So betrachtete ich es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Ungläubig starrten wir aus den Fenstern und sahen überall Armut, Krankheit, schiere Not. Wir schienen etwas anderes zu sehen als James, der bester Stimmung war. Er stellte sich als zuverlässiger Fahrer heraus und setzte uns wie vereinbart an der Ablegestelle der Fähre nach Kiani Island ab.
Er wartete mit uns auf das Boot, hatte ein Auge auf unser Gepäck und verjagte bettelnde Kinder, wieder mit einer Heftigkeit, die Ines protestieren ließ.
Noch immer hörten wir nichts von Erik. Er rief nicht zurück, sendete keine Nachricht, nichts. Ich war nun eher in Sorge, es könnte irgendetwas geschehen sein, als verärgert. Wir hatten uns seit Jahren nicht gesehen, uns über seinen Wunsch, eine Bar am Strand von Kiani Beach zu kaufen, endgültig entzweit, weil er dafür Geld von mir wollte, das er von mir nicht bekam, und nun hatte es sich ergeben, dass wir ihn genau hier besuchten. War das nicht eine späte Anerkennung seiner Entscheidung, die ihm guttun musste?
Die Fähre war, wie sich herausstellte, nicht mehr als ein langer, schmaler Kahn, angetrieben von einem tuckernden, kleinen Außenbordmotor. In Booten ähnlich dem unseren, die neben uns fuhren, sah ich einige der Leute wieder, die ich im Flugzeug beobachtet hatte. Die vier amerikanischen Soldaten, die jungen Araber, die Frau mit den drei Kindern. In Sichtweite lag der Hafen von Kiani Town, auf den wir nun zufuhren. Mit uns im Boot saßen eine Engländerin, ein Australier, ein Italiener, ein Franzose. Wir stellten uns einander nicht wirklich vor, aber fanden es, so eng wir aufeinanderhockten, doch angebracht, wenigstens zu sagen, woher wir kamen. Die Uferpromenade von Kiani präsentierte sich so malerisch wie imposant, was vor allem an den ungewöhnlich großen, alten Bauten im maurischen Stil lag, die im besten Zustand zu sein schienen. Soweit ich sehen konnte, waren es Wohn- und Geschäftshäuser, Moscheen. Wir hielten auf eine Insel zu, die von vielen Problemen des Festlandes verschont war. Das jedenfalls erzählten die Reiseführer. Während die verarmten Bewohner der Küstenorte wenig erfolgreich versuchten, ein bisschen vom Tourismus auf Kiani Island zu profitieren, wusste man sich dort offenbar wirkungsvoll abzuschotten. Anders als diese Siedlungen war die Insel stark islamisch geprägt. Schon der erste Blick auf den Hafen bestätigte das.
Auf der Kaimauer herrschte reger Betrieb. Ein Massai fiel mir auf, in leuchtend rotes Tuch gehüllt. Er lief unruhig hin und her, als erwarte er jemanden oder etwas. Die meisten Menschen trugen arabische Kleidung, er sah so fremd unter ihnen aus, dass ich mich fragte, ob er vielleicht nur als Touristenattraktion auftrat. Doch dafür wirkte er zu sehr mit irgendetwas anderem beschäftigt, lief hin und her, hin und her. Wir legten an einem der Piers an. Helfende Hände reckten sich nach uns, und nach einem Satz hatten wir festen Boden unter den Füßen. Als ich mich umsah, war der Massai plötzlich verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst, und im nächsten Moment, ich hatte ihn gar nicht kommen sehen, stand Erik vor mir. Sein Anblick machte mich sprachlos. Er trug einen Vollbart, wie ein islamischer Prediger, war ganz in Weiß gekleidet und trug das, was man, glaube ich, eine Kurta nennt, sowie eine weiße Gebetsmütze. Ich hatte ihn noch nie mit Bart gesehen. Falls er zum Islam konvertiert war, hatte er das äußerst diskret für sich behalten. Ich musste an die rätselhafte Postkarte denken, die er mir zweimal geschickt hatte:
Dieses Verbrechen hat mir mein Vater angetan
Ich habe niemandem dieses Verbrechen angetan.
Grabinschrift des Abu l-’Ala’ al Ma’arri (11. Jahrhundert)
Ich stellte mir eine ganze Menge Fragen auf einmal. Erik war, soweit ich das beurteilen konnte, nie besonders religiös gewesen. Carla und ich hatten auch keinen großen Wert auf eine christliche Erziehung gelegt. Einer der Punkte, in denen wir uns ausdrücklich einig gewesen waren. Ich muss zugeben, ich fand seinen Aufzug alarmierend. Ansonsten sah er sehr gut aus, bronzefarbene Haut, schlank, gesund, kräftig. Ich konnte nicht anders, als ihn lange und fest zu umarmen, und er erwiderte diese Umarmung so herzlich, dass ich in diesem Augenblick den Entschluss fasste: Was auch immer uns in den vergangenen Jahren auseinandergebracht hatte und was auch immer jetzt zwischen uns stehen mochte, wir würden es nun aus dem Weg räumen, und so wie er sich anfühlte, sah er das offenbar genauso.
Ich stellte ihm Ines vor, die er sichtlich erfreut und zu meiner Erleichterung mit westlicher Lässigkeit begrüßte. Die beiden waren etwa gleich alt und sie schienen sogleich die Faszination zu verspüren, die Gleichaltrige in vielen Fällen miteinander verbindet. Ich muss zugeben, dass der bloße Anblick der beiden mich mit Eifersucht erfüllte, weil mir klar war, wo immer wir zu dritt auftauchten, würden sie für das Paar gehalten werden und ich für den Papa. Aber der Gedanke beschäftigte mich nicht lange, denn Erik, mit dem ich über Jahre hinweg nicht mehr geredet hatte, als es in zwei verbissen geführten Telefongesprächen möglich gewesen war, schien sich vorgenommen zu haben, das Versäumte nachzuholen. Er wirkte aufgeräumt und offen.
„Wundert euch nicht über meinen Aufzug“, sagte er, „aber er erklärt vielleicht, warum ich euch nicht vom Flughafen abholen und noch nicht einmal Bescheid geben konnte.“
„Wieso das?“, fragte ich.
Kinder kamen herbei und bettelten darum, unsere Koffer tragen zu dürfen. Erik herrschte sie an, sie sollten das Gepäck zu seinem Auto tragen, und war dabei so wie zuvor auch James, wie wir fanden, unnötig scharf. Er deutete auf einen sandfarbenen Land Rover Defender, der in knapper Entfernung von uns am Straßenrand stand.
„Ich hatte ein Treffen mit ein paar wichtigen Leuten, bei dem es um meine Konzession ging. Plötzlich standen zwei ihrer Männer vor meiner Tür und baten mich mitzukommen. Es wäre keine gute Idee gewesen zu sagen, ich hätte gerade keine Zeit.“
Es hätte mich interessiert, was das für wichtige Leute gewesen sein mochten und woran man „ihre Männer“ wohl erkannte, aber ich fragte nicht danach, vielleicht, weil ich nicht wollte, dass er sich zur Rede gestellt fühlte. Erik half uns mit unseren Sachen in seinen Wagen, und wir fuhren auf einer unbefestigten Straße am Strand entlang nach Süden. Die Insel schien mir nicht besonders groß, etwa nach zehn Minuten führte uns unser Weg nach Osten, immer weiter an dem kalkweiß in der Sonne leuchtenden, menschenleeren Sandstrand entlang, bis wir in einer kleinen Siedlung ankamen, vielleicht zehn, fünfzehn Einfamilienhäuser. Die älteren stattlich, vermutlich portugiesisch und aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, die neueren afrikanische Feriendomizile mit weißen Mauern, dunkelbraun eingelassenen Hölzern und kegelförmigen Strohdächern. Wir steuerten auf das prächtigste portugiesische Haus zu, das im Zentrum an einer Art Gemeindeplatz lag, eine Villa mit großer Terrasse, vor der Erik den Wagen parkte.
„Hier wohne ich“, sagte er.
Natürlich war ich beeindruckt, so beeindruckt, wie ich es sein sollte, nahm ich an. Das Gepäck ließen wir im Auto. Aus irgendeinem Grund zweifelte ich nicht daran, jemand würde es für uns ins Haus tragen. Zu meiner Überraschung war nicht abgesperrt, und in dem großen Wohn- und Esszimmer, das im Inneren direkt an die Terrasse anschloss, tummelte sich ein ganzer Haufen zwanzig- bis dreißigjähriger Menschen, die sich um unsere Ankunft nicht sonderlich kümmerten. Eine größere Gruppe hing, entspannt ineinander verschlungen, auf zwei Sofas vor einem topmodernen Flachbildschirm herum und sah sich einen Spielfilm an. Eine kleinere saß, in eine lebhafte Unterhaltung verwickelt, am Esstisch. Ein schwarzer junger Mann mit hüftlangen Dreadlocks kam uns auf dem Weg zum Fernseher entgegen und begrüßte Erik mit „As-Salamu ’alaikum, brother“, was eindeutig ironisch und auf dessen Aufzug gemünzt war und von Erik genauso vergnügt mit „Wa’alaikum us-salām, brother!“ beantwortet wurde.
„Das ist Doobie“, sagte Erik an uns gerichtet, stellte uns aber nicht vor. „Er ist Tauchlehrer bei Kiani Scuba. Eigentlich fast alle, die hier sind, arbeiten in der Tauchschule, oder in einer der Bars oder sonst irgendwie am Strand.“
Ich nickte, als wäre das eine wertvolle Information für mich.
„Ich gehe mich mal eben umziehen. Nehmt euch doch solange was aus dem Kühlschrank, wenn ihr wollt. Steht in der Küche dahinten am Ende des Ganges. Sollte noch was drin sein.“
Ines und ich blieben, wo wir waren, und sahen uns an. Sie war gut gelaunt, es gefiel ihr hier, und ihr Gesichtsausdruck sagte mir, ich solle mir jetzt nicht zu viel Mühe geben, etwas daran schlecht zu finden.
„Willst du einen Drink?“, fragte ich sie.
„Ich kann euch was mitbringen, bin sowieso gerade in die Küche unterwegs“, schaltete sich auf Deutsch mit amerikanischem Akzent eine schwarze Frau hinter mir ein, die etwas größer als ich war. Sie war jung, schlank, schön und lächelte entspannt.
„Ich bin Imani, Eriks Freundin. Er hat mir erzählt, Sie würden heute ankommen, aber nicht, wann. Sie sind sein Vater, nicht wahr?“
„Ja, der bin ich. Jetzt bin ich ziemlich überrascht, er hat Sie gar nicht erwähnt.“
„Das sieht ihm ähnlich. Aber er ist entschuldigt. Wir sind erst seit gestern ein Paar. Aber wir kennen uns schon länger.“ Sie wandte sich an Ines: „Und Sie sind?“
„Ich bin Hartmuts Freundin, Ines“, antwortete sie ein wenig säuerlich, was mich überraschte.
Imani überging es. „Ich mache uns jetzt eine Runde Gin Tonic, sind Sie dabei?“
„Sicher, gerne!“
Auf ihrem Weg in die Küche kam Erik Imani aus dem Schlafzimmer entgegen, jetzt in Shorts und T-Shirt, und sie gaben sich einen flüchtigen Begrüßungskuss.
„Ich habe gerade deinen Besuch auf Gin Tonics eingeladen. Willst du auch einen?“
„Ja, gerne, warum nicht?“ An uns gewandt sagte er: „Kommt mit, ich führe euch eben kurz durchs Haus.“
Das Wohn- und Esszimmer machte den weitaus größten Teil des Hauses aus. Daneben lagen, an einem Gang aneinandergereiht, drei kleinere Zimmer, in denen jeweils Betten standen, es gab ein geräumiges Badezimmer und die solide eingerichtete Küche.
„Nicht schlecht für einen Strandbarbesitzer“, sagte ich zu Erik.
„Ja, ich war mir sicher, du würdest staunen. Ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid.“
Imani kam mit einem Tablett Gin Tonics.
„Wollen wir uns raussetzen? Ich hätte Lust, eine zu rauchen“, sagte Erik, der zwei Gläser herunternahm und sie Ines und mir reichte.
„Geht ihr beide mal raus“, sagte Imani zu Erik und mir, „ich gebe Ines schon mal ein paar Tipps für die kommenden Tage.“
Ines stimmte freudig zu. Erik und ich nahmen an einem Tisch auf der Veranda Platz, er bot mir eine Zigarette an. Ich rauchte sonst eigentlich nie, aber ich fand, es gehörte sich, sie anzunehmen. Ich glaubte, es wäre gewissermaßen die offizielle Versöhnungszigarette nach all den Jahren, in denen wir nur ganz selten Kontakt zueinander gehabt hatten, und das eigentlich auch nur, um uns zu vergewissern, dass wir geschiedene Leute waren. Ich dachte, es wäre an der Zeit, seine Mutter zu erwähnen.
„Hörst du regelmäßig von Carla?“
„Natürlich. Ich bin auf dem Laufenden. Wir telefonieren jede Woche miteinander.“
„Dann weißt du auch, wie alles gelaufen ist, mit der Scheidung und so weiter.“
„Ja, ihr habt euch geeinigt, hat sie gesagt. Überraschend. Du hättest plötzlich nachgegeben und ihr das Haus überlassen.“
„Ja, ich sah keinen Sinn mehr, dafür zu kämpfen. Es war eine spontane Entscheidung.“
„Was hat dich dazu veranlasst?“
Ich war mir nicht sicher, ob ich ihm tatsächlich den wahren Grund nennen sollte. Ich entschied mich für eine Andeutung.
„Ich hatte einen Anruf bekommen, der mir klarmachte, dass alles seine Zeit hat.“
„Du meinst den Anruf, dass staatsanwaltliche Ermittlungen gegen dich laufen.“
Er war bestens informiert. Carla hatte ich beim Gerichtstermin davon erzählt, und selbstverständlich war mir währenddessen schon klar, dass das ein Fehler war. Aber manchmal will man einfach reden, egal, ob es ein Fehler ist oder nicht.
„Das weißt du also. Von Carla, nehme ich an.“
„Ja. Sie sagte aber, ihrer Meinung nach sei an der Sache nichts dran. Ein paar Leute machen sich wichtig, und am Ende wird das alles eingestellt.“
Die großmütige Einschätzung meiner Exfrau rührte mich ein wenig. Ich hoffte, sie würde recht behalten.
„Stimmt es, was sie mir noch erzählt hat?“
„Was hat sie dir noch erzählt?“
„Dass du die Anteile an der Kanzlei an deine Partner verkauft hast. Verkaufen musstest.“
„Ja, auch das stimmt.“
„Dann hast du ja jetzt einiges auf der hohen Kante, nicht wahr?“
Ines und Imani kamen aus dem Wohnzimmer zu uns auf die Veranda. Ich war froh um ihren Besuch.
„Wäre so ein Haus nicht auch was für dich?“, fragte mich Ines. Sie erschien mir etwas angetrunken. Ich hatte keine Lust, die Frage zu beantworten.
„Ich glaube, wir würden uns gerne ein bisschen ausruhen und frisch machen. Könntest du uns bitte unser Zimmer zeigen?“, fragte ich Erik.
„Oh, ich fürchte, da muss ich etwas erklären. Ich hatte gestern nicht damit gerechnet, dass so viele Leute eintrudeln würden, und dann kam mir die Sache mit Imani dazwischen. Wir sind erst seit gestern zusammen. Ich hätte ein paar Dinge besser im Auge behalten sollen. Aber wahrscheinlich ist es euch sowieso lieber, nicht in diesem Taubenschlag zu wohnen. Ich habe im Palace Hotel ein Zimmer für euch reserviert. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, oder?“
Das war es. Wir tranken unsere Gin Tonics aus, und Erik brachte uns dorthin. Es war ein sehr schönes Gebäude, nicht sehr groß, nur drei Stockwerke hoch, etwa zwanzig Zimmer, alles sehr luftig, sehr offen, mit Blick auf den Hafen. Erik sprach, für meine Ohren wiederum ungewohnt scharf, mit einem jungen Schwarzen an der Rezeption, der unsere Koffer hinaufbrachte. Wir verabredeten uns für sechs Uhr in der Lobby. Es sei, sagte Erik, ein kleiner Empfang für uns vorbereitet. Das war in etwa zwei Stunden. Genug Zeit, um sich ein wenig zu erholen.
„Georg M. Oswald spielt geschickt mit Spannung, unerwarteten Wendungen, den Hoffnungen des Lesers und dem Reiz, seinen Protagonisten in ein immer grösser werdendes Desaster fallen zu lassen, ohne je die Bodenhaftung zur Realität zu verlieren. Spannungsliteratur mit Niveau!“
„Diese schwierige Annäherung [zwischen Vater und Sohn] schildert Georg M. Oswald in einer souveränen, effektiven Erzählweise. Er beschränkt sich aufs Wesentliche und treibt die Handlung voran, ohne zu hetzen.“
„…ein furioser Familienroman aus der Arschlochperspektive…“
„Fast sachlich, aber dennoch mitreißend beschreibt Oswald wie der einstige Anwalt dramatisch aus dem Leben fällt – um jenseits aller Normen vielleicht sogar eine größere, zumindest genügsame, Zufriedenheit zu finden als zuvor.“
„›Väter und Söhne‹, das Thema ist nun wirklich nichts neues, aber Georg M. Oswald schafft es, diesem Gassenhauer der Literaturgeschichte eine neue Kulisse und einen ganz eigenen Ton zu verpassen.“
„›Alle, die du liebst‹, ist kein klassischer Thriller, eher ein Roman, dessen Spannung darin besteht, wie leicht wir uns in unserer Weltwahrnehmung erschüttern lassen. (…) eine Ordnung nach der nächsten wird als künstlich, als anmaßend, als brüchig entlarvt. Georg M. Oswald erzählt sehr gerade, sehr schnörkellos, sehr spannend – und auch sehr verunsichernd. Aber das ist, was gute Literatur auch leisten muss: sie muss unsere Selbstsicherheit erschüttern.“
„Mit Mitteln der Spannung, teilweise thrillerartigen Elementen, entwirft Oswald das Psychogramm eines Kotzbrockens, der genau das nicht sein will und trotzdem alle verletzt, die ihm doch so viel bedeuten… ein Kontrollfreak, dem die Kontrolle übers eigene Leben und Lieben entgleitet.“
„Die Grundidee, wie ein Mann, der vieles erreicht hat, an einen Punkt kommt, da er alles verlieren kann, bildet ein solides Gerüst für das Buch. Oswald, selbst nicht nur Schriftsteller, sondern auch Anwalt, kann sich gut in Menschen hineindenken.“
„Oswald [hat] einen rasanten Roman gebaut, angereichert mit einer Menge zwielichtiger Figuren.“
„Georg M. Oswald nähert sich einem schweren Stoff auf leichtem Fuß. Es gibt keine Sicherheit: im großen Ganzen nicht und nicht in der Familie. Und schon gar nicht auf der Flucht davor.“
„Trocken und eindringlich geschriebener Roman.“
„Mit einem nüchternen Erzählstil, aber mit Finessen des Spannungsromans operierend, lotet Georg M. Oswald vorzüglich die Psyche seiner Hauptfigur Hartmut Wilke aus. Ein geistreicher und nachhallender Roman.“
„Das Porträt eines Mannes an einem Wendepunkt und eine rasante Familiengeschichte – inklusive Geiselnahme und Exotik-Flair.“
„Dem Schriftsteller ist mit ›Alle, die du liebst‹ ein raffinierter, spannender, hintergründiger und deswegen äußerst lesenswerter Roman gelungen.“
„So kann man diesen stimmig erzählten Roman auch als Konfrontation mit dem Anderen lesen, dem Fremden, das auf einen selbst zurückwirkt – in der Liebe, im Verhältnis zur anderen Generation, zu anderen Kulturen, oder als Plädoyer dafür, das eigene Weltbild infrage zu stellen, bevor es zu spät ist und andere einem die eigenen Irrtümer auf schmerzhafte Weise vor Augen führen.“




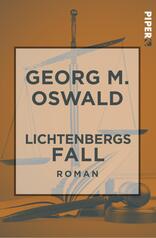










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.