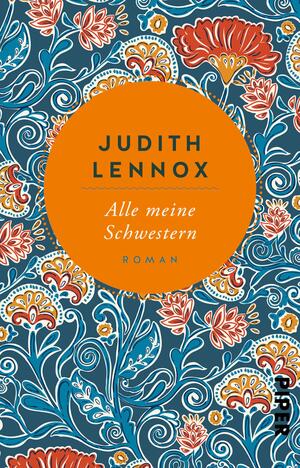

Alle meine Schwestern (Gudrun Sjöden) Alle meine Schwestern (Gudrun Sjöden) - eBook-Ausgabe
Roman
Alle meine Schwestern (Gudrun Sjöden) — Inhalt
Sheffield, am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die vier Maclise-Töchter könnten nicht unterschiedlicher sein – und doch verbindet sie ihr Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben: Marianne sehnt sich nach der großen Liebe und einem Kind; dafür wandert sie sogar nach Ceylon aus. Die bildschöne Iris gibt sämtlichen Verehrern den Laufpass, um Krankenschwester zu werden; Eva, rebellisch und abenteuerlustig, engagiert sich im schillernden London der Vorkriegszeit als Künstlerin und Frauenrechtlerin; und Clemency, das Nesthäkchen, erkennt, dass man nicht immer von zu Hause fortgehen muss, um Frieden zu finden.
Leseprobe zu „Alle meine Schwestern (Gudrun Sjöden)“
Prolog
Wenn sie nachts nicht schlafen konnte, machte sie Listen, Listen der Grafschaften Großbritanniens, seiner Industriestädte, der wichtigsten Exportartikel des Empire, Listen der Könige und Königinnen Englands und der Werke William Shakespeares. Ab und zu wurde eine Erinnerung geweckt. „Ein Wintermärchen, Cymbeline, Der Sturm“, murmelte sie in der Hitze einer kurzen Januarnacht vor sich hin und mußte plötzlich an einen Abend im Theater denken. Arthur, der neben ihr saß, streichelte in der Dunkelheit ihre Hand. Sie erinnerte sich seiner zart [...]
Prolog
Wenn sie nachts nicht schlafen konnte, machte sie Listen, Listen der Grafschaften Großbritanniens, seiner Industriestädte, der wichtigsten Exportartikel des Empire, Listen der Könige und Königinnen Englands und der Werke William Shakespeares. Ab und zu wurde eine Erinnerung geweckt. „Ein Wintermärchen, Cymbeline, Der Sturm“, murmelte sie in der Hitze einer kurzen Januarnacht vor sich hin und mußte plötzlich an einen Abend im Theater denken. Arthur, der neben ihr saß, streichelte in der Dunkelheit ihre Hand. Sie erinnerte sich seiner zart drängenden Berührung und des Verlangens, das in ihr erwachte, während sie den Stimmen auf der Bühne lauschte. Was vergänglich und gemein, ward gewandelt durch das Meer… Doch er war von ihr gegangen. Lücken taten sich auf, Teile fehlten. Sie hatte ganze Tage – ja, Wochen – vergessen, mit allem, was geschehen war. Mit leichtem Erschrecken wurde sie sich bewußt, daß ihr vom Ablauf gewöhnlicher Tage ohne bemerkenswerte Ereignisse nichts im Gedächtnis geblieben war. Daß sie den genauen Farbton seiner Augen, die genauen Konturen seines Gesichts vergessen hatte. Ihre Listen wurden zu einem Bemühen, die Vergangenheit festzuhalten und einzufrieren. Sie erinnerte sich an Picknicks in den Hügeln, an Urlaube am Meer. Hier, an diesem verlassenen Ort, erinnerte sie sich an salzige Seeluft und glitschigen braunen Tang. Sie hörte das Quietschen und Scheppern des Badekarrens, wenn er den Strand herunterkam, und hielt unwillkürlich wieder den Atem an wie damals in der dämmrigen, muffigen Umkleidehütte, im Vorgefühl des Schocks bei der Begegnung mit dem eiskalten Wasser der Nordsee. Sie und ihre Schwestern hatten Schwimmkostüme aus Schwarzem Serge angehabt. Der dicke Stoff kratzte auf der Haut, wenn er naß war. An einem anderen Teil des Strands badeten Frauen aus einfacheren Kreisen in ihren Sommerkleidern. Ihre hellen Röcke blähten sich auf dem Wasser, so daß sie aussahen wie seltsame durchscheinende Meeresgeschöpfe. Wie Quallen, Marianne! hatte Eva gerufen und mit einer Hand die zusammengekniffenen Augen beschattet. Wie große dicke Quallen! War es Filey oder Scarborough gewesen, wo sie diese Frauen beobachtet hatten, die sich mit verzückten Gesichtern in ih- ren Kleidern von der Brandung schaukeln ließen? Es machte ihr zu schaffen, daß sie es nicht mit Sicherheit sagen konnte. Wenn sie in den frühen Morgenstunden erwachte, den Kopf voller Alpträume, hatte sie Angst vor der Zukunft und wurde von der Vergangenheit verfolgt. In den schlimmsten Nächten pflegte sie eine Stimme zu hören: Vier Uhr morgens. Teufelsstunde. Wieder Erinnerungen, um die Finsternis zu vertreiben. Sie erinnerte sich an Sheffield, die Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen war. Sie erinnerte sich an die großen Kaufhäuser und Hotels im Zentrum und an den grauen Rauchschleier, der wie ein Leichentuch über dem Industriegebiet hing. Sie erinnerte sich an das Prasseln der Hochöfen, das unaufhörliche Donnern und Dröhnen von Hämmern und Maschinen. An das Menschengewühl, den Geruch von Rauch und Regen. In einer stickigen schlaflosen Nacht dachte sie an den Salon in Summerleigh mit den vier niedrigen rostbraunen Samtsesseln und Großtante Hannahs Lehnstuhl am Feuer. Auf dem Klavier standen gerahmte Fotografien von Mutter und Vater im Hochzeitsstaat sowie ein Bild von Großmutter Maclise mit hochgestecktem Haarknoten, hängenden Wangen und stählernem Blick, so monumental wie Königin Victoria. Ein Schnappschuß von den drei Jungen – James trug einen Blazer und einen flachen Strohhut, Aidan und Philip steckten in Matrosenanzügen. Außerdem eine Fotografie der vier Maclise-Töchter. Sie und ihre Schwestern hatten weiße Musselinkleider an. Auf dem Foto hatten die Seidenschärpen um ihre Taillen bräunliche Töne angenommen, aber in Mariannes Erinnerung waren sie farbig. Die von Iris war so leuchtend blau wie Iris’ Augen, Evas war apfelgrün, Clemencys butterblumengelb. Ihre eigene war blaßrosa wie Albertine-Rosen. Iris – goldblond, mit einer Haut wie Milch und Blut – stand an einen Baum gelehnt, das lachende Gesicht der Kamera zugewandt. Eva, klein und zierlich, blickte furchtlos voraus. Clemency wirkte linkisch, als fühlte sie sich in Musselin und Seide nicht wohl. Marianne wußte noch, daß sie selbst weggeschaut hatte. Der Fotograf hatte geglaubt, sie sei kamerascheu. Er hatte sich getäuscht. Das Hinschauen machte ihr nichts aus; das Angeschautwerden irritierte sie. Sie haßte es, einen Raum voller Menschen zu betreten, zelebrierte niemals wie Iris einen großen Auftritt, um die Blicke der Männer auf sich zu ziehen, brachte niemals diesen raffinierten kleinen Fußschlenker zustande, der ausreichte, um ein verführerisches Stück rüschenbesetzten Unterrocks sehen zu lassen. Sie wollte nicht flirten und konnte es auch nicht. Die Liebe, hatte sie damals geglaubt, müsse völlige Übereinstimmung im Denken und Fühlen zweier Menschen sein, mit einem Blick besiegelt und fähig, Abwesenheit, Veränderung und Tod zu überstehen. Marianne war überzeugt, daß man der Liebe nur einmal im Leben begegnete. In der Ferne pfiff eine Lokomotive. Mit weit geöffneten Augen fuhr sie im Dunkeln in die Höhe. Ihre erschütterte Konzentration barst und schoß in Splittern all die düsteren Gassen hinunter, die ihr so vertraut waren. Was hatte sie alles gesehen! Was hatte sie alles getan! Dinge, deren sie sich selbst damals nicht für fähig gehalten hatte. War überhaupt etwas übrig von dem Mädchen, das sie einmal gewesen war, diesem Mädchen, das vor dem Objektiv eines Fotoapparats zurückgescheut und vor dem Blick eines Mannes geflohen war? War es möglich, sich in einen völlig anderen Menschen zu verwandeln? Erzählen Sie mir von Ihrer Familie, hatte Arthur gesagt, als sie sich das erste Mal begegnet waren. Von Ihren drei Brüdern und Ihren drei Schwestern. Was würde sie sagen, wenn er jetzt um das gleiche bäte? Daß sie die Menschen, die sie einmal am meisten auf der Welt geliebt hatte, nicht mehr kannte? Daß sie einander wohl nicht wiedererkennen würden, wenn die anderen sich so sehr verändert hatten wie sie selbst? Oder daß ihre Sehnsucht nach ihnen so groß war, daß sie manchmal das Gefühl hatte, der Schmerz träte ihr mit dem Schweiß aus allen Poren? Die Sehnsucht nach ihren Schwestern, die sie nie wiedersehen durfte.
1
Dicht an die Wand gedrückt, zog Marianne ihre einsame Bahn rund um den Ballsaal, als sie zufällig die Bemerkung einer der Anstandsdamen Mrs. Catherwood gegenüber hörte, die ihre eigene Tochter Charlotte und die Maclise-Mädchen hierher mitgenommen hatte. Die Anstandsdamen saßen alle in einem Raum neben dem Ballsaal, bei offener Tür, damit sie ihre Schützlinge im Auge behalten konnten. Die tricoteuses nannte Iris sie auf ihre freundlich sarkastische Art. Mrs. Pal- mer sagte: „Die zweite Maclise ist eine schreckliche Bohnenstange“, worauf die liebenswürdige Mrs. Catherwood entgegnete: »Marianne wird sich in spätestens ein, zwei Jahren zu einer bezaubernden jungen Frau mausern.« Marianne jedoch blieb nur der erste Satz im Kopf, als sie sich in den Schat- ten einer schweren dunkelroten Samtportiere zurückzog. Eine schreckliche Bohnenstange… eine schreckliche Bohnenstange… Die alten Zweifel überfielen sie. Es war schwer, nicht mit gekrümmten Schultern herumzulaufen, wie manche hochgewachsene Frauen das taten, um kleiner zu wirken. Es war schwer, das Bändchen ihrer Tanzkarte nicht um das leere Blatt zu wickeln. Sie wünschte, sie wäre daheim bei Eva und Clemency. Was für ein Glück die beiden hatten, daß sie diesem fürchterlichen Ball fernbleiben durften, die eine erkältet, die andere noch nicht in die Gesellschaft eingeführt. Wie herrlich wäre es, jetzt gemütlich auf der Fensterbank in dem Zimmer zu sitzen, das sie sich mit Iris teilte, und zu lesen, Three Weeks von Elinor Glyn, das sie in ihrer Kommode unter den Strümpfen versteckt hatte. Wie im Fieber pflegte sie beim Lesen die Seiten umzuschlagen. Manchmal war Paul Verdayne, der seine geheimnisvolle Schöne in ein Schweizer Hotel verfolgte, realer und lebendiger als ihr Zuhause und ihre Familie. Sie wünschte sich Geheimnis und Romantik, neue Anblicke und neue Gesichter, irgend etwas – irgend jemanden –, bei dem ihr Herz schneller schlagen würde. Aber was, dachte sie, während sie den Blick geringschätzig durch den Saal schweifen ließ, gab es in Sheffield schon Geheimnisvolles? Da tanzte Ellen Hutchinson in einem absolut häßlichen rosaroten Satinkleid mit James. Erbärmliche Aussichten, wenn der eigene Bruder der bestaussehende Mann im Saal war. Und dort wur- de Iris reichlich tolpatschig von Ronnie Catherwood herumgeschwenkt. Marianne seufzte. Sie kannte jedes Gesicht. Nie im Leben könnte sie einen dieser pickeligen Jungen mit den flaumigen Schnurrbärtchen heiraten, die ihr seit ihrer Kindheit vertraut waren. Sie wirkten irgendwie unfertig, irgendwie ein bißchen lächerlich. Die Vorstellung, ihre Familie zu verlassen, um den Rest ihres Lebens mit einem dieser täppischen, durchschnittlichen jungen Männer zu verbringen, stieß sie ab. Doch heiraten mußte sie. Wenn nicht, was dann? Ihr Leben würde wahrscheinlich weitergehen wie bisher. Da ihre Mutter es anscheinend nicht fertigbrachte, ein Hausmädchen länger als ein Jahr zu halten, klappte die Hausarbeit nicht so reibungslos, wie sie sollte. Und da ihre Mutter eine zarte Gesundheit hatte und Iris ein Talent dafür, sich vor allem Unangeneh- men zu drücken, blieb die Verantwortung für den Haushalt größtenteils an Marianne hängen. Vielleicht würde sie einmal enden wie Großtante Hannah – als alte Jungfer. Sie würde ein unförmiges Korsett tragen und vielleicht eine Perücke. Bei der Vorstellung von sich selbst in schwarzem Bombassin mit Barthaaren am Kinn mußte sie lachen. Und merkte plötzlich, daß jemand sie beobachtete. Sie konnte später nicht sagen, woher sie es wußte. Man konnte doch nicht spüren, aus welcher Richtung ein Blick kam? Er stand auf der anderen Seite des Saals. Als ihre Blicke sich trafen, lächelte er und neigte leicht den Kopf. Es war wie ein Wiedererkennen. Sie mußte ihm schon einmal begegnet sein, wahrscheinlich auf irgendeinem öden Empfang oder bei einem langweiligen Konzert. Aber wenn das stimmte, dann würde sie sich doch an ihn erinnern! Sein Blick war so intensiv, daß sie den plötzlichen Wunsch zu fliehen verspürte. Zwischen stattlichen Frauen mit Straußenfedern im Haar und älteren Herren mit Schnurrbärten und lüsternen Blicken hindurch lief sie aus dem Saal bis in einen schlechtbeleuchteten Korridor mit Türen zu beiden Seiten. Sie hörte das Klappern und Zischen aus den Küchenräu- men. Dienstmädchen mit Tabletts voller Gläser eilten geschäftig durch den Gang; weiter hinten steckte sich ein Diener in Schürze und Hemdsärmeln eine Zigarette an. Wahllos öffnete sie eine Tür. In dem kleinen Raum dahinter standen zwei durchgesessene Sessel mit abgewetzten Bezügen, ein Notenständer und ein recht zerschrammtes Klavier. Marianne knöpfte ihre Handschuhe auf und strich mit den Fingern über die Tasten. Dann sah sie die Noten durch. Schließlich setzte sie sich und begann zu spielen, leise zuerst, um nicht entdeckt zu werden. Dann aber ergriff die Musik von ihr Besitz, und sie gab sich ihr ganz hin. Die Tür ging auf, sie erkannte den Mann aus dem Saal. Sie hob die Hände vom Instrument. Zitternd hingen sie über den Tasten. „Verzeihen Sie“, sagte er. „Ich wollte Sie nicht erschrecken.“ Schnell klappte sie die Noten zu. »Ich sollte wieder hinübergehen.« „Warum sind Sie weggelaufen? Macht Ihnen Klavierspielen mehr Spaß als Tanzen?“ „Aber ich habe ja nicht getanzt.“ „Hätten Sie denn gern getanzt?“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich wäre am liebsten zu Hause bei meinen Schwestern.“ Sein volles hellbraunes Haar war leicht gewellt und kurz, das Blau seiner Augen einige Nuancen heller als das ihrer eigenen. Die ebenmäßig geschnittenen Züge und das kräftig ausgebildete Kinn vermittelten einen Eindruck von Zuverlässigkeit und Stärke. Er war wahrscheinlich einige Jahre älter als sie, und er war größer. Neben ihm würde sie nicht die Schultern krümmen oder den Kopf einziehen müssen. „Wie viele Schwestern haben Sie?“ fragte er. „Drei.“ „Brüder auch?“ „Drei.“ „Sie sind sieben Geschwister! Ich bin allein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, in einer so großen Familie aufzuwachsen.“ „Einzelkinder sind da anscheinend oft neidisch.“ „Ja? Also, ich war immer ganz froh, der einzige zu sein. Bei so vielen muß man doch ständig Angst haben, übersehen zu werden!“ Er sah sie offen an. „Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß man Sie übersieht.“ „Ich hätte überhaupt nichts dagegen, übersehen zu werden. Ich kann es nicht ertragen, wenn die Leute mich anstarren – mich bewerten.“ Sie brach ab, erschrocken über ihre Freimütigkeit. „Vielleicht bewerten sie Sie gar nicht. Vielleicht bewundern sie Sie.“ Die zweite Maclise ist eine schreckliche Bohnenstange. Marianne stand vom Klavierschemel auf. „Ich muß wieder in den Saal.“ „Warum? Sie tanzen doch nicht. Sie finden die Leute langweilig. Warum wollen Sie zurück? Oder finden Sie mich vielleicht noch langweiliger?“ Sie mußte zurück, weil seine Nähe hier, in diesem kleinen Raum, sie um ihre Ruhe brachte. Aber das konnte sie ihm natürlich nicht sagen, und so setzte sie sich nur wortlos wieder hin. „Das ist doch wunderbar, Miss –?“ „Maclise“, murmelte sie. „Marianne Maclise.“ „Arthur Leighton.“ Er gab ihr die Hand. „Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Von Ihren drei Brüdern und Ihren drei Schwestern. Wo stehen Sie in der Reihe?“ „James ist der älteste. Dann kommt Iris. Sie ist heute abend auch hier. Sie haben sie sicher gesehen. Sie hat blonde Haare, goldblond, blaue Augen und ist sehr schön.“ „Trägt sie ein weißes Kleid? Diamanten in den Ohren und eine weiße Gardenie im Haar?“ „Aha, sie ist Ihnen also aufgefallen.“ Sie spürte Neid. Immer war Iris die Bewunderte. Aber er sagte: „Ich beobachte gern. Es ist oft interessanter, die Leute zu beobachten, als mit ihnen zu sprechen.“ „Oh, finden Sie das auch? Gespräche sind oft so – gezwungen. So verlogen“, rief sie, beglückt über die Übereinstimmung. „Aber nicht immer“, widersprach er freundlich. »Unser Gespräch hat doch nichts Verlogenes, oder?« Er kam auf das ursprüngliche Thema zurück. „Also, James und Iris sind die beiden ältesten. Und dann?“ „Dann komme ich und nach mir Eva. Sie ist dunkel wie ich. Aber sonst ist sie ganz anders. Sie ist längst nicht so groß, und sie ist – sicherer, entschiedener.“ Mariane strich über ihren seidenen Rock. »Ich sehe irgendwie immer alles von zwei Seiten.« „So mancher würde sagen, das ist gut – ein Zeichen von Reife.“ „Aber es macht die Entscheidung so schwer. Woher weiß man, welche die richtige ist?“ „Manchmal muß man eben etwas riskieren. Die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht.“ „Die Entscheidungen, die Sie treffen müssen, sind vermutlich etwas schwerwiegender als meine“, sagte sie bitter. „Bei mir geht es eigentlich immer nur darum, ob ich lieber das rosa Kleid oder das weiße anziehen oder ob ich bei der Köchin lieber Pudding oder Biskuitrolle mit Marmelade bestellen soll.“ „Oh, Biskuitrolle“, erwiderte er ernsthaft. „Viel leckerer als Pudding. Und Sie sollten lieber Weiß als Rosa tragen. Lassen Sie das Rosa den hübschen Blondinen wie Ihrer Schwester Iris. Aber kräftigere Farben ständen Ihnen sicher auch gut. Veilchenblau vielleicht, wie die Blumen, die Sie tragen – sie haben die gleiche Farbe wie Ihre Augen.“ Marianne war sprachlos. Kein Mann, weder ihr Vater noch ihre Brüder oder die Brüder ihrer Freundinnen, hatte sich je in dieser Art über ihr Aussehen und ihre Kleidung geäußert. Es kam ihr irgendwie ungehörig vor. „Und wer kommt dann?“ fuhr er fort. „Ein Bruder oder eine Schwester?“ „Clemency. Meine Schwester Clemency ist die nächste. Danach folgen Aidan und Philip. Aidan ist dreizehn, Phil ist gerade elf geworden. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich kenne. Es sind eben Jungs, die zwei jüngsten in der Familie, sie laufen so mit. Außer Clemency hat niemand viel Zeit für sie.“ „In Ihrer Familie ist sicher immer eine Menge los. Einsam sind Sie bestimmt nie.“ Sie sollte in den Saal zurückkehren. Ein junges Mädchen und ein Mann ganz allein, das schickte sich nicht. Aber sie blieb. Ihre verborgene rebellische Seite, der sie so selten eine Stimme erlaubte, drängte sie, auf Vorsicht und Konvention zu pfeifen. Gerade jetzt fühlte sie sich ungeheuer lebendig, spürte beinahe, wie das Blut durch ihre Adern pulste. Ausnahmsweise einmal hatte sie nicht den Wunsch, woanders oder bei jemand anderem zu sein. Sie schüttelte sich ein wenig, als müßte sie solche aufmüpfigen Ideen vertreiben, und sagte: „Jetzt müssen Sie mir aber auch etwas von Ihrer Familie erzählen, Mr. Leighton.“ „Mit Familie ist es bei mir leider nicht weit her. Meine Mutter ist bald nach meiner Geburt von uns gegangen, und ich war Mitte Zwanzig, als mein Vater starb. Ich habe einen Onkel und ein paar Cousins und Cousinen, das ist alles. Aber bedauern Sie mich jetzt nicht, ich habe einen großen Freundeskreis.“ „Hier, in Sheffield, haben Sie auch Freunde?“ „O ja, ich wohne seit einer Woche bei den Palmers. Mir gefällt die Stadt. Sie hat einige wirklich bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten.“ Er lächelte. Wäre sie Iris gewesen, so hätte sie jetzt mit kokettem Augenaufschlag eine Bemerkung gemacht, die wie eine Zurechtweisung geklungen hätte, in Wirklichkeit jedoch eine Aufforderung zu weiteren Komplimenten gewesen wäre. Zum erstenmal kam ihr der Gedanke, daß er ihr vielleicht nur schmeichelte, und sie war enttäuscht, tiefer enttäuscht, als sie nach so kurzer Bekanntschaft für möglich gehalten hätte. „Ich habe Sie vorhin im Saal lachen sehen“, sagte er unvermittelt. „Erst waren Sie so ernst, und dann haben Sie plötzlich gelacht. Ich hätte liebend gern gewußt, worüber.“ „Ach, ich habe mir vorgestellt, ich wäre eine dicke alte Jungfer.“ Seine Mundwinkel zuckten. „Ich glaube kaum, daß Ihnen so ein Schicksal blüht.“ „Wieso? Das kann leicht passieren.“ „Das glauben Sie doch nicht im Ernst!“ „Ich weiß, daß ich andere schockiere. Sie sagen natürlich nichts, aber ich merke es. Ich sage oft das Falsche.“ Sie schaute ihn an. „Unser ganzes Gespräch war falsch, Mr. Leighton. Wir haben über lauter Dinge geredet, über die man eigentlich nicht spricht.“ „Und worüber spricht man?“ „Na ja – über das Wetter zum Beispiel – oder über das Fest, wie gelungen es ist.“ „Aha.“ „Wie gut die Kapelle spielt.“ „Der Geiger war daneben. Darf ich das sagen?“ „Völlig daneben, ja.“ Sie lachte. „Es klang furchtbar.“ Nach einer Pause sagte er: „Darf ich dann vielleicht auch sagen, daß Sie sich vorhin geirrt haben?“ „Geirrt?“ „Als Sie sagten, Ihre Schwester Iris sei schön.“ „Aber alle finden Iris schön“, entgegnete sie verblüfft. „Iris ist sehr hübsch, ja. Aber sie ist nicht schön. Sie sind schön, Miss Maclise.“ Sie errötete nie, wenn sie verlegen war, sie wurde immer blaß. Auch jetzt verlor ihr Gesicht die Farbe, und sie spürte, wie ihre Haut kalt wurde. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und beobachtete sie. „Tja“ sagte er dann, „ich finde, Sie sollten die Wahrheit wissen.“ Zu Hause in ihrem Zimmer nahm Marianne das Veilchensträußchen ab, das sie an der Taille trug, und legte es behut- sam auf den Toilettentisch. Sie zog das Kleid aus, hängte es in den Schrank und stieg aus den üppigen Unterröcken, die knisternd zu einem Häufchen Seide auf dem Boden zusammenfielen. Dann schnürte sie das Korsett auf, streifte die seidenen Strümpfe ab, das Kamisol und den Schlüpfer. Schließlich hob sie die Arme und zog die Nadeln aus dem Haar, das schwer und dunkel ihren Rücken herabfiel. Nackt stellte sie sich vor den Spiegel und betrachtete sich. Er hatte gesagt, sie sei schön, und zum erstenmal in ihrem Leben teilte sie seinen Eindruck. Arthur Leighton hatte sie gebeten, für ihn zu spielen, und sie hatte ein Stück von Rameau gewählt. Während sie jetzt die Melodie vor sich hin summte, erinnerte sie sich, wie ihre Hände sich berührt hatten, als sie beide gleichzeitig zu den Noten griffen, um umzublättern. Bei dieser Berührung, in diesem einen flüchtigen Moment, hatte sie das Dickicht der Verstellungen durchdrungen, das Männer und Frauen um- gab, und alles, was sie immer verwirrt, was sie stets verachtet hatte – die Künstlichkeiten des Auftretens, die Falschheit des Flirts, die kalt berechnenden Überlegungen zu Vermögen und Klasse, wenn es um Heirat und Ehe ging –, das alles war bedeutungslos geworden. Sie hatte ihn begehrt und gewußt, daß auch er sie begehrte, selbst wenn er es nicht gesagt hatte. Sie schlüpfte in ihr Nachthemd, dann holte sie ihr Tagebuch heraus. 20. Mai 1909, schrieb sie. Ein verzauberter Abend. Heute hat mein Leben richtig angefangen. Am Ende der Speichertreppe angekommen, spähte Clemency in die Dunkelheit. „Philip?“ rief sie. „Philip? Bist du hier?“ Umrisse waberten im Licht der Petroleumlampe in ihrer Hand und entpuppten sich im nächsten Moment als dreibeiniger Stuhl oder als ein Stapel brüchiger alter Bücher. „Philip?“ rief sie noch einmal. Immer verkroch er sich an dem Tag, bevor er wieder ins Internat mußte, aber daß er sich den Speicher als Versteck ausgesucht haben könnte, war eher unwahrscheinlich, denn er fürchtete sich im Dunkeln. Als sie unten durch den Flur zurückging, bemerkte sie unter einem Bett eine Bewegung. Sie kniete davor nieder. „Philip?“ Keine Antwort. Aber sie hörte sein angestrengtes Atmen. „Philip?“ sagte sie noch einmal. „Jetzt komm doch raus! Es schimpft bestimmt keiner, ich verspreche es dir.“ Keuchend kroch er schließlich unter dem Bett hervor, Flusen in den Haaren, die Kleider voller Staub. Sie setzte sich aufs Bett und zog ihn auf den Schoß. „Ach, mein kleiner Philip“, sagte sie und drückte ihn an sich. „Bin ich froh, daß ich dich endlich gefunden habe. Ich suche dich schon seit dem Frühstück.“ Er pfiff ein wenig beim Atmen. „Der Staub ist schlecht für dich, das weißt du doch.“ Sie gingen nach unten. Die Ferien waren zu Ende. Philips Koffer lag offen in dem Zimmer, das er sich mit Aidan teilte. Sechs Wochen, dachte Clemency, sechs lange Wochen, bis ich ihn wiedersehe. Aber fang jetzt bloß nicht an zu heulen, ermahnte sie sich streng und sagte in betont munterem Ton: „Deine Malkreiden, Philip. Du hast deine Malkreiden nicht eingepackt.“ Er schaute sich um. Die Kreiden waren in einer alten Keksdose auf seiner Kommode. Sein verschwommener blauer Blick wanderte in die richtige Richtung, glitt über die Kreiden hinweg und streifte weiter. „Auf der Kommode“, sagte sie und sah, wie er blinzelte, um besser sehen zu können. Sie ging zu ihrer Mutter. Lilian Maclise saß an ihrem Toilettentisch. Obwohl es ein warmer Tag war, brannte ein Feuer im offenen Kamin, und die Vorhänge waren geschlossen. „Geht es dir besser, Mutter?“ „Ach nein, leider nicht, Clemency.“ Lilian lehnte sich in dem kleinen Sessel zurück und schloß die Augen. Das helle Haar umrahmte ein zartes Gesicht. Die Hände, die mit Döschen und Fläschchen auf dem Toilettentisch hantierten, waren schmal und blaß. Neben ihrer Mutter kam sich Clemency immer wie ein Trampel vor. „Ich mache mir Sorgen um Philip, Mutter“, sagte sie. „Ich glaube, er sieht schlecht.“ „Unsinn. Niemand in der Familie sieht schlecht.“ Clemency ließ nicht locker. „Er sieht trotzdem schlecht. Vielleicht braucht er eine Brille.“ „Eine Brille?“ Lilian riß die Augen auf und zog mit einem energischen Ruck an dem seidenen Tuch, das um ihre Schultern lag. „Was für eine Idee! Wenn Philip schwache Augen hätte – was ich bestreite –, wäre eine Brille genau das Verkehrte für ihn. Jeder weiß doch, daß das ständige Tragen einer Brille die Augen noch mehr schwächt.“ Clemency, der heiß geworden war, trat ein Stück vom Feuer weg. „Aber Mutter, er kann nicht richtig sehen –“ „Bitte sprich nicht so laut, Kind. Mein Kopf!“ Lilian schloß wieder die Augen. „Mutter?“ rief Clemency erschrocken. „Es tut mir wirklich leid, Schatz.“ Lilian drückte mit den Fingerspitzen gegen die Stirn. „Ich bin einfach erschöpft. Und die Schmerzen…“ Beklommen sah Clemency ihre Mutter an. Es war ihr in letzter Zeit so viel besser gegangen, daß sie zu den Mahlzeiten sogar nach unten gekommen war. Clemency hatte Hoffnung geschöpft. Vielleicht würde ihre Mutter endlich wieder ganz gesund werden, obwohl sie sich eigentlich gar nicht erinnern konnte, sie je gesund erlebt zu haben. Sie hatte kurz nach Philips Geburt, als Clemency knapp fünf Jahre alt gewesen war, zu kränkeln begonnen. Philip war jetzt elf, und die Stimmung im Haus Maclise war abhängig von Lilians Befinden. „Ach Gott“, hauchte Lilian. „Das ist alles so lästig. Ich kann mir gut vorstellen, daß du nachgerade genug hast von deiner hoffnungslosen alten Mutter, mein Schatz.“ „Aber nein! So was darfst du nicht glauben, Mutter. Ich möchte nur, daß es dir gutgeht. Das ist das einzige, was zählt.“ Lilian lächelte tapfer. „Würdest du Marianne bitten, mir ein Gläschen Portwein zu bringen? Und vielleicht kannst du dafür sorgen, daß meine Briefe zur Post kommen…“ Als Clemency mit den Briefen in der Hand aus dem Zim- mer ging, dachte sie innerlich jubelnd: Fünf Tage, nur noch fünf Tage, bis die Schule wieder anfängt. Im Gegensatz zu Philip ging sie leidenschaftlich gern zur Schule. Mit Riesensätzen und flatterndem Zopf sprang sie die Treppe hinunter. Unten fing Iris sie ab. „Wohin willst du?“ „Mutter will ein Glas Wein, und ich muß mit denen hier zur Post.“ Iris riß ihr die Briefe aus der Hand. „Ich mache das schon“, sagte sie, nahm ihre Kappe von der Garderobe und lief hinaus. Bei ihrem Fahrrad war der Reifen platt, darum nahm sie Clemencys. Einen Vorteil hatte die Abneigung ihrer Mutter gegen das Telefon, dachte sie, als sie die Auffahrt hinunterradelte, sie machte ausgedehnte Korrespondenz und damit viele Fahrten zur Post erforderlich. Manchmal sah sie sich, wenn sie auf ihrem Fahrrad dem Haus entronnen war, nur Schaufenster an oder andere Frauen, um sich zu neuen Hutgarnierungen inspirieren zu lassen. Hin und wieder traf sie sich gegen die gesellschaftliche Regel, die einem unverheirateten jungen Mädchen ohne Begleitung den Umgang mit jungen Männern verbot, mit den Catherwood-Brüdern im Park zu einem Spaziergang. In den vier Jahren seit Schulabgang hatte Iris mehr als ein Dutzend Heiratsanträge bekommen, doch sie hatte keinen davon angenommen. Es waren ein, zwei wirklich gute Partien darunter gewesen, die eigentlich genau ihre Erwartungen erfüllten, aber auch da hatte sie abgelehnt. Sie hatte sich kei- nen dieser Männer als Ehemann vorstellen können. Alle waren ganz nett, aber nichts zum Verlieben – jedenfalls nicht für sie. Seit einiger Zeit allerdings beunruhigte es sie zunehmend, daß sie immer noch ungebunden war. Mittlerweile war sie zweiundzwanzig, und die meisten Frauen ihres Alters waren verheiratet oder zumindest verlobt. Einige hatten sogar schon Kinder. Erste Zweifel quälten sie, ob sie überhaupt fähig war zu lieben. Die anderen Mädchen waren dauernd in irgend jemanden verliebt, bei ihr jedoch hatte sich dieses Gefühl bis heute nicht eingestellt. Manchmal, wenn sie abends vor dem Spiegel saß und ihr Haare bürstete, ertappte sie sich bei dem erschreckenden Gedanken, sie könnte ihre Anziehungskraft verloren haben, aber sie brauchte nur ihr Spiegelbild zu betrachten, nur ihre Locken zu sehen, die in goldblonden Kaskaden beinahe bis zu ihren Hüften herabfielen, um sich zu vergewissern, daß das nicht stimmte. Trotzdem blieb die unterschwellige Beunruhigung und flackerte manchmal mit beängstigender Heftigkeit auf. Das Fahrrad sauste den Hügel hinunter. Häuser und Bäume flogen vorbei. Iris’ Kappe drohte sich aus den Nadeln zu lösen, die sie hielten, ihre Röcke flatterten und zeigten ziemlich viel Bein. Plötzlich blockierte das Vorderrad, Iris stürzte Hals über Kopf über den Lenker und landete bäuchlings auf der Straße. Das Fahrrad lag über ihr und machte jede Bewegung unmöglich. „Mein Kleid“, jammerte sie. Jemand hob das Fahrrad hoch und fragte besorgt: „Ist Ihnen etwas passiert?“ Sie schaute hoch. Ihr Retter war ein sympathisch aussehender junger Mann. Er trug keinen Hut, sein helles, zerzaustes Haar, von der Sonne in Strähnen gebleicht, war leicht gelockt. Der Volant, den Iris sich erst am vergangenen Tag ans Kleid genäht hatte, war abgerissen und schlängelte sich quer über die Straße. „Mein Kleid!“ rief sie wieder, sehr aufgebracht diesmal. „Es ist ganz neu.“ Er bot ihr die Hand, um ihr aufzuhelfen. „Ich glaube, Ihr Kleid war schuld. Das da“ – er wies zu dem abgerissenen Volant – „hat sich in der Kette verfangen. Oh, Sie haben sich verletzt!“ Iris’ Handschuhe waren zerrissen und die Hände, mit denen sie sich abzustützen versucht hatte, blutig. „Ach, das ist nicht so schlimm.“ Er griff in seine Tasche und zog ein Taschentuch heraus. „Lassen Sie mich helfen.“ Sie setzte sich auf eine niedrige Mauer, und er streifte ihr die Handschuhe ab und entfernte behutsam die kleinen Steinchen aus den tiefen Schrammen in ihren Händen. Er war sehr vorsichtig, trotzdem mußte sie sich auf die Lippe beißen, um nicht aufzuschreien. Als er ihr schließlich um jede Hand ein Taschentuch wickelte, sagte sie höflich: „Das war sehr nett von Ihnen, Mr. –“ „Ash“, sagte er. „Einfach Ash.“ „Ash?“ „Ashleigh Aurelian Wentworth. Ein ziemlicher Brocken. Mir ist Ash lieber.“ Iris nannte ihm ihren Namen. „Ich wollte eigentlich für meine Mutter ein paar Briefe zur Post bringen“, erklärte sie und sah sich suchend um. Er fand sie im Rinnstein, zerknittert und voller Schmutzflecken. „Ist wahrscheinlich besser, Sie nehmen sie wieder mit nach Hause. Vielleicht möchte Ihre Mutter sie neu adressieren.“ „Ach, wie dumm.“ Iris seufzte. „Das wird was geben.“ »Es war doch ein Unfall. Das wird Ihre Mutter sicher verstehen.« „Aber Clemency nicht. Es ist ihr Rad.“ Ash hob das Fahrrad auf. Das Vorderrad war verbogen. „Wo wohnen Sie?“ Sie sagte es ihm. „Gut, dann schiebe ich es Ihnen nach Hause.“ „Ich möchte Ihnen keine Mühe machen. Sie haben bestimmt anderes zu tun.“ „Es ist keine Mühe. Und ich habe im Moment auch nichts anderes vor.“ „Überhaupt nichts? Aber Sie wollten doch gerade irgendwohin?“ „Nein, ich hatte kein Ziel.“ Er zupfte ein Fetzchen rosa Stoff aus der Fahrradkette. „Ich strolche gern herum. Sie nicht?“ Er sah sie lächelnd an. „Man weiß nie, wer einem unterwegs begegnet.“ Sie gingen den Hügel hinauf. „Ich auch“, bekannte sie. „Ich bin einfach durch die Gegend gefahren. Obwohl ich das natürlich nicht darf.“ „Aber wieso denn nicht?“ Er hatte warme hellbraune Augen – soviel ansprechender als die eisblauen Maclise-Augen, fand Iris. Aber er hatte nicht verstanden. Also erklärte sie es ihm. „Weil eine junge Dame nicht ohne Begleitung ausgeht oder ausfährt. Ich dürfte mich eigentlich nur zusammen mit mei- ner Mutter, meiner Tante, einer meiner Schwestern oder einem unserer Mädchen auf der Straße zeigen. Wahnsinnig lästig, sag ich Ihnen!“ Sie zuckte mit den Schultern. „Aber es macht mir Spaß, die Regeln zu brechen.“ Sie sah ihn an. „Haben Sie keine Schwestern?“ „Leider nicht.“ „Und verheiratet sind Sie auch nicht?“ Es war immer gut, so etwas gleich von vornherein zu klären. „Verheiratet? Nein!“ „Kommen Sie aus Sheffield?“ Er schüttelte den Kopf. „Cambridgeshire. Ich habe vor zwei Jahren mein Studium abgeschlossen.“ „Und seitdem?“ „Strolche ich herum. Und Sie, Miss Maclise? Was tun Sie?“ „Ach, das übliche“, sagte sie vage. »Tennis und Bridge, Tanzen…« Er schaute sie an, als erwartete er mehr. Sie überlegte krampfhaft, womit sonst noch sie ihren Tag füllte. „Und ich nähe“, fügte sie schwach hinzu. „Lesen Sie gern?“ »Ab und zu. Meine Schwester Marianne ist eine richtige Leseratte.« Nach einem kurzen Schweigen sagte er: „Tennis – Tanzen… Wird das auf die Dauer nicht ziemlich – ziemlich langweilig?“ „Gar nicht. Ich spiele unheimlich gern Tennis. Und ich tanze mit Leidenschaft.“ Sie war verwirrt. Einen Lebensstil verteidigen zu müssen, den sie nie in Frage gestellt hatte! „Und was tun Sie, Ash? Wenn Sie nicht herumstrolchen, meine ich.“ „Ach, dies und das. Nach dem Studium war ich eine Zeitlang in London.“ „London? Sie Glückspilz!“ »Ich habe bei einem Sozialprojekt der Universität mitgearbeitet, bei dem Studenten mit Leuten aus der Unterschicht zusammengeführt werden. Danach bin ich ungefähr sechs Monate auf dem Kontinent gereist. Und seitdem habe ich alles mögliche gemacht – ein bißchen Journalismus, ein bißchen Fotografie… und ich war beim Klettern im schottischen Hochland. Ach ja, und dann habe ich noch meinem Vormund bei seinem Buch geholfen.« „Ihr Vormund schreibt ein Buch? Was denn für eins? Einen Roman?“ Er schüttelte den Kopf. „Es handelt sich um eine Zusammenstellung des gesamten Weltwissens. Geschichte, Naturwissenschaften, Mythologie – einfach alles.“ „Du meine Güte!“ „Er wird natürlich nie damit fertig werden.“ Ash lachte. „Dauernd macht irgend jemand eine Entdeckung, und dann muß der arme alte Emlyn eine ganze Passage neu schreiben.“ „Ist das auf die Dauer nicht ziemlich entmutigend?“ „Ich glaube, so sieht Emlyn das nicht. Er sagt immer, auf den Weg kommt es an, nicht auf das Ziel.“ Er sah sie an. „Sie sind anderer Meinung?“ „Ich habe noch nie darüber nachgedacht.“ Sie dachte an ihre bislang fruchtlosen Bemühungen, einen Ehemann zu finden. Sie liebte das Tanzen, den Flirt, die heimlichen Küsse, aber wozu das alles, wenn sie am Ende – der Himmel möge es verhüten – doch unverheiratet bliebe? „Na ja“, sagte sie schließlich, „ein Weg muß aber doch irgendwann ein Ende haben. Am besten ein schönes!“ „Aber dann müßte man ja wieder ganz von vorn anfangen, wenn man das Ende erreicht hat!“ „Du lieber Gott, das klingt alles wahnsinnig anstrengend.“ Als sie ihn ansah, bemerkte sie den Übermut in seinem Blick und rief gekränkt: „Sie machen sich über mich lustig!“ „Nur ein ganz kleines bißchen. Wie geht es Ihren Händen?“ „Gut“, sagte sie. „Bestens.“ „Sie sind sehr tapfer, Miss Maclise.“ Noch nie hatte jemand sie tapfer genannt. Sie wußte nicht, ob sie es als Kompliment auffassen sollte. Sie bogen um die Ecke. „Hier wohne ich“, sagte sie. Ash schaute auf. Summerleigh stand in verschnörkelten schmiedeeisernen Lettern quer über dem Tor. Als sie die Auffahrt hinaufgingen, wurde die Haustür geöffnet, und Eva schaute heraus. „Iris!“ Sie sprang die Treppe hinunter. „Mutter sucht dich schon!“ Sie riß die Augen auf. „Dein Kleid! Und deine Hände!“ Iris wandte sich Ash zu. „Sie sollten jetzt lieber gehen. Es wird gleich einen kleinen Tanz geben. Aber Sie waren so nett, ich danke Ihnen. Versprechen Sie mir, uns zu besuchen, damit ich Sie meiner Familie vorstellen kann.“ Eva malte Großtante Hannah. Neben ihr hatte sie die Steingutvase mit den Pfauenfedern aufgestellt, und auf dem Teppich zu ihren Füßen lag Winnie, der Spaniel. Großtante Hannah trug ein Kleid aus glänzendem schwarzem Stoff. Über dem hohen steifen Kragen stauten sich die Falten ihres Halses, und das starre Fischbeinmieder umschloß ihren Oberkörper wie ein Panzer. Eva hatte sich schon oft gefragt, ob Großtante Hannah nur dieses eine glänzende schwarze Kleid besaß oder zwanzig gleiche. Die Großtante schien ihr von Geheimnissen umgeben zu sein: Wie alt war sie? Wie brachte sie die langen Stunden des Alleinseins in ihrem Zimmer zu? Warum roch sie immer nach Kampfer? Löste sie ihr Haar jemals aus dem strengen Nackenknoten – ließ es sich überhaupt noch lösen, oder war es, wie Eva argwöhnte, seit so vielen Jahren zusammengedreht, daß es längst zu einem festen Klumpen verfilzt war? Das Porträt war fast fertig. Eva setzte einen weißen Glanzpunkt auf die Steingutvase und kleinere weiße Tupfer in Hannahs Pupillen. Dann trat sie von der Staffelei zurück. So, dachte sie, kann ja sein, daß du hundert Jahre alt wirst, aber wenn du morgen stirbst, habe ich eine Erinnerung an dich. Seit ihrem Schulabschluß im vergangenen Sommer nahm sie Privatunterricht bei ihrer früheren Kunstlehrerin, Miss Garnett, die in der Plumpton Street über dem Laden eines Hefehändlers wohnte. Sie hatte die Mansardenzimmer wegen des Lichts gemietet, wie sie Eva erklärte. Vom Wohnzimmer aus sah man hinunter in den rußgeschwärzten Hinterhof eines Wagenmachers. Auf dem Fensterbrett fing eine Schale mit opalisierender Glasur das korallfarbene Licht der Spätnachmittagssonne ein. Die starken Ausdünstungen von Leinöl und Farbe mischten sich mit dem sauren Hefegeruch. Eva liebte Miss Garnetts Atelier. Eines Tages, nahm sie sich vor, würde sie auch ihre eigene Wohnung haben. Ende Mai nahm Miss Garnett Eva zu einer Versammlung der Frauenrechtlerinnen mit, die in einem Haus in Fulwood stattfand, in einem mit Möbeln vollgestopften, überheizten Salon. Die Gastgeberin, eine stattliche Matrone in stahlblauem Kretonne, musterte Eva durch ihr Lorgnon und sagte mit tragender Stimme: »Ein niedliches kleines Ding, aber sie hat etwas Eigensinniges. Sind Sie eigensinnig, Miss Maclise?« Miss Garnett rettete Eva und machte sie mit zwei jungen Frauen bekannt, von denen eine, Miss Jackson, das rot-grün-weiße Band von Mrs. Pankhursts Women’s Social and Political Union an ihrem losen blau-weiß karierten Baumwollhänger trug. Die andere Frau, Miss Bowen, hatte glänzendes schwarzes Haar, schulterlang und im Nacken zusammengebunden. Ihr Mund war ein blutroter Strich, und ihr viereckig ausgeschnittenes Kleid aus minzgrünem Leinen ließ die Fesseln unbedeckt. Eva beneidete Miss Garnett und ihre Freundinnen aus tiefstem Herzen. Sie selbst war, als sie es kürzlich gewagt hatte, so einfach gekleidet wie Miss Garnett beim Frühstück zu erscheinen, von ihrer Mutter mit dem Befehl auf ihr Zimmer geschickt worden, sich erst wieder blicken zu lassen, wenn sie anständig angezogen sei. Jetzt kam sie fast um vor Hitze in ihrem engsitzenden Kostüm über Bluse, Unterrock, Strümpfen, Hemd und Korsett, fest verschnürt wie ein Paket, so eng eingezwängt in mehrere Lagen Stoff, daß sie kaum Luft bekam. Miss Bowen betrachtete sie aufmerksam. „Ist sie begabt, Rowena?“ „Sehr.“ Miss Garnett lächelte Eva zu. „Das ist hohes Lob aus Rowenas Mund. Sie ist im allgemeinen nicht großzügig mit Komplimenten, Miss Maclise. Sie sind offenbar wirklich gut.“ Eine Glocke bimmelte zum Zeichen, daß der offizielle Teil der Versammlung begann. Eine grauhaarige Frau stand auf und verlas mit leiser, monotoner Stimme das Protokoll der letzten Versammlung. Miss Bowen gähnte und hielt Eva ihr Zigarettenetui hin. Miss Garnett flüsterte: „Lydia, ich habe Eva nicht mitgenommen, damit du ihr schlechte Angewohnheiten beibringst.“ Lydia schmollte. „Wozu dann? Um sie aufzurütteln? Um durch die Eloquenz unserer Ergüsse ihren revolutionären Eifer zu entfachen?“ Miss Jackson lachte leise. „Ich habe Eva mitgenommen, um sie zu informieren“, entgegnete Miss Garnett. „Sie soll sich selbst ihre Meinung bilden.“ „Hat sie denn an eurer Schule überhaupt nichts gelernt, Rowena?“ Miss Jackson nahm eine von Miss Bowens Zigaretten an. „Wie alt sind Sie, Miss Maclise? Achtzehn? Ich hätte eigentlich erwartet, daß Sie inzwischen eine Meinung zum Frauenstimmrecht haben. Etwas Wichtigeres gibt es doch kaum.“ „Jetzt hör aber auf, May.“ Miss Bowen schob eine Zigarette in eine elegante Onyxspitze. Ihre grünen Augen blitzten. „Es gibt tausend Dinge, die ebenso wichtig sind. Was man anziehen soll, zum Beispiel, wie man sich die Haare machen soll, ob man sich wirklich diese öde Abendgesellschaft antun soll, zu der man gerade eingeladen ist.“ Miss Jackson bekam einen roten Kopf. „Also wirklich, Lydia, wenn du das unbedingt ins Lächerliche ziehen willst –“ „Ärgere dich nicht, May“, sagte Miss Garnett tröstend. „Lydia will dich nur ein bißchen aufziehen.“ „Stimmt nicht“, widersprach Miss Bowen. „Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Mir jedenfalls fällt es oft genauso schwer, ein Kleid auszusuchen, wie durch den Hyde Park zu marschieren. Vielleicht sogar schwerer.“ Sie lächelte Eva zu. „Aber ich bin eben leider auch hoffnungslos faul.“ „Lydia, so ein Unsinn! Du arbeitest hart.“ Miss Garnett wandte sich erklärend an Eva. „Lydia betreibt in London eine Galerie.“ „Ja, in der Charlotte Street.“ Miss Jackson gestikulierte so heftig mit ihrer Zigarette, daß es Asche auf den Aubussonteppich regnete. »Wir sind selbständige, verantwortungsbewußte Frauen, die Beruf und Familie haben, aber wir dürfen weder bei der Wahl unserer Vertreter im Parlament mitreden noch bei der Abfassung von Gesetzen, die auch für uns gelten. Das ist doch wirklich unerhört!« „Eine absolute Frechheit ist das“, stimmte Miss Bowen zu. »Wenn ihr mich fragt, ist eine Änderung der Verhältnisse vorläufig nicht in Sicht. Seit mehr als vierzig Jahren kämpfen wir Frauen um das Wahlrecht. Wenn wir brav und gehorsam sind und unseren Abgeordneten höfliche Briefe schreiben, erklärt man uns, wir wären nicht engagiert genug, um das Wahlrecht zu verdienen. Also sind wir losmarschiert und haben den Hyde Park mit Frauen überschwemmt, die das Wahlrecht fordern, haben die Politiker mit Eiern beworfen und sind für unser Engagement ins Gefängnis gewandert. Und wie reagieren unsere Herren und Meister? Sie schütteln die Köpfe und sagen: Na bitte, das ist doch der Beweis dafür, daß wir recht haben, die Frauen sind viel zu närrisch und hysterisch, als daß man ihnen bei der Wahl eine Stimme geben dürfe.« Sie sah Eva an. »Haben Sie vor, auf die Kunstakademie zu gehen? Wenn Sie so begabt sind, wie Rowena sagt, sollten Sie Malerei studieren. Miss Maclise sollte auf die Kunstakademie gehen, was meinst du, Rowena?« „Hm“, machte Miss Garnett nachdenklich, „da wir gerade beim Thema sind…Ich wollte sowieso mit dir reden, Eva. Wenn du dich künstlerisch weiterentwickeln willst, mußt du heraus aus der Enge. Du könntest natürlich weiter in Sheffield studieren oder dich an einem College in Manchester bewer- ben, aber meiner Meinung nach solltest du die Slade-Akademie in London ins Auge fassen. Ich weiß, du würdest dort eine Menge lernen. An der Slade dürfen Frauen nach der Natur zeichnen. An manchen anderen Schulen ist man da viel altmodischer.“ „Die Kunstakademie…“ Eva war plötzlich aufgeregt. „Ja, warum nicht?“ Sie stellte sich vor, sie könnte dem täglichen Einerlei zu Hause entkommen, in dem sie sich, seit sie vor einem Jahr die Schule beendet hatte, gefangen fühlte wie unter einer erstik- kenden Decke. Sie stellte sich vor, sie wäre in London, umgeben von wagemutigen, modernen Freunden und Freundinnen. „Oder glaubst du, dein Vater hätte etwas dagegen?“ fragte Miss Garnett. Evas Traum platzte wie eine Seifenblase. Doch sie schob trotzig das Kinn vor. „Mein Vater wird bestimmt einsehen, daß ein Kunststudium das richtige für mich ist. Ich werde ihm das schon klarmachen.“ „Bravo, Miss Maclise“, rief Miss Bowen. „So ist’s richtig.“ Sie klatschte in die Hände. Ein paar Tage später ging Eva zu ihrem Vater. Er war in seinem Arbeitszimmer. Sein Schreibtisch war voller Papiere, aber er breitete die Arme aus, als sie kam. „Gib mir einen Kuß, Kätzchen.“ Er roch nach Tabak und Sandelholzseife, Düfte, die für Eva seit Kindertagen Geborgenheit und Wärme bedeuteten. „Wie geht es meiner Großen?“ „Gut.“ „Das ist schön“, sagte Joshua Maclise und griff zum Federhalter. Eva sagte schnell: „Welches war dein bestes Fach, Vater?“ Er überlegte. „Mathematik. In Mathematik war ich im- mer gut. Und ich verstehe natürlich etwas von Maschinenbau. Ich war übrigens auch immer derjenige, der als erster gesehen hat, wo wir investieren und wann es geraten war, einen Arti- kel einzustellen, weil er nicht ging. Hätte ich nicht diese besondere Begabung besessen, wäre die Firma wohl nicht gewachsen.“ „Und wenn dein Vater von dir verlangt hätte, daß du einen anderen Beruf ergreifst…?“ fragte Eva listig. »Wenn er verlangt hätte, daß du – na zum Beispiel Pfarrer wirst oder Lehrer…?« Joshua lachte. „Einen schönen Lehrer hätte ich abgegeben! Ich habe viel zuwenig Geduld.“ „Aber wenn er es verlangt hätte?“ beharrte sie. „Wärst du glücklich geworden? Was meinst du?“ Er sah sie scharf an. „Geht es hier vielleicht um deine Malerei? Das sind doch Flausen!“ Die Geringschätzigkeit, mit der er von dem sprach, was ihr das wichtigste war, ärgerte Eva. „Das sind keine Flausen!“ rief sie. „Na ja, das Malen ist ein netter Zeitvertreib für ein junges Mädchen.“ Er sah einen Stapel Briefe durch. Eva merkte, daß er nur halb bei der Sache war. „Es gibt nichts daran auszusetzen, wenn eine gebildete junge Dame ein hübsches Aquarell malt.“ Eva versuchte, sich zu sammeln, um ihre überzeugendsten Argumente ins Feld zu führen, all die Argumente, von denen sie bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch sicher gewesen war, daß sie ihren Vater umstimmen würden. „In der Bibel steht, wir sollen unsere Talente nicht vergeuden. Und du hast deine ja auch nicht verschwendet, nicht wahr, Vater?“ „Bei Mädchen ist das etwas ganz anderes“, entgegnete er. »Wenn du wüßtest, mit was für Leuten ich zum Teil zu tun hatte, Eva, was ich in der Firma jeden Tag an Dreck und Lärm aushalten muß! So etwas wünsche ich dir nicht. Meine Großmutter hat beinerne Messergriffe gefertigt. Sie hatte ein schweres Leben. Ich bin stolz darauf, daß keine meiner Töchter so leben muß. Alles, was ich getan habe, habe ich nur getan, um euch einen besseren Start zu ermöglichen.« „Du kannst doch Malen nicht mit der Arbeit in einer Werkzeugfabrik vergleichen! Da gibt es weder Krach noch Schmutz.“ Eva versteckte die Hände in den Rockfalten, damit ihr Vater die Kohle an ihren Fingern nicht sah. „Man kann ganz gemütlich in einem Atelier malen. Oder auf einer Wiese. Man kann überall malen.“ „Wenn man überall malen kann, warum mußt du dann nach London?“ Sie fühlte sich in die Enge getrieben und entgegnete verzweifelt: „Wie soll ich gut arbeiten, wenn ich nichts lerne?“ „Du brauchst nicht zu arbeiten, Eva. Du hast mich. Ich sorge dafür, daß du immer hübsche Kleider tragen wirst.“ „Kleider interessieren mich nicht.“ „Sie würden dich schnell genug interessieren, wenn du dir deinen Lebensunterhalt selbst verdienen müßtest“, versetzte er scharf. „Du würdest nicht so reden, wenn du gesehen hättest, was ich beinahe täglich sehe – junge Mädchen in dei- nem Alter, die in Lumpen gehen. Kleine Kinder, die mitten im Winter barfuß laufen müssen – in dieser Stadt! Du solltest dankbar sein für das, was du hast.“ Sie hätte am liebsten gesagt: Ich habe nicht gesehen, was du beinahe täglich siehst, weil du es mich nicht sehen läßt. Ich sehne mich danach, das Leben zu sehen, wie es wirklich ist. Doch statt dessen entgegnete sie: „Bitte glaub nicht, ich wäre nicht dankbar für alles, was du für mich getan hast, Vater.“ „Du bist noch sehr jung, Eva. Ein blutjunges Mädchen. Ich kann dich nicht allein nach London gehen lassen. Das wäre ja, als würde ich dich aussetzen. Es könnte dir weiß Gott was zustoßen.“ Eva hatte mit diesem Einwand gerechnet und sich gewappnet. „Miss Garnett hat gesagt, es gibt in London Pensionen für junge Frauen. Junge Damen aus guter Familie.“ Sie merkte, daß er nahe daran war, sich umstimmen zu lassen. Ihr Herz klopfte vor Aufregung. Aber dann sagte er bedächtig: „Es ist nur – ausgerechnet London! Ich kann diese Stadt nicht ausstehen.“ Sein Gesicht hellte sich auf. »Wir könnten doch einen Kompromiß schließen, Eva. Ich bezahle dir den Unterricht bei einem erstklassigen Lehrer, jemandem, der besser ist als Miss Garnett, und du nimmst die Stunden hier, in Sheffield – oder meinetwegen auch in Manchester.« „Aber ich muß nach London! Ich muß lernen, nach der Natur zu zeichnen.“ „Natur gibt’s in Sheffield genug.“ „Ich muß am menschlichen Körper lernen“, rief sie und hätte sich auf die Zunge beißen können. Sie sah das Befremden in seinem Blick. „Am menschlichen Körper?“ wiederholte er. „Heißt das wirklich das, was ich vermute, Eva?“ Sie geriet ins Stottern. „Es ist überhaupt nichts, es ist nichts Unanständiges daran – Maler haben immer schon den menschlichen Körper gemalt.“ „Das kann ja sein, aber meine Tochter wird das nicht tun.“ Joshua war ein Mensch, der zu abrupten Stimmungsumschwüngen neigte, und jetzt schlug Kompromißbereitschaft blitzschnell in zornige Empörung um. „Nicht unanständig! Wenn das nicht unanständig ist, was ist es deiner Meinung nach dann?“ „Aber ich muß an die Kunstakademie, Vater!“ rief sie. „Ich muß dahin. Andere Frauen studieren auch dort – anständige Frauen –“ „Nein, Eva“, sagte er scharf. „Schluß jetzt mit dem Theater. Ich will nichts mehr davon hören. Hinaus mit dir, ich habe Wichtigeres zu tun.“ „Aber mir ist das hier wichtig! Es ist für mich das allerwichtigste.“ „Gewiß“, sagte er. „Allzu wichtig vielleicht.“ Seine Augen, so tiefblau wie die ihren, zogen sich zusammen, als er sie musterte. „Was ist das?“ Er starrte das Band an, das sie sich ans Revers geheftet hatte. „Das sind die Farben der Frauenbewegung“, erklärte Eva stolz. „Eine Freundin von Miss Garnett, Miss Jackson –“ „Miss Garnett hier, Miss Garnett dort!“ rief Joshua gereizt. „Diese Frau setzt dir nichts als Flausen in den Kopf. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr sprechen und ihr klipp und klar sagen, daß du in Zukunft keine Stunden mehr nimmst.“ „Vater! Das darfst du nicht –“ „Ich darf nicht? Was bildest du dir ein? Du tust, was dir gesagt wird, mein Fräulein. Du schlägst dir diesen Unsinn aus dem Kopf, Eva, und tust zu Hause deine Pflicht.“ „Aber ich finde es scheußlich zu Hause!“ Sein Gesicht war hochrot geworden. „Wie kann man nur so halsstarrig sein! So, so – unweiblich!“ „Und wie kannst du so engstirnig sein?“ rief sie außer sich. „So altmodisch – so grausam –“ Joshua sprang auf und schlug wütend auf den Schreibtisch. Die Tasse klirrte auf der Untertasse, und Eva wich erschrocken einen Schritt zurück. Dann drehte sie sich um und lief aus dem Zimmer. Nach dem Streit mit ihrem Vater weinte sie lange. Danach war ihr flau und schwindlig. Sie ging zwar zu ihrer Malstunde, aber Miss Garnett, die ihre geröteten Augen und ihre zitternden Hände bemerkte, schickte sie früher nach Hause. Auf dem Rückweg nach Summerleigh schob sie ihr Fahrrad in einen kleinen Park. Am Himmel sammelten sich Wolken, die die Sonne verdunkelten und Schatten auf Rasenflächen und Kieswege warfen. Eva setzte sich auf eine Bank. Sie wußte, daß ihr Traum ausgeträumt war, noch ehe er richtig begonnen hatte. Ihr Vater würde sich nicht erweichen lassen. Wenn es überhaupt einen Weg gegeben hätte, seine Erlaubnis zu erwirken, so hatte sie ihn nicht gefunden. Sie hatte die Beherrschung verloren und ihn angeschrien wie ein Fischweib. Und wie hatte sie nur so dumm sein können, ihm zu sagen, daß sie lernen mußte, nach der Natur zu zeichnen? Das war weiß Gott das beste Mittel gewesen, um ihn gegen ihre Pläne aufzubringen. Nur ihr Vater konnte solche Ausbrüche von Tränen und Zorn bei ihr hervorrufen, dennoch waren ihre Gefühle für ihn ungetrübt. Mochte sie auch ihre Liebe zu ihm nie in Worte fassen, sie war immer da, ein goldener Faden, der sich durch ihr Leben zog. Sie bewunderte seine Tatkraft, sein Selbstvertrauen, seine Stärke. Im Innern wußte sie, daß sie stritten, weil sie einan- der in mancher Hinsicht sehr ähnlich waren. Beide waren sie eigensinnig, hatten die gleiche Art, an einem einmal gefaßten Entschluß hartnäckig festzuhalten. Sie ließen sich nicht treiben wie Marianne, noch steuerten sie wie Iris ihre Ziele auf Umwegen an. Sie waren direkt und undiplomatisch, manchmal sogar taktlos. Aber eine so heftige Auseinandersetzung hatte es zwischen ihnen noch nie gegeben. Noch nie war ihr Vater so böse auf sie gewesen. Bei der Erinnerung an ihre letzten Worte zu ihm wurde ihr heiß vor Scham. Wie kannst du so engstirnig sein, so altmodisch, so grausam. Sie hatte gesehen, wie schockiert ihr Vater gewesen war, schockiert und verletzt. Sie wußte, daß sie eine Grenze überschritten hatte, und wollte nichts lieber, als alles wieder in Ordnung zu bringen. Eine Kirchenglocke schlug. Eva hatte eine Idee. Sie würde zum Werk radeln und ihren Vater um Verzeihung bitten. Und so fuhr sie, anstatt den Weg nach Hause zu nehmen, zur Stadtmitte. Als sie die großen Hotels und Warenhäuser hinter sich gelassen hatte, erreichte sie das Industriegebiet. Flammen aus den Gießereischornsteinen loderten orange vor einem stürmischen Himmel. Sie hörte das Keuchen und Schnaufen der Dampfmaschinen, das Donnern und Krachen der Preßlufthämmer und schmeckte den Ruß in den Regentropfen. Die Lagerhäuser spiegelten sich im trübe verfärbten Wasser des Flusses; Schiffe brachten Kohle und verluden Stahlträger und Maschinenteile. Eva stellte sich die Frachter vor, wie sie auf hohe See hinausfuhren und Ozeane überquerten, um die Küsten ferner Kolonien zu erreichen. Von Lärm und Menschen umgeben, war ihr, als erwachte sie nach langem Schlaf endlich zum Leben, als pulsierte neue Energie in ihren Adern. Durch Ruß- und Dampfwolken konnte sie den Namen ihres Vaters ausmachen – J. Maclise –, der in riesigen weißen Let- tern auf dem geschwärzten Backstein eines Lagerhauses stand. Am Tor blieb sie stehen und schaute sich um. Die Gebäude – Lagerhaus, Gießerei, Werkstätten und Kontore – gruppierten sich im Karree um einen Innenhof, wo Kohle und gebrauchte Schmelztiegel aus den Öfen in Haufen auf dem Kopfsteinpflaster lagen. Arbeiter starrten Eva an, als sie durch das Tor trat, und ein Mädchen in einer braunen Papierschürze kicherte, bis ihre Nachbarin sie mit einem Rippenstoß zum Schweigen brachte. Mr. Foley sah auf, als Eva ins Kontor kam. Er war der Assistent ihres Vaters. Einmal im Jahr wurde er zu Weihnachten nach Summerleigh eingeladen. Iris machte sich mit Wonne über ihn lustig, indem sie seine ernsthafte Miene und seine kurzen, wohlbedachten Sätze nachahmte. So stumpfsinnig, pflegte sie zu sagen, so spießig. Und dabei ist er noch gar nicht alt! Aber Eva fand sein Gesicht mit den hervorspringenden Wangenknochen, dem kräftig ausgebildeten Kinn und den schwarzbraunen Augen unter dem gleichfarbenen Haar interessant, beinahe schön. Er sah sie erstaunt an. „Miss Eva“, sagte er und stand auf. „Suchen Sie Ihren Herrn Vater? Er ist leider nicht mehr hier. Er ist heute etwas früher gegangen, vor ungefähr zehn Minuten.“ Eva war enttäuscht. Die ganze freudige Erregung, die sie hierhergetragen hatte, verpuffte. „Kann ich vielleicht etwas für Sie tun?“ fragte Mr. Foley. Eva schüttelte den Kopf. „Nein, danke, Mr. Foley.“ Sie hatte mit diesem Ausflug alles nur schlimmer gemacht. Sie würde zu spät nach Hause kommen, und ihr Vater würde wieder böse werden. Als sie sich zum Gehen wandte, fragte Mr. Foley: „Sind Sie allein gekommen?“ Eva nickte. „Dann bringe ich Sie nach Hause.“ „Das ist nicht nötig. Ich bin mit dem Fahrrad hier.“ Sie lächelte ihn an. „Machen Sie sich keine Sorgen.“ Auf der Heimfahrt begann es zu regnen. Je weiter sie in die Vorstadt hineinkam, desto größer wurden die Villen und die sie umgebenden Gärten hinter den schmiedeeisernen Toren. Eva hatte das Gefühl, ihr zukünftiges Leben liege so eintönig und vorhersehbar vor ihr wie diese Straßen rundherum. Ihr Vater würde sie zwingen, den Unterricht bei Miss Garnett aufzugeben, und ohne künstlerische Anregung würde sie, der eigenen Grenzen gewahr, schließlich aufgeben und den erstbesten halbwegs annehmbaren Mann heiraten, der ihr einen Antrag machte, um dann in Sheffield zu verkümmern. Es donnerte, aus dem Regen wurde Hagel. Die weißen Körner sammelten sich in Massen in Rinnsteinen und Türnischen. Schulmädchen rannten kreischend durch das Gedränge auf den Straßen, Botenjungen fluchten und traten schneller in die Pedale ihrer Fahrräder. Die Eiskörner schlugen Eva ins Gesicht und trommelten auf ihre Hutkrempe. Mit zusammengekniffenen Augen schlängelte sie sich durch den Verkehr. Als sie die Ecclesall Road hinunterradelte, entdeckte sie in einem Meer schwarzer Regenschirme ihren Vater und war erleichtert. Groß und kräftig überragte Joshua Maclise die meisten in der Menge um mehr als Haupteslänge. Eva rief ihn, aber ihre Stimme ging unter im Prasseln des Hagels und dem Tosen des Verkehrs. Von einem Lastkarren hatte sich eine ganze Ladung Steckrüben auf die Fahrbahn ergossen, und sie mußte vom Rad springen, um sich einen Weg durch die Rüben zu suchen. Als sie wieder aufblickte, war er weg. Sie wollte laufen, aber das war auf der glitschigen Straße unmöglich. Erst etwas später, als der Hagel nachließ, entdeckte sie ihren Vater wieder. Er bog gerade in eine Seitenstraße ein. Sie folgte ihm, und ein Stück straßabwärts fiel ihr sein Regenschirm ins Auge, der dort an einer Hauswand abgestellt war. Das Haus gehörte Mrs. Carver, deren Mann im letzten Jahr gestorben war. Das wußte Eva, weil sie damals Mrs. Carver und ihre beiden Töchter besucht hatte, um zu kondolieren. Die Mädchen, einige Jahre jünger als Eva, waren stumm und unzugänglich gewesen, und ihre feuerroten Haare hatten irgendwie unpassend zu ihren schwarzen Kleidern gewirkt. Einen Moment lang starrte sie das Haus mit den geschlossenen Türen und heruntergelassenen Jalousien an, das finster zu ihr zurückzublicken schien. Dann sah sie an sich hinunter. Ihre Bluse hatte schwarze Rußflecken, der Saum ihres Rocks war an einer Stelle aufgerissen. Ihr Vater hatte ihr vorgeworfen, unweiblich zu sein. Wahrscheinlich hatte er recht, sagte sie sich unglücklich. Sie setzte sich wieder auf ihr Fahrrad und fuhr nach Hause. Niemand merkte, daß sie sich verspätet hatte, und ihr Vater schien den Streit mit ihr vergessen zu haben. Als er eine Stunde später nach Hause kam, war er wie ausgewechselt. Er zauste ihr die Haare, entlockte Marianne ein Lächeln und machte Iris ein Kompliment zu ihrem Kleid. Dann begrüßte er seine Frau mit einem Kuß auf die Wange und entschuldigte sich für seine Verspätung. Er habe im Werk noch zu tun gehabt, sagte er. Sie seien mit einem Auftrag in Verzug. Eva wollte widersprechen, doch dann ließ sie die Lüge stehen. Sie würde einfach vergessen, was sie gesehen hatte, sich nicht davon aus der Ruhe bringen lassen. Als Marianne vier Wochen zuvor Arthur Leighton begegnet war, war das wie ein Wunder gewesen, etwas, was einem nur einmal im Leben widerfuhr. Aber seitdem hatte sie Arthur Leighton nicht wiedergesehen. Sie erinnerte sich, daß er ihr erzählt hatte, er wohne bei den Palmers. Als sie sich bei der blassen Alice mit dem Silberblick nach ihm erkundigte, erfuhr sie, daß er schon am Tag nach dem Ball abgereist war. Einen Grund für die plötzliche Abreise hatte er nicht genannt. „Mr. Leighton hat Mama nach deiner Familie gefragt“, berichtete Alice. „Mama hat euch zusammen tanzen sehen. Sie war neugierig, ob du vielleicht eine Eroberung gemacht hast. Wenn du dir Mr. Leighton in den Kopf gesetzt hast, hast du dir ganz schön was vorgenommen, Marianne. Er ist eine fabelhafte Partie. Er ist mit einem Grafen verwandt.“ Alice kaute an einem Fingernagel. „Kann auch sein, daß es ein Vicomte ist.“ Mariannes bis dahin unerschütterliche Überzeugung, etwas Außergewöhnliches sei geschehen, geriet ins Wanken. Vielleicht hatte Mrs. Palmer ihm auf seine Frage nach ihrer – Mariannes – Familie erzählt, daß Joshua Maclise eine Werkzeugfabrik besaß und Mariannes Großmutter in Heimarbeit beinerne Messergriffe gefertigt hatte. Vielleicht hatte sie Arthur Leighton gut genug gefallen, um in ihrer Gesellschaft einen langweiligen Ballabend in der Provinz hinter sich zu brin- gen, doch dann hatte er sich angesichts der Erkenntnis, daß sie gesellschaftlich weit unter ihm stand, dazu entschlossen, die Bekanntschaft nicht zu vertiefen. Wenn sie jetzt in den Spiegel schaute, sah sie nichts als das, was sie an sich nicht mochte: die römische Nase, ihre Blässe, den Ernst ihrer Züge. Eine Ahnung von etwas Wunderba- rem hatte sie gestreift, das ihr sogleich wieder entrissen wor- den war. Nichts hatte sich geändert, nur daß sie sich selbst jetzt noch tiefer verachtete. Wie lächerlich, wie erbärmlich, so viel auf die Ereignisse einiger weniger Stunden zu geben! Eine klügere, erfahrenere Frau hätte sofort gewußt, daß er nur flirtete. Aber eines Abends dann nahm Joshua sie und Iris zu einem Abendessen bei Bekannten in Fulwood mit, und als sie sich aus der lustlosen Betrachtung der Vorspeisen auf ihrem Teller riß und die lange Tafel hinunterschaute, fiel ihr Blick auf ihn. Ihr stockte der Atem. Sie fürchtete, vor den mehr als dreißig Gästen und den Dienstboten ohnmächtig zu werden. Straußenfedern wogten, Diamanten funkelten. Sie atmete tief durch, faßte sich und blickte noch einmal die Tafel hinunter. Ja, er war es wirklich. Als er den Blick in ihre Richtung wandte, sah sie schnell weg. Keinesfalls würde sie ihn und sich in Verlegenheit bringen, indem sie ihn mit schmachtenden Blicken verzehrte wie ein dummer kleiner Backfisch. Die Speisen wurden von Dienern in weißen Handschuhen aufgetragen. Kristall glänzte im Kerzenlicht. Die einfachsten Dinge überforderten sie. Das Glas zitterte so heftig in ihrer Hand, daß sie fürchtete, es zu zerbrechen. Sie ließ ihre Serviette fallen. Stimmen schwollen an, vermischten sich, versiegten wieder, traumhaft und unwirklich. Sie bemerkte im Blick ihres Nachbarn die Ungeduld über ihre Teilnahmslosigkeit und ärgerte sich über sich selbst. Du bist eine dumme Gans, Marianne Maclise, dachte sie. Dumm und feige! Ihr Stolz half ihr. Sie richtete sich auf, zwang sich zu einem Lächeln und begann, Konversation zu machen. Und mit was für Stahl arbeiten Sie, Mr. Hawthorne? – Das ist ja faszinierend. Und Ihre Vorhängeschlösser werden bis nach Amerika versandt! Ich wollte schon immer einmal nach Amerika… Während sie sprach, wurde sie sich einer Gabe bewußt, von der sie nicht einmal geahnt hatte, daß sie sie besaß: Sie sprühte vor Charme. Nach dem Essen ließen die Damen die Herren bei Portwein und Zigarren zurück und begaben sich in den Salon. Das Hochgefühl, das sie flüchtig beschwingt hatte, verpuffte, sie fühlte sich niedergedrückt und unsicher. Niemand schien ihre Qual zu bemerken. Später folgten ihnen die Männer in den Salon. Als Marianne Arthur Leighton auf sich zukommen sah, wäre sie am liebsten davongelaufen. „Miss Maclise! Ich hatte gehofft, Sie hier zu sehen.“ „Ich dachte, Sie hätten Sheffield den Rücken gekehrt, Mr. Leighton“, murmelte sie. »An dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben – ich wurde am nächsten Tag unerwartet nach London zurückgerufen. Geschäfte«, fügte er mit einer schnellen, ungeduldigen Geste hinzu. »Ihre Gastgeber müssen ja an Ihnen verzweifeln, Mr. Leighton«, sagte Marianne mit plötzlicher Schärfe. »Diese Unberechenbarkeit! Die Palmers waren enttäuscht über Ihre Abreise.« „Nur die Palmers?“ Marianne verspürte eine Aufwallung von Hoffnungslosigkeit – sie würde gehen, ohne daß sie irgend etwas von Bedeutung miteinander gesprochen hätten, und sie würde ihn nie wiedersehen. Dann sagte er: „Ich bin die nächsten Tage in Sheffield. Darf ich Sie einmal besuchen, Miss Maclise?“ Als sie nichts erwiderte, fragte er drängender: „Darf ich?“ Sie wußte, wieviel von ihrer Antwort abhing. »Ja, Mr. Leighton, ich würde mich freuen«, erwiderte sie ruhig. Aber am folgenden Morgen hatte alles Vertrauen sie schon wieder verlassen. Überzeugt, daß er ja doch nicht kommen würde, machte sie sich weder beim Ankleiden noch beim Frisieren besondere Mühe. Als er gemeldet wurde, steckte sie in ihrem alten dunkelblauen Kleid und hatte den Kopf voll mit Haushaltskram. Alice Palmers scheinheilige Stimme klang ihr im Ohr, abfällig und voll kalter Geringschätzung. Du hast dir ganz schön was vorgenommen, wenn du dir Mr. Leighton in den Kopf gesetzt hast, Marianne. Auf dem Weg in den Salon scheuchte sie ihre Schwestern auf, Iris, Eva, sogar Clemency, die wegen einer Erkältung nicht in der Schule war. „Ich brauche euch“, sagte sie, und sie sprangen auf und folgten ihr. Immer wenn sie mit ihm in einem Raum war, nahm sie die Dinge viel plastischer wahr. Das Grün des Farns, das Blattgold auf den Tellern. Den betörend süßen Duft des Geißblatts, der durch das offene Fenster wehte. Die Stimmen ihrer Schwester verwoben sich in der schwülen Luft mit der Stimme Arthur Leightons. Das Gespräch wandte sich dem Wetter zu. Ein herrlicher Juni… beinahe zu warm… Iris gab ihr einen sanften Stoß. Sie zwang sich zu sprechen. „Bei der Hitze wünscht man sich aufs Land. In der Stadt ist es oft so – so…“ Ihr fiel das Wort nicht ein. Hilfesuchend schaute sie von einer Schwester zur anderen. „Drückend?“ fragte Eva. „Stickig?“ schlug Clemency vor. „Anstrengend“, sagte Arthur Leighton, und Marianne stimmte mit einem erleichterten Aufatmen zu. „Genau! Anstrengend. Empfinden Sie das auch so?“ „Ich habe drei Jahre in Indien gelebt. Die Temperaturen hier sind vergleichsweise erfrischend.“ „In Indien!“ rief Marianne und sah mit plötzlichem Erschrecken einen ganz anderen Arthur Leighton vor sich, in kühlem Weiß mit einem Tropenhelm auf dem Kopf vor einem Haus mit Veranda, das auf einer Anhöhe stand. Ich weiß nichts über ihn, dachte sie. Vielleicht ist er verheiratet. Oder verwitwet. Vielleicht reist er kreuz und quer durch die Welt und hat in jedem Hafen eine Geliebte – aber als er sie ansah, erwachte wieder dieses besondere Gefühl, das Gefühl, das sie beinahe vergessen hatte – oder zu vergessen versucht hatte. Es war, als öffnete sich etwas in ihrem Inneren, blühte auf wie eine Blume. Sie preßte die Hände zusammen, fassungslos darüber, wie leicht sie, die kühle, ernsthafte Marianne Maclise, offenbar außer sich geriet. Die obligate Viertelstunde war um, und er ging. Marianne schlug den Vorhang zurück, um ihm nachzusehen. Als er verschwunden war, schien der Tag dunkler geworden zu sein. „Er ist in dich verliebt“, sagte Iris neben ihr. Marianne drückte die Hände auf ihr Gesicht und schüttelte den Kopf. „Doch. Glaub mir.“ Iris’ Ton war ausnahmsweise nicht spöttisch. „Er liebt dich.“







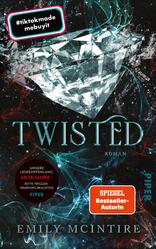
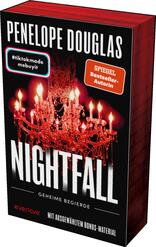





Die Familie Maclise hat sieben Kinder, darunter vier Töchter, die ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind und verschiedene Erwartungen vom Leben haben. Iris ist die Älteste, die gerne flirtet und kokettiert. Sie weist die Avancen vieler Männer und ihre Heiratsanträge zurück, um sich am Ende in einen Mann zu verlieben, den ihre oberflächliche Art vor den Kopf stößt. Für ihre Familie unerwartet, macht sie eine Ausbildung zur Krankenschwester und findet darin tatsächlich ihre Berufung. Marianne ist die erste der Schwestern, die heiratet, ihren geliebten Ehemann jedoch bereits nach wenigen Monaten nach kurzer Krankheit verliert. Nach einer langen Trauerphase wird die Sehnsucht nach einem Kind so groß, dass sie einen Teeplantagenbesitzer heiratet, den sie kaum kennt und nach Ceylon auswandert. Eva zieht von Sheffield nach London, um an der Kunstakademie zu studieren. Sie verliebt sich in einen Maler, deren Muse sie wird. Doch der Mann ist verheiratet und Eva für ihn nur eine Frau von vielen. Die jüngste der Schwestern, Clemency, wäre gerne wie ihre jüngeren Brüder noch weiter zur Schule gegangen, doch sie sieht sich gezwungen, sich um die kränkelnde Mutter zu kümmern, die seit der Geburt ihres letzten Kindes kaum mehr ihr Zimmer verlässt. Der Roman beginnt im Jahr 1909 und erzählt die unterschiedlichen Lebenswege der vier Maclise-Schwestern bis zum Sommer 1917. Dabei wechseln die Perspektiven innerhalb der Kapitel, was ich oft als zu abrupt empfunden habe. Um den Lesefluss nicht zu sehr zu unterbrechen, hätte ich es angenehmer empfunden, wenn die Autorin jeder Schwester abwechselnd ein Kapitel gewidmet hätte, insbesondere da es nach dem Auszug der drei älteren Schwestern aus ihrem Elternhaus kaum mehr Überschneidungen oder Interaktionen zwischen ihnen gibt. Jede lebt ihr eigenes Leben und dies auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die Charaktere sind individuell gestaltet und wirken mit ihren Stärken und Schwächen authentisch. Alle vier Schwestern machen während der Geschichte eine charakterliche Weiterentwicklung durch, lernen aus ihren Fehlern, haben aber stetig mit Schicksalsschlägen zu kämpfen, die sie wieder zurückwerfen und ihren Traum vom Glück zu verhindern scheinen. Der Roman tritt phasenweise auf der Stelle, da sich nicht immer viel im Leben der jeweiligen Protagonistin ereignet, die Autorin aber dennoch sehr ausschweifend erzählt. Der Roman handelt von der Rolle der Frau Anfang des 20. Jahrhunderts, von einem Kampf nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung, von den Unterschieden zwischen Arm und Reich, aber auch von der Sehnsucht nach Liebe. Jede der Schwestern verliebt sich - die eine früher, die andere später - und keine von ihnen scheint auf Anhieb die richtige Wahl zu treffen. Marianne, die nach dem Verlust ihrer großen Liebe in einer Phase der Trauer versinkt, entscheidet sich verblendet für den falschen Mann, während Iris durch ihre Arroganz den Mann verprellt, den sie liebt. Eva lässt sich von einem Bohemian auszunutzen und stellt ihre eigenen Ambitionen zurück. Auch Clemency verzichtet auf die Verwirklichung ihrer Träume, denkt, ein Leben als alte Jungfer wäre vorgezeichnet und verwendet ihre Zuneigung auf einen verheirateten Musiker, der sich in ihrer Bewunderung sonnt, aber keinerlei Ambitionen hat, mit ihr eine Familie zu gründen. Den die Titel "Alle meine Schwestern" empfinde ich als nicht passend, denn dieser wirkt, als würde eine der Schwestern oder ein Bruder über ihre bzw. seine Geschwister erzählen. Tatsächlich spielt das Gefüge als Familie eine sehr untergeordnete Rolle, die Mutter, aber insbesondere der Vater und die Brüder, bleiben Statisten. Der historische Kontext kommt gerade zu Beginn wenig zum Tragen, auch wenn einzelne geschichtliche Ereignisse Erwähnung finden. Das Verhältnis zwischen Arm und Reich Anfang des 20. Jahrhunderts, der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechtere Bezahlung sowie die Forderungen eines Wahlrechts für Frauen werden angerissen, aber nicht vollumfänglich mit den Hauptcharakteren verknüpft. Erst nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat auch das Zeitgeschehen Auswirkungen auf die Geschichte und das Leben der Schwestern. Als Leser bangt man mit ihren Schicksalen, leidet mit den Dramen und den Intrigen, die sie ertragen müssen und gibt dennoch die Hoffnung nicht auf, dass jeder von ihnen ein glückliches Ende vergönnt sein mag. "Alle meine Schwestern" ist eine emotionale Geschichte über vier Frauen und ihre unterschiedlichen Lebenswege, die zwar Längen aufweist, durch ihre Vielseitigkeit aber dennoch gut unterhält.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.