

Alles, was sie hinter sich ließ Alles, was sie hinter sich ließ - eBook-Ausgabe
Roman
„eine spannende und teilweise auch beklemmende Geschichte“ - Münsterland Zeitung
Alles, was sie hinter sich ließ — Inhalt
Eine ergreifende Geschichte über Liebe, Verlust und unerschütterliche Treue vor der Kulisse der berüchtigten Psychiatrie Willard State Asylum
Zehn Jahre ist es her, dass eine schicksalhafte Nacht für Izzy Stone alles veränderte: Ihre Mutter erschoss ihren Vater während er schlief. Seitdem lebt die nun 17-Jährige bei Pflegefamilien. Als sie für ein Museum Gegenstände ehemaliger Insassen der alten und berüchtigten psychiatrischen Anstalt Willard State Asylum katalogisiert, stößt sie auf einen Stapel ungeöffneter Briefe und das alte Tagebuch einer gewissen Clara Cartwright. Je mehr sie über Claras Leben in Erfahrung bringt, desto mehr klären sich auch die Rätsel ihres eigenen Lebens …
„Authentizität, Tiefe und ein einzigartiges Verständnis der menschlichen Psyche machen dieses Buch zu einem packenden Lesegenuss.“ NY Journal of Books
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel „Die dunklen Mauern von Willard State“
Leseprobe zu „Alles, was sie hinter sich ließ“
Kapitel 1
Isabelle
Willard State Asylum
1995
Schon kurz nachdem sie das Gelände des verlassenen Willard State Asylums betreten hatte, wusste die siebzehnjährige Isabelle Stone, dass es ein Fehler gewesen war. Wenn jemand sie auf dem mit Rissen und tiefen Schlaglöchern übersäten Hauptweg, der das weitläufige, von Bäumen gesäumte Grundstück durchzog, gesehen hätte, so hätte er ihr sicher nichts angemerkt. Er hätte nichts geahnt von dem schrecklichen Grauen, das sich in ihrem Kopf abspielte.
An jenem Samstag Ende August lag der Geruch von Lampenputzergras und [...]
Kapitel 1
Isabelle
Willard State Asylum
1995
Schon kurz nachdem sie das Gelände des verlassenen Willard State Asylums betreten hatte, wusste die siebzehnjährige Isabelle Stone, dass es ein Fehler gewesen war. Wenn jemand sie auf dem mit Rissen und tiefen Schlaglöchern übersäten Hauptweg, der das weitläufige, von Bäumen gesäumte Grundstück durchzog, gesehen hätte, so hätte er ihr sicher nichts angemerkt. Er hätte nichts geahnt von dem schrecklichen Grauen, das sich in ihrem Kopf abspielte.
An jenem Samstag Ende August lag der Geruch von Lampenputzergras und Seetang in der heißen Luft, und gelegentliche Windböen ließen das Kiefernwäldchen auf der linken Seite des offenen Parks rascheln. Die Hitze stieg flirrend von der ausgedörrten Erde auf, und Zikaden zirpten im hohen Gras nahe des Wäldchens, ein summendes, lebendes Thermometer, dessen Klang mit jedem Grad höher und nachdrücklicher wurde. Willards gepflegte Rasenflächen fielen schräg von den Hauptgebäuden ab und verliefen sanft bis zum felsigen Uferstreifen des Seneca Lakes. Segelboote tanzten auf den Wellen, und ein langer Landungssteg reckte sich wie eine Einladung in das glitzernde Wasser.
Isabelle – ihr Vater hatte sie immer Izzy genannt – hätte eigentlich den warmen Sonnenschein und die wunderschöne Aussicht genießen sollen. Stattdessen biss sie die Zähne zusammen und versuchte krampfhaft, das Bild des blutenden Lochs im Schädel ihres Vaters zu verdrängen, das sie vor Augen hatte. Sie fühlte sich wie in der Hölle gefangen. Würde sie jemals Frieden finden, oder würde sie bis an ihr Lebensende das siebenjährige Mädchen sein, das immer wieder die schreckliche Nacht durchlebte, in der ihr Vater ermordet worden war?
Izzy trat aus dem Schatten der Chapin Hall, des wuchtigen Hauptgebäudes der Psychiatrie, und hielt das Gesicht in die Sonne. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, alle Gedanken beiseitezuschieben. Als sie sich jedoch umdrehte, um an dem dreistöckigen viktorianischen Backsteingebäude mit den großen Kirchenfenstern hochzuschauen, kehrte das Gefühlswirrwarr aus Trauer und Angst zurück. Ein riesiges, zweistöckiges Turmdach mit Rundfenstern überragte ein schwarzes Mansardendach, von dem unzählige Dachgauben, Türmchen und Kamine abgingen. Ein steinerner Portikus mit Säulen, an denen der Zahn der Zeit bereits genagt hatte, schützte die riesigen Doppeltüren des Haupteingangs. Schwarze Gitterstäbe sicherten die hohen Sprossenfenster, von denen fast alle von innen mit Brettern zugenagelt waren. Die einzige Ausnahme waren die Mansardenfenster im Dachgeschoss sowie die runden Bullaugenfenster des Turmdachs. Insgesamt wirkte alles eher wie ein Spukschloss als ein Ort, der dazu bestimmt gewesen war, Menschen zu helfen.
Izzy fragte sich, welche Gräuel das wuchtige Gebäude wohl erlebt hatte. Welche schrecklichen Erinnerungen hatten sich an die Backsteine, den Mörtel und die blinden Scheiben geheftet und gehörten nun für alle Zeiten zum Bauwerk, eingefressen und darin verschlossen mit Blut und Tränen? So wie Schmerz und Leid immer ein Teil von ihr sein würden, würden die Erinnerungen von Tausenden von gequälten Seelen in der Chapin Hall und den umliegenden Gebäuden des Willard State Asylums weiterleben. Wie sollte dieser Ort jemals etwas anderes sein als eine stete Erinnerung an die geliebten Menschen, die hier gestorben waren?
Sie schluckte und drehte sich zum Wasser um, eine Hand über den Augen zum Schutz vor der Sonne. Sie fragte sich, ob Bootsfahrer, die hier vorbeifuhren, zur ehemaligen Psychiatrie hinüberschauten in der Annahme, der Verbund von Backsteingebäuden und weitläufigen Rasenflächen gehöre zu einem Countryklub oder einem College. Aus der Ferne sah alles ordentlich und vornehm aus. Doch sie wusste es besser. Sie stellte sich die ehemaligen Patienten im Park vor, wie sie trübe vor sich hin starrten – ihre dünnen Körper mit nichts als Krankenhaushemdchen bekleidet –, während sie in Rollstühlen saßen oder über das Gras schlurften. Sie stellte sich vor, eine von ihnen zu sein, und schaute auf den blauen See hinaus. Ob die Patienten mitbekommen hatten, dass andere Leute in den kleinen Gemeinden jenseits der Bucht Bootsausflüge machten, Abendessen kochten, sich verliebten und Kinder bekamen? Hatten sie sich gefragt, ob man sie jemals entlassen würde, um wieder ein Teil der „normalen“ Welt zu werden? Oder machten sie sich gar keine Vorstellung von dem Leben, das ihnen in Willard entging?
Izzy bekam Bauchweh, als eine weitere Erinnerung vor ihrem geistigen Auge aufflackerte: ihre Mutter Joyce, die mit wirrem, in alle Richtungen abstehendem Haar lang ausgestreckt auf einer Pritsche im Elmira Psychiatric Center lag und mit glasigem Blick die Decke anstarrte. Es war ein schwül-heißer Tag wie der heutige gewesen, und Izzy erinnerte sich an die verschmierte Wimperntusche und den Kajalstift, die an ihren blassen Wangen heruntergelaufen waren wie bei einem Clown im Regen. Auch wusste sie noch sehr gut, wie sie ihr Gesicht im Rock ihrer Großmutter vergraben und gefleht hatte, nach Hause zu gehen. Die endlosen weißen Korridore in der Psychiatrie, der Gestank von Urin und Bleichmittel, die dunklen Räume und die von Gummiwänden umgebenen Patienten in Rollstühlen und Betten würde sie nie vergessen. Nach diesem Besuch war sie jahrelang von Albträumen heimgesucht worden. Sie hatte ihre Großmutter angefleht, sie nicht dazu zu zwingen, noch einmal hinzugehen, und glücklicherweise hatte ihre Großmutter eingewilligt.
Izzy schlang die Arme um ihren Körper und fragte sich, während sie über den rissigen Asphalt des Hauptweges ging, warum sie bloß hergekommen war. Sie hätte Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen vorschieben können – egal was, Hauptsache, sie hätte den Besuch hier vermieden. Es gab genügend andere Museumsangestellte, die an ihrer Stelle hätten mitgehen können. Doch sie hatte ihre neue Pflegemutter nicht enttäuschen wollen – Peg war die Kuratorin des Museums. Denn zum ersten Mal seit ihrem zehnten Lebensjahr, als ihre Großmutter gestorben war, hatte Izzy Pflegeeltern, die sich wirklich um sie zu kümmern schienen.
Gewiss, in weniger als einem Jahr würde sie achtzehn. Sie war lange genug im System, um zu wissen, dass achtzehnte Geburtstage nicht mit Partys gefeiert wurden. Wenn die Schecks ausblieben, bedeutete dies nicht nur, auf sich selbst gestellt zu sein. Der Pflegeunterbringung zu „entwachsen“ bedeutete vielmehr, dass sie obdachlos würde. Sie hatte genügend Geschichten von Kindern gehört, die im Gefängnis und in Notaufnahmen von Krankenhäusern landeten, Drogen verkauften und von Sozialhilfe und Lebensmittelmarken lebten. Wie verzweifelt musste man sein, das Gesetz zu brechen, um auf diese Art und Weise überleben zu können? Im Augenblick lief alles gut, das wollte sie nicht vermasseln.
Peg hatte sie gebeten, sie zu der alten Psychiatrie zu begleiten, um noch einmal durch die Räume zu gehen, bevor die Gebäude abgerissen wurden. Vielleicht würden sie etwas finden, das aufzuheben sich lohnte. Ohne ein Wort über ihre Vorbehalte und Berührungsängste zu verlieren, hatte Izzy zugestimmt. Sie war erleichtert, als Peg sie zuerst das Außengelände erkunden ließ, anstatt sie mit den anderen nach drinnen zu schicken, in die Keller hinunterzusteigen, die Leichenhalle zu durchqueren und die verlassenen Patientenabteilungen zu besichtigen. Doch sie fragte sich, was Peg wohl denken würde, wenn sie wüsste, dass es Izzy allein schon durch die physische Nähe zu Willard übel wurde.
Sie überquerte eine Holzbrücke über ein ausgetrocknetes Flussbett und folgte dann einer einspurigen Straße in Richtung des Kiefernwäldchens. Zu ihrer Linken plünderte eine Schar Kanadagänse ein verwildertes Feld, die Köpfe über die Goldruten geneigt wie schwarzes Schilf. Wenige Schritte vom Straßenrand entfernt lagen, geschützt in einem Nest aus Lieschgras und Sternmiere, drei graugelbe Gänseküken, die ihre langen Hälse im Gras ausgestreckt hatten. Izzy blieb reglos stehen, um sie genauer anzuschauen. Die Augen der Küken waren zwar offen, doch sie rührten sich nicht. Langsam arbeitete sich Izzy zu dem Nest vor und hielt währenddessen auf dem Feld stets die Muttertiere im Blick. Doch ganz gleich, wie weit sie sich dem Nest näherte – die Küken rührten sich nicht vom Fleck; sie waren reglos wie Flusskieselsteine. Izzy musste schlucken, und ihr Hals brannte. Entweder waren die Gänseküken bereits tot oder waren im Begriff zu sterben.
Sie kniete sich hin und hob eines hoch, drehte seinen weichen, schlaffen Körper in ihren Händen und tastete unter seinen Flügeln nach Wunden. Sie bewegte seine Beine und den Hals auf der Suche nach gebrochenen Knochen. Doch es gab keinerlei Anzeichen für irgendwelche Verletzungen, und die flauschigen Daunen waren immer noch warm. Dann blinzelte das Küken. Es lebte also noch. Vielleicht waren die Kleinen ja krank, vergiftet durch unsachgemäß entsorgte Chemikalien oder Psychomedikamente aus Willard. Izzy hob auch die anderen beiden Küken hoch und legte sie wieder zurück, nachdem sie auch bei ihnen nichts hatte feststellen können.
Flüchtig dachte sie darüber nach, ob Peg ihr wohl erlauben würde, die Küken nach Hause mitzunehmen, um sie wieder aufzupäppeln. Siedend heiß fiel ihr dann jedoch wieder ein, dass man wild lebende Tiere am besten in Ruhe lassen sollte. Vielleicht würde die Mutter gleich zurückkehren und feststellen, was mit ihren Kleinen nicht stimmte. Mit Tränen in den Augen richtete Izzy sich wieder auf und lief die Straße weiter entlang. Sie warf einen Blick über die Schulter zurück in der Hoffnung, die Eltern der Küken wären aufgetaucht. Hoffentlich war ihnen nichts zugestoßen. Da sprangen die Küken plötzlich auf und trippelten eilig ins Feld, während ihre Mutter schrie und durchs Gras auf sie zugelaufen kam. Izzy grinste und wischte sich die Tränen aus den Augen, vollkommen überrascht davon, dass sich Gänse tot stellen konnten.
Erleichtert atmete sie auf und setzte ihren Weg in Richtung des Kiefernwäldchens fort. Auf der einen Straßenseite befand sich ein schiefes vierstöckiges Gebäude mitten in einem Feld. Die zerbrochenen Fensterscheiben waren mit Eisengittern versehen, der Kamin war zusammengebrochen, und die grünen Dachziegel sowie das kaputte Holz waren mit schwarzem Schimmel überzogen. Das Haus sah aus wie vom Himmel gefallen oder wie ein Schiff, das aus dem Wasser gezogen und dann Hunderte von Kilometern vom Ufer entfernt hingeschleudert worden war. Auf der anderen Straßenseite wurde eine verwilderte Wiese von gusseisernen Grabkreuzen gesäumt, die, nach links und rechts geneigt, wie schiefe, graue Zähne aussahen. Ein bitterer Geschmack breitete sich in Izzys Mund aus. Dies war der Friedhof von Willard. Sie wirbelte auf dem Absatz herum und eilte zum Hauptgebäude zurück, zu den versetzt angeordneten Reihen aus fabrikgroßen Backsteingebäuden, die mit Chapin Hall verbunden waren: die Patientenabteilungen.
Die Feuerleitern der Stationen befanden sich in Drahtkäfigen, und auch die schmutzigen Fenster waren mit dicken Eisenstäben gesichert. Von den faulenden Fensterbänken triefte schwarzer Schlamm an den Backsteinwänden hinunter. Die meisten Türen und Fenster waren von innen zugenagelt, als ob die Erinnerungen an das, was dort passiert war, niemals mehr ans Tageslicht gelangen sollten. Izzy zitterte. Wie viele Patienten hatten hier an diesem schrecklichen Ort wohl gelitten und waren gestorben?
Just in diesem Moment rief jedoch jemand ihren Namen und riss sie damit aus ihren Gedanken. Izzy drehte sich um und erblickte Peg, die mit einem breiten Lächeln die Straße entlang auf sie zugeeilt kam. Vom ersten Augenblick an, als Izzy ihrer neuen Pflegemutter begegnet war, hatte diese sie an einen Sechzigerjahrehippie erinnert. Der heutige Tag bildete da auch keine Ausnahme. Peg trug eine Jeanslatzhose sowie eine Carmenbluse mit Blumenmuster, und ihr Haar war ein chaotisches Durcheinander aus wilden Locken.
„Ist es hier nicht wunderbar?“, fragte Peg. „Ich habe gar nicht gewusst, wie riesig das Gelände ist!“
„Es ist riesig, das stimmt“, erwiderte Izzy und gab sich Mühe, liebenswürdig zu klingen.
„Hast du das Bootshaus und den Anleger gesehen?“, fragte Peg. „Im Oktober 1869 kam dort die erste Patientin für Willard mit dem Dampfschiff an. Ihr Name war Mary Rote, und sie war eine missgestaltete, demente Frau, die fast zehn Jahre lang ohne Bett und Bekleidung in einer Zelle in der Columbia County Armenanstalt angekettet gewesen war. Auch drei männliche Patienten kamen an jenem Tag an diesem Anleger an, alle in Ketten gelegt. Einer von ihnen befand sich in etwas, das wie ein Hühnerkäfig aussah.“
Izzy blickte zum Anleger hinüber. Rechts davon befand sich ein zweistöckiges Bootshaus mit zerbrochenen Fensterscheiben und fehlenden Dachschindeln, das wie ein lädiertes Gesicht mit herabhängenden Augenlidern wirkte. „Das klingt barbarisch“, stellte sie fest.
„Das war es auch“, nickte Peg. „Aber genau deshalb wurde Willard gebaut. Dies sollte ein Ort für die unheilbar Irren sein, die Plätze in Armenhäusern und Gefängnissen wegnahmen. In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft hier in diesem Heim wurden die neuen Patienten gebadet, angezogen und verpflegt, sodass sie – in der Regel – danach in ihren Abteilungen friedlich blieben.“
„Die Leute wurden hier also gut behandelt?“
Pegs Miene verfinsterte sich. „Zuerst schon, denke ich. Aber über die Jahre hinweg kamen so viele Patienten, dass Willard schließlich überfüllt war und sich die Bedingungen sehr verschlechterten. Leider verstarb fast die Hälfte der fünfzigtausend Patienten in Willard.“
Izzy kaute auf der Innenseite ihrer Wangen herum und fragte sich, wie sie darum bitten sollte, im Auto warten zu dürfen. Dann grinste Peg jedoch und nahm Izzy an die Hand.
„Komm schon!“, rief sie, und ihre Augen leuchteten auf. „Einer der ehemaligen Angestellten will uns etwas in den verschlossenen Werkstätten zeigen. Ich halte dies für einen wichtigen Fund und will nicht, dass du das verpasst!“
Innerlich stöhnte Izzy auf, folgte aber ihrer Pflegemutter den Hauptweg entlang zu den Werkstätten. Währenddessen versuchte sie, sich einen Vorwand einfallen zu lassen, um nicht nach drinnen mitgehen zu müssen. Ihr wollte jedoch partout nichts einfallen. Jedenfalls nichts, was nicht zu dumm oder verrückt klang. Und sie wollte keinesfalls, dass Peg sie für verrückt hielt. In diesem Sommer, als sie zu Peg und Harry gekommen war, hätte sie zuerst darauf wetten können, dass die beiden sich nicht vom Rest ihrer vorherigen Pflegeeltern unterscheiden würden und nur wegen des Geldes und der kostenlosen Arbeitskraft ein Kind bei sich aufnahmen. Harry war der künstlerische Leiter des Landesmuseums, und Izzy hatte den Eindruck, dass die beiden nicht gerade viel verdienten. Doch Gott sei Dank hatte sie dieses Mal vollkommen falschgelegen. Ihre neuen Pflegeeltern waren anständige Leute und bereit, ihr sowohl in physischer als auch emotionaler Hinsicht den Raum zu lassen, den eine junge Frau brauchte. Zu Hause in Pegs und Harrys dreigeschossigem Haus in Interlaken besaß sie ein eigenes Zimmer mit Blick auf den See, mit einem Fernseher, DVD-Player und Computer. Sie vertrauten ihr, und sie meinten, es läge bei ihr, etwas daraus zu machen. Es war das erste Mal, dass jemand ihr die Chance gab, sich zu beweisen, ohne sie zuerst zu verurteilen. Daher fühlte sie sich nun – zum ersten Mal seit langer Zeit – als Teil von etwas „Normalem“.
Und dennoch erschien ihr bisweilen die neue Situation zu schön, um wahr zu sein. Im Hinterkopf hatte sie immer die Befürchtung, dass etwas passieren oder jemand vorbeikommen könnte und alles verderben würde. So hatte ihr Leben bisher immer ausgesehen. Dann fiel ihr ein, dass sie in zwei Tagen ihren ersten Tag in der neuen Schule hatte. Beim Gedanken daran drehte sich ihr der Magen um. Die Neue zu sein war immer schwer.
Je näher sie den Werkstätten kamen, desto mehr geriet Izzy ins Schwitzen. Wie ihre Mutter hatte sie silberblaue Augen, schwarzes Haar und einen schneeweißen Teint. Wenn sie nervös wurde, bildeten sich überall an ihrem Hals und auf der Brust rote Flecken. Schon merkte sie, wie sich auf ihrer Haut Quaddeln bildeten. Draußen auf dem Rasen der Psychiatrie zu stehen war eine Sache. Doch nun ging sie in eines der Gebäude hinein. Der Drang wegzulaufen wurde immer größer und sorgte dafür, dass ihr das Herz bis zum Hals klopfte. Es ist nur eine Aufgabe, redete sie sich ein. Das hat nichts mit mir oder meiner Mutter zu tun. Außerdem ist es an der Zeit, kindische Ängste zu überwinden.
Sie nahm ihr langes Haar oben auf dem Kopf zusammen und wickelte es zu einem Knoten, damit der Wind ihr den Nacken kühlen konnte.
„Ist dir in diesem langärmeligen Shirt nicht warm?“, erkundigte sich Peg.
„Nein“, erwiderte Izzy, zog die Bündchen ihrer Ärmel herunter und hielt sie in ihren Fäusten fest. „Der Stoff ist ziemlich dünn.“
„Beim Falten deiner Wäsche ist mir aufgefallen, dass du gar keine kurzärmeligen T-Shirts hast“, fuhr Peg fort. „Wir könnten zusammen einkaufen gehen und dir ein paar neue Anziehsachen besorgen.“
Izzy versuchte, ein Lächeln zustande zu bringen. „Danke. Aber ich mag lange Ärmel. Und du musst dich auch nicht um meine Wäsche kümmern.“
„Es macht mir nichts aus“, erklärte Peg lächelnd. „Ich verstehe nur nicht, warum jemand bei diesem Wetter unbedingt langärmelige Shirts tragen will.“
Izzy zuckte mit den Schultern. „Ich bin ein wenig gehemmt wegen meiner Arme“, antwortete sie. „Sie sind so dürr und blass.“
„Die meisten Mädchen hätten gern so lange, schlanke Arme und Beine wie du“, entgegnete Peg lachend.
Nicht, wenn sie die gleichen Narben hätten, dachte Izzy.
Sie blickte zum See hinüber, wo sich Menschengrüppchen am Ufer versammelt hatten, an Campingtischen saßen, spazieren gingen oder Softball und Badminton spielten. Die meisten von ihnen trugen verschlissene, verwaschene Kleidung und schlurften wie von Medikamenten betäubt durch die Gegend. Izzy hielt inne. „Wer sind diese Leute?“, fragte sie Peg.
Peg hob eine Hand an die Augen, um sie vor der Sonne zu schützen, und blinzelte zum See hinüber. „Wahrscheinlich kommen sie aus der nahe gelegenen Psychiatrie, aus dem Elmira Psychiatric Center“, antwortete Peg. „Unten am See befindet sich ein Zeltplatz. Manchmal unternimmt das Personal mit den Patienten einen Ausflug dorthin.“
Izzy kamen wieder die Tränen. Schnell ging sie weiter und starrte dabei auf den Boden.
Peg folgte ihr. „Was ist los?“, fragte sie.
„Meine Mutter war dort“, erwiderte Izzy. „In Elmira.“
Peg legte ihre Hand auf Izzys Schulter. „Tut mir leid, das wusste ich nicht.“
Izzy hob den Kopf und versuchte zu lächeln. „Schon gut. Ist lange her.“
„Ich hoffe, du weißt, dass ich immer ein offenes Ohr für dich habe. Wenn du darüber reden willst.“
„Ich weiß“, nickte Izzy. „Danke.“ Aber nein danke, dachte sie insgeheim. Alles Gerede dieser Welt würde an der Tatsache nichts ändern können, dass Menschen beschädigte Ware waren. Bevor Izzys Großmutter vor sieben Jahren gestorben war, hatte Izzy drei verschiedene Ärzte aufgesucht, um von ihren wiederkehrenden Albträumen loszukommen. Doch nichts half. Außerdem hatten Ärzte keine Ahnung. Eine Handvoll von ihnen hatte beharrlich behauptet, Izzys Mutter sei zurechnungsfähig und körperlich in der Lage, sich vor Gericht zu verantworten. Jetzt befand sie sich im Gefängnis, anstatt die Hilfe zu bekommen, die sie wirklich benötigte. Denn Izzy war klar, dass Wahnsinn die einzige Erklärung sein konnte, warum ihre Mutter ihren Vater erschossen hatte, während dieser schlief.
Als sie die verriegelten Werkstätten erreichten, schloss ihnen eine ehemalige Angestellte die Tür auf und ließ Izzy, Peg sowie zwei weitere Museumsmitarbeiter herein.
„Hier haben die Patienten Füller und zusammengeklebte Papiertüten verpackt“, erklärte die ehemalige Angestellte fröhlich, als würde sie ihnen einen Stand mit Quilts auf einem Wochenmarkt präsentieren.
In dem Gebäude standen leere Werktische in kargen Räumen. Vergilbte, sich an den Enden einrollende Kalender und alte Feuerlöscher hingen an den mit Rissen übersäten, abblätternden Wänden. Der alte Lastenaufzug war schon seit Jahren außer Betrieb, weshalb Izzy und die anderen eine steile, schmale Treppe drei Etagen bis zum Dachboden hinaufgehen durften. Dabei mussten sie über eingebrochene Stufen sowie dicke, alte Brocken Putz hinwegsteigen und immer wieder Spinnweben beiseitewischen. Oben angekommen, schloss die ehemalige Angestellte die Dachbodentür auf und lehnte sich mit all ihrem Gewicht dagegen, um die Tür mit Gewalt zu öffnen. Die Tür bewegte sich jedoch keinen Millimeter. Peg kam hinzu, um zu helfen, und stemmte sich mit beiden Händen gegen das Holz. Schließlich kreischten die Scharniere, und die Tür gab nach. Die abgestandene, staubige Luft im Treppenhaus entwich zischend nach oben, als würde der Dachboden einmal unglaublich tief Luft holen. Die Angestellte führte sie nach drinnen.
Auf dem Dachboden war es heiß und stickig, und in der Luft hing der Geruch von altem Holz, Staub und Vogelkot. Hier und da lag abgestorbenes Laub auf dem Holzboden, das über Jahre hinweg durch eine kaputte Scheibe in einem der Fenster hineingeweht worden war. Ein schmuddeliger Laborkittel hing an einem Nagel an der Wand, und aus mehreren geöffneten Koffern ergoss sich deren Inhalt auf die Dielen des Dachbodens. Hausschlüssel und Fotografien, Ohrringe und Gürtel, Blusen und Lederschuhe mischten sich mit Schmutz und Blättern – wie Habseligkeiten, die man aus einem Grab ausgebuddelt hatte und die sich allmählich zersetzten. In der Mitte des weitläufigen Raumes stand eine Arzttasche, daneben lag etwas, das wie eine zerrissene Landkarte aussah. Beides war mit einer dicken Schicht Staub und getrocknetem Taubenkot bedeckt. Unter den Dachsparren nahmen reihenweise hölzerne Wandregale beinahe den gesamten Platz ein. Mit „Männer“ und „Frauen“ beschildert und von A bis Z auf jeder Seite sortiert, standen die überdimensionalen Regale im rechten Winkel zu den hohen Wänden, sodass sich in der Mitte ein langer Korridor bildete wie der Hauptgang in einem Lebensmittelmarkt oder einer Bücherei. Doch statt Konserven oder Büchern stapelten sich in den Regalen Hunderte staubbedeckte Koffer, Holzkisten, Schachteln, Schrankkoffer und Überseekoffer.
„Was ist das?“, fragte Peg, und in ihrer Stimme schwang Ehrfurcht.
„Hier sind die Koffer aufbewahrt worden“, erklärte die ehemalige Angestellte. „All diese Koffer und Kisten wurden von Patienten zurückgelassen, die in der Einrichtung angemeldet, aber niemals abgemeldet wurden. Seit ihre Besitzer sie vor Jahrzehnten vor ihrem Einzug in die Psychiatrie gepackt haben, sind sie nicht mehr angefasst worden.“
Izzy kaute auf der Unterlippe herum und blinzelte, um gegen die Tränen in ihren Augen anzukämpfen. Sie musste an den geöffneten Reisekoffer ihrer Mutter denken, der auf dem Tisch am Bettende gelegen hatte und in dem Unterwäsche, BHs und Nachthemden in einem wirren Durcheinander aufeinandergetürmt gewesen waren. Niemals würde sie das erste Mal vergessen, als sie das Schlafzimmer der Eltern betreten hatte, nachdem ihr Vater erschossen worden war. Ihre Großmutter hatte Hilfe dabei benötigt, die Sachen von Izzys Mutter zu finden und einzupacken. Izzy hatte wie in Zeitlupe die Kommodenschubladen geöffnet, aus denen der vertraute Parfumgeruch ihrer Mutter drang, der an ihren Miedern und ihrer Unterwäsche haftete und Izzy daran erinnerte, was sie verloren hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte Izzy immer noch den Geruch vom Blut ihres Vaters sowie den Hauch von Schießpulver in der Luft riechen. Sie erinnerte sich gut daran, wie sie das Elternbett angestarrt hatte, dessen Kopfende, Fußende und Seitenteile abmontiert worden waren und nun an der Schlafzimmerwand lehnten, als würden sie nun endlich in das größere Haus ziehen, das sich ihre Mutter immer gewünscht hatte. Jetzt brauchte Izzy ihre ganze Selbstbeherrschung, um nicht vom Dachboden die Treppe hinunter und hinaus an die frische Luft zu fliehen, weit weg von den Erinnerungen an verlorene und zerstörte Leben.
„Das ist ja eine wahre Fundgrube“, rief Peg. Begeistert lief sie die Gänge entlang, fuhr sanft mit der Hand über lederne Koffergriffe sowie aufrecht stehende Schrankkoffer und warf einen flüchtigen Blick auf Namensschilder und verschossene Monogramme. Dann wirbelte sie herum und sah die ehemalige Angestellte mit großen Augen an. „Was passiert hiermit?“
Die Angestellte zuckte mit den Schultern. „Das wird wohl alles entsorgt werden, denke ich.“
„O nein“, rief Peg. „Das können wir nicht zulassen. Wir müssen die Koffer ins Museumsdepot bringen.“
„Alle?“, fragte eine der Museumsangestellten verwundert.
„Ja“, nickte Peg. „Begreift ihr das denn nicht? Diese Koffer sind mindestens genauso bedeutsam wie eine archäologische Ausgrabung oder eine Reihe alter Gemälde. Diese Menschen hatten nie auch nur den Hauch einer Chance, ihre Geschichte außerhalb der Grenzen einer psychiatrischen Anstalt zu erzählen. Wir jedoch können versuchen, herauszufinden, was ihnen passiert ist, indem wir uns ihre persönlichen Habseligkeiten anschauen. Wir haben hier die seltene Chance, ihr Leben zu rekonstruieren, das sie vor ihrer Einweisung geführt haben!“ Sie drehte sich zu Izzy um. „Klingt das nicht aufregend?“
Izzy gab sich Mühe, ein Lächeln zustande zu bringen, doch ein fürchterliches Grauen machte sich in ihrer Brust breit und sorgte für ein beklemmendes Gefühl.
Kapitel 2
Clara
Upper West Side, New York City
Oktober 1929
Die achtzehnjährige Clara Elizabeth Cartwright stand auf dem dicken Perserteppich vor dem Arbeitszimmer ihres Vaters. Sie hielt den Atem an und beugte sich leicht vor, um das Gespräch ihrer Eltern durch die geschnitzte Eichentür mitzuhören. Als sie noch klein war, hatte die üppige Ausstattung der elterlichen Villa – der vertäfelte Korridor, die glänzenden Holzböden, die gerahmten Familienporträts und vergoldeten Spiegel, das silberne Teeservice auf dem Kirschbaumschränkchen – ihr stets das Gefühl gegeben, wie eine Prinzessin in einem Schloss zu wohnen. Jetzt allerdings verliehen ihr die massiven Holzarbeiten und die schweren Vorhänge eher den Eindruck, in einem Gefängnis eingesperrt zu sein. Und das nicht nur, weil ihr schon seit drei Wochen verboten war auszugehen. Das Haus kam ihr wie ein Museum vor, vollgestopft mit alten Möbeln und altmodischem Schnickschnack, an denen der Muff von überholten Vorstellungen und vorsintflutlichen Überzeugungen haftete. Alles erinnerte sie an ein Mausoleum, eine letzte Ruhestätte für die Toten und Sterbenden. Und sie hegte nicht die Absicht, als Nächste an der Reihe zu sein.
Sie atmete aus und versuchte, sich zu entspannen. Ihre Fluchtpläne waren zwar schon einmal ausgetestet worden, doch das war die letzte Möglichkeit, die ihr noch blieb. Der Gestank von verrottetem Holz, den die Zigarre ihres Vaters verbreitete, strömte unter der Tür hindurch und mischte sich mit dem zitronigen Duft der Möbelpolitur. Dies erinnerte sie an die vielen Stunden, die sie hier genau an dieser Stelle mit ihrem älteren Bruder, William, verbracht hatte, wenn sie gemeinsam auf ihre tägliche „Anhörung“ bei ihrem Vater, Henry Earl Cartwright, gewartet hatten. Solange sie sich zurückerinnern konnte, hatten sie zudem jeden Freitag nach der Schule, nachdem die Hausarbeiten erledigt und sie eine Runde im Park spazieren gewesen waren, bis zum Abendessen vor seinem Arbeitszimmer gewartet und sorgsam darauf geachtet, sich still und leise zu beschäftigen, um ihren Vater nicht zu stören. Dann, wenn er fertig war, rief er sie der Reihe nach zu sich herein, um sie Bericht erstatten zu lassen über die Schule, um Verhaltensprobleme schon im Keim zu ersticken und um ihnen zu erklären, was er von ihnen in ihrem jeweiligen Alter erwartete. Von William und Clara wurde erwartet, dass sie auf der anderen Seite des überdimensionalen Schreibtisches standen, das Kinn hoben und den Blick streng geradeaus gerichtet hielten. Ohne herumzuzappeln, sollten sie zuhören, bis ihr Vater nickte und sich eine Zigarre ansteckte, was das Signal dafür war, dass sie entlassen waren.
Ihre Mutter, Ruth, hatte klargestellt, dass Unterhaltungen über Disziplin und schulische Leistungen zu ermüdend und anstrengend seien für ihre labile Konstitution. Jeden Tag um die gleiche Uhrzeit machte sie ihr Nickerchen, während ihr Ehemann sich um die ungeliebte Aufgabe kümmerte, die Kinder zu erziehen. Erst in den letzten Jahren, als Clara in ihrer jungen Weiblichkeit aufblühte, gefährdet im Hinblick auf die Tricks und Sehnsüchte der jungen Männer, hatte Henry darauf bestanden, dass Ruth sich ebenfalls einschaltete. Zunächst hatte Ruth nur einen halbherzigen Versuch unternommen, doch vor drei Wochen hatte sie sich dann entschlossen, ihre Aufgabe ernst zu nehmen. Clara fragte sich, was William wohl dazu gesagt hätte, dass ihre Eltern sie wie eine Kriminelle eingesperrt hielten.
Beim Gedanken an ihren älteren Bruder kamen Clara die Tränen, und ihr Herz gewann die Oberhand. Williams Leiche war vor anderthalb Jahren aus dem Hudson River gezogen worden. Es kam ihr wie gestern vor. Sie erinnerte sich an die Miene ihres Vaters, als er die Nachricht erhielt, daran, wie seine Kieferknochen immer wieder vorgetreten waren, an seine feuerroten Wangen, als er die Tatsache verarbeitete, dass sein ältestes Kind tot war. Und dennoch waren seine Augen trocken geblieben. Clara erinnerte sich auch noch gut an ihr Verlangen, mit ihren Fäusten auf seine Brust einzuschlagen und zu schreien, dass es seine Schuld sei. Doch er hätte ihr niemals geglaubt. Sein Verstand und seine Seele waren ein zusammengeklapptes, verschlossenes Buch, in dem nur seine Ansicht dessen geschrieben stand, wie alles zu laufen habe. Clara hatte weder ihn noch ihre Mutter umarmt und stattdessen still gelitten, während ihre Eltern die Rolle der trauernden Eltern spielten. Sie war fest entschlossen, nicht das nächste Opfer von Henry Cartwrights eiserner Faust zu werden.
Hätte es die Samstagabende im Cotton Club nicht gegeben, wo sie endlich sie selbst sein konnte, wo sie mit ihren Freunden lachen und tanzen konnte, so war ihre feste Überzeugung, hätte sie schon vor Monaten den Verstand verloren. Doch vor drei Wochen war sie das letzte Mal mit ihren Freunden ausgegangen. Es fühlte sich wie ein Jahrzehnt an.
Als junges Mädchen hatte sie alles versucht, um ihren Eltern zu gefallen. Sie hatte hervorragende Noten in der Schule bekommen, ihr Zimmer makellos sauber und aufgeräumt gehalten, ihre Eltern niemals unterbrochen und – am allerwichtigsten – niemals Widerworte gegeben. Doch je älter sie wurde, desto klarer wurde ihr, dass ihre Eltern der Meinung waren, dass sie und ihr Bruder gesehen, aber nicht gehört werden sollten. Die Erwachsenen dieses Hauses sorgten für Nahrung und Unterkunft für ihre Kinder, mehr nicht. In den letzten zwei Jahren seit Williams Verschwinden war es für Clara immer leichter geworden, zu lügen, zu behaupten, sie gehe in die Bücherei, wenn sie in Wahrheit mit ihren Freundinnen in die Nachmittagsvorstellung ging, um sich einen Charlie-Chaplin-Film anzuschauen, oder in den Central Park, um Jungs beim Skeeballspielen oder an der Schießbude zuzusehen. Anfangs war sie überrascht gewesen, dass ihre Mutter bei ihrer Heimkehr nicht in der Tür auf sie gewartet hatte, die Hände in die Hüften gestemmt, um Henry herbeizurufen und ihr eine wie auch immer geartete Strafe aufzuerlegen, die er für angemessen hielt. Clara konnte Henrys tiefe Stimme in ihrem Kopf hören, völlig außer Fassung vor Wut.
„Dein Platz ist hier, zu Hause, wo du zu lernen hast, wie man kocht und sich um Kinder kümmert, anstatt in der gesamten Stadt herumzuscharwenzeln! Was hast du dir dabei bloß gedacht? Du bist eine Cartwright, verdammt noch mal! Also solltest du dich auch wie eine verhalten, sonst landest du schneller draußen auf der Straße, als du bis drei zählen kannst!“
Irgendwann wurde ihr klar, dass ihre Eltern nicht einmal wussten, dass sie fort war. Zuerst hatte sie angenommen, sie seien zu sehr mit ihrer Sorge um William beschäftigt – mit der Frage, ob ihm wohl etwas zugestoßen war oder ob er etwa nach seinem Streit mit Henry alle Verbindungen zu ihnen abgebrochen hatte. Clara dagegen fragte sich, ob ihre Mutter vielleicht doch ein Herz besaß, ob sie möglicherweise tatsächlich zu empfindsam war und die Sorge um zwei Kinder einfach zu viel für sie war. Dann wurde ihr jedoch klar, dass ihre Mutter Ladys zum Tee einlud, während ihr Sohn verschwunden war und ihre Tochter machte, was ihr gefiel; sie besprach mit Lebensmittellieferanten und Floristen ihre nächste Gesellschaft, las Magazine und trank schwarzgebrannten Whiskey, bestellte neue Kleider, Pelze und Schmuck.
Nachdem Williams Leiche gefunden worden war, hörte Ruth auf, Gesellschaften zu planen. Doch sie trank weiterhin Whiskey, bis sie beinahe jeden Abend das Bewusstsein verlor. Sie behauptete, der Alkohol beruhige ihre Nerven, und Henry, der seine Tage damit verbrachte, Geschäfte zu führen, und sein Arbeitszimmer nur zum Essen und Schlafen verließ, stellte sicher, dass der Whiskeyvorrat für seine gramerfüllte Ehefrau nie zur Neige ging. Augenscheinlich waren ihre Eltern erleichtert, Clara aus dem Weg zu haben, solange sie um Punkt halb sechs zum Abendessen erschien – falls sie zu spät sein sollte, wäre sie besser tot oder läge zumindest in den letzten Zügen.
In den letzten sieben Monaten hatte sie ihren Eltern jede Woche die gleiche Geschichte aufgetischt, dass sie nämlich mit Julia, Mary und Lillian zu einer Vorstellung ging. Danach würde sie die Nacht bei Lillian verbringen. Ruth kannte zwar Lillian kaum, doch sie war einverstanden, dass Clara ihre Freizeit mit ihr und den anderen Mädchen verbrachte – schon allein weil ihre Mütter Mitglieder des Frauenbundes waren und in Ruths Kirche gingen. Für Ruth ergab es irgendwie durchaus einen Sinn, dass, wenn Julia und Mary die Nacht bei Lillian verbringen durften, alles schon seine Ordnung haben würde.
In Wahrheit trafen sich jedoch die Mädchen, anstatt ins Theater zu gehen, bei Lillian, um sich das Haar von Hand in Wellen zu legen und ihre mit Perlen besetzten, mit Fransen versehenen Charlestonkleider anzuziehen. Sie schoben ihre Strümpfe bis zum Knie hinunter, um zu zeigen, dass sie keine Korsetts trugen, und schlüpften in Riemchenschuhe mit hohen Absätzen. Dazu trugen sie lange Perlenketten, die zwischen ihren Brüsten hingen. Um zehn Uhr abends holte dann Lillians Freund sie in seinem Bentley ab und fuhr mit ihnen in die Stadt, während ihm sein Bruder im Rolls-Royce voller Freunde folgte.
Ihr Lieblingsklub, der Cotton Club, war ein angesagter Treffpunkt an der Ecke 142nd Street und Lenox Avenue mitten in Harlem, und er war als Tummelplatz der Reichen bekannt. In dem dunklen, verrauchten Klub tranken Clara und ihre Freunde schwarzgebrannten Gin, aßen in Schokolade getauchte Kirschen, rauchten Zigaretten und tanzten Charleston und Tango. Sie hörten Jazzmusik von Louis Armstrong und betranken sich derartig, dass sie kaum noch aufrecht stehen konnten.
Am allerwichtigsten war jedoch, dass Clara im Cotton Club Bruno kennengelernt hatte. Der Sohn eines Schuhmachers war in Italien geboren und allein nach Amerika gekommen. Den glamourösen Glanz eines New Yorker Klubs war er nicht gewohnt. Und dennoch, als sie ihn zum ersten Mal erblickte und sah, wie er sich mit einer weißen Weste, Krawatte und einem schwarzen Frack durch die Menge schlängelte, wirkte er, als gehöre er genau hierher. Er eilte an den Mädchen vorbei, die ihn um einen Tanz baten, zeigte keinerlei Interesse für Kaviar und Serviertabletts voller Martinis und arbeitete sich durch den Klub, seinen glühenden Blick fest auf Clara geheftet. Zu diesem Zeitpunkt tanzte sie gerade Walzer mit Lillians Bruder Joe, der sturzbetrunken war, endlos von seinem Job bei der New York Stock Exchange schwafelte und damit prahlte, die Mittel zu haben, eine Frau mit allem überhäufen zu können, was sie sich erträumte.
Clara bemerkte, wie sich Bruno zu ihnen vorarbeitete, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Er wirkte erbost, als mache jemand seinem Mädchen Avancen. Sie wunderte sich, ob er sie vielleicht mit einer anderen verwechselte, und bereitete sich mental darauf vor, den armen, betrunkenen Joe zu verteidigen. Dann beugte sich Joe vor, um sie zu küssen, doch sie drehte sich weg und ließ seine feuchtkalten Hände los. Bevor sie wusste, wie ihr geschah, hatte sich Bruno dazwischengedrängt und wirbelte sie über die Tanzfläche. Benommen taumelnd blieb Joe in der Mitte des Saals zurück.
Während sie miteinander tanzten und sich seine große Hand gegen ihr Kreuz drückte, blickte Bruno mit ernstem Blick auf Clara hinunter. Von Nahem betrachtet sah er aus wie ein Adonis; das schwarze Haar war mit Pomade zurückgekämmt, die Haut seines kantigen Gesichts weich und sonnengebräunt. Weil sein intensiver, anhaltender Blick sie aus der Fassung brachte, senkte Clara das Kinn.
„Ich hoffe, das war nicht dein Freund“, stellte er mit tiefer Stimme fest. Sein Akzent ließ jedes Wort voll und fremdartig klingen.
Sie schüttelte den Kopf und musterte die Leute um sie herum. Lillian und Julia saßen an der Bar, Gingläser schwangen in ihren Händen. Lillian spielte an ihrer Perlenkette herum, während Julia einen attraktiven Mann mit einer Feder aus ihrem Kopfschmuck kitzelte.
„Tut mir leid, dass ich dich deinem Tanzpartner abgeworben habe“, fuhr Bruno fort. „Aber ich hatte Angst, dass du mich abweisen würdest, wenn ich erst fragen würde. Kannst du mir verzeihen?“
Clara schaute zu ihm auf. Beim Blick in seine Augen, die schwarz wie Ebenholz waren, war es um sie geschehen. Sie schluckte, unfähig, den Blick von ihm abzuwenden. In der Hoffnung, amüsiert und lässig zu wirken, ließ sie ein Lächeln aufblitzen. „Ich denke schon“, erwiderte sie.
„Du findest mich zu direkt“, stellte er fest, woraufhin sich seine vollen Lippen zu einem schwachen Grinsen hoben.
„Nein“, antwortete Clara, „aber ich …“
In diesem Moment tauchte Joe auf und tippte Bruno auf die Schulter. Bruno drehte sich um, woraufhin Joe die Faust reckte, das Gesicht knallrot und vor Wut verzerrt. „Stopp!“, schrie Clara und hob abwehrend die Hand.
Joe erstarrte, die Hand in der Luft angewinkelt. „Woher willst du wissen, ob dieser Kerl nicht ein Herumtreiber ist?“ Geifer spritzte von seinen Lippen. „Auf mich wirkt er wie ein Lebemann.“
„Schon gut“, beruhigte Clara ihn. „Wir tanzen doch nur.“
„Sicher?“
„Sicher“, erwiderte Clara. „Wir unterhalten uns später, wenn wir alle gemeinsam zum Dinner gehen. In Ordnung?“
Joe kniff die blutunterlaufenen Augen zusammen und musterte Bruno, bevor er dann die Faust sinken ließ. Bruno lächelte, streckte die Hand aus und stellte sich vor. „Ich verspreche Ihnen, sie Ihnen gleich wieder zu übergeben …“ Er berührte Claras Handgelenk mit seinen warmen Fingern. „Tut mir leid, ich weiß nicht einmal deinen Namen.“
„Clara“, antwortete sie und spürte, wie sich ihre Wangen röteten.
„Ich verspreche, Clara ihren Freunden unversehrt wieder zu übergeben“, wandte sich Bruno an Joe.
„Schmeichel dich hier bloß nicht ein“, warnte Joe. „Sonst befördern meine Freunde und ich dich schneller auf die Straße, als du gucken kannst.“
„Ich versichere Ihnen“, fuhr Bruno höflich fort, „dass ich zu meinem Wort stehe.“
Schließlich nestelte Joe an seiner Krawatte herum, schüttelte Brunos Hand und wankte davon. Bruno nahm Clara an die Hand.
„Darf ich um diesen Tanz bitten, bella Clara?“, fragte er. Sie nickte, woraufhin er sie an sich zog. Die Perlen auf ihrem Kleid pressten gegen seine feste Brustmuskulatur, während die Bügelfalte seiner Hose ihre nackten Beine streifte. Das Lied Someone to Watch Over Me war schon fast vorbei, doch plötzlich hatte Clara das Gefühl, sich schnell hinsetzen zu müssen. Ihre Knie waren ganz weich, und ihr war schwindelig. Im Cotton Club hatte sie mit Dutzenden von Männern getanzt, von denen einige ihren Vater kannten und sich Hoffnungen auf ihr Vermögen machten und einige wirklich daran interessiert waren, sie kennenzulernen. Aber bei keinem dieser Männer hatte sie je ein solches Gefühl gehabt. Sie packte seine Hand fester und fragte sich, ob es am Gin oder dem Moschusduft seines Parfums lag, dass ihr so schwindelig war.
„Geht es dir gut?“, erkundigte er sich. „Brauchst du ein wenig frische Luft?“
Sie schüttelte den Kopf. „Alles in Ordnung“, entgegnete sie. „Ich denke, der Alkohol ist mir ein wenig zu Kopf gestiegen, das ist alles.“
„Ich werde aufpassen, dass du nicht hinfällst“, versprach er. Dann neigte er den Kopf und rieb seine Nase an ihrem Ohr, während sein warmer Atem ihr einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagte. Just in diesem Augenblick endete das Lied, und er hörte auf zu tanzen. Dennoch ließ er ihre Hand nicht los.
„Hast du Lust, mitzukommen und mit meinen Freunden und mir zu Abend zu essen?“, fragte sie ihn heiser. „Wir trinken immer noch einen Kaffee nach dem …“
„Sehr gern“, erwiderte Bruno. Seine Hand strich ihr über die Wange und hob dann ihr Kinn. „Da ist nur eine Sache, die ich zuvor gern erledigen würde“, erklärte er. Dann presste er seine Lippen auf die ihren und küsste sie so heftig, dass seine Zähne ihr beinahe in die Lippe geschnitten hätten. Zuerst leistete sie noch Widerstand, doch dann erwiderte sie seinen Kuss und schmolz in seinen Armen dahin. Der Lärm von Gelächter und klirrenden Gläsern wurde ausgeblendet – alles, was sie noch hörte, war allein ihr rasendes Herz. Weiße Blitze leuchteten hinter ihren Augenlidern auf, und Sehnsucht entbrannte in ihrem Becken. Als sie sich voneinander lösten, sah er sie atemlos an.
„Siehst du“, stellte er fest. „Manchmal ist es besser, nicht zu fragen.“
Da sie unfähig war, auch nur einen Ton zu sagen, nickte sie nur.
Später, beim Abendessen, saßen sie allein in einer Sitzecke, tranken Kaffee und teilten sich ein Stück Apfelkuchen. Lillian, Julia und der Rest der Truppe unterhielten sich und lachten auf zwei überdimensionalen Sitzgruppen auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges, doch Clara und Bruno merkten die Anwesenheit der anderen kaum. Er erzählte ihr von seiner Familie daheim in Italien und von seinen Träumen, ein erfolgreiches Leben in Amerika zu führen. Überrascht stellte Clara fest, dass sie sich ihm gegenüber mehr öffnete als jedem anderen, mit Ausnahme von William. Sie gestand ihre Enttäuschung über ihre Eltern und war den Tränen nahe, als sie von ihrem geliebten Bruder sprach, der verstorben war. Bruno beugte sich über den Tisch, nahm ihre Hand und ließ sie wissen, dass er komplizierte Familienangelegenheiten dieser Art aus eigener Erfahrung kannte. Mehr als alles andere wünsche er sich eine eigene Familie, eine Familie, die sich liebte und sich miteinander vertrug, ganz gleich, was geschah. Clara wünschte sich das Gleiche.
Am Ende des Abends konnten sie die Hände nicht voneinander lassen, und am Ende der Woche trafen sie sich in seinem Apartment. Am Ende des Monats war Bruno ein Teil der Gruppe geworden, und selbst Lillians Bruder, Joe, fand ihn großartig.
Jetzt, als sie draußen vor dem Arbeitszimmer ihres Vaters stand, konnte Clara auf der anderen Seite der mit Schnitzarbeiten versehenen Holztür den tiefen Bariton ihres Vaters hören, der wie ein abbremsender Zug grollte und polterte, und ihre Mutter, die jammerte und schniefte, während sie sich mit gedämpften Stimmen aufgebracht unterhielten. Sie stritten nicht miteinander, doch sie waren verärgert darüber, dass Clara einmal nicht gehorsam ihren Plänen gefolgt war, und besprachen dies.
Clara legte schützend die Hand auf ihren Unterleib und versuchte, mit einem Blinzeln gegen die Tränen anzukämpfen. Die Verlobungsfeier war für morgen angesetzt, komplett mit einem Fotografen, einem Speisenlieferanten und allen wichtigen Freunden ihrer Eltern. Begierig, mit der Braut in spe seines Sohnes prahlen zu können, hatte der Geschäftspartner ihres Vaters, Richard Gallagher, ein Dutzend Gäste eingeladen. Zehn Tage zuvor waren die Einladungen verschickt worden, und nur wenige Antworten waren mit einer negativen Rückmeldung zurückgekehrt. James Gallagher, der Mann, den Clara heiraten sollte, hatte einen Ring, den Zweikaräter seiner verstorbenen Mutter, säubern und polieren lassen und den Auftrag erteilt, ihn obendrein mit vier zusätzlichen Diamanten zu versehen. Ruth hatte Claras Kleid ausgesucht und einen Friseur bestellt, um ihnen vor der Feier das Haar zu frisieren. Alles lief so, wie ihre Eltern es geplant hatten. Die Gäste würden eintreffen in der Annahme, Henrys und Ruths Hochzeitstag zu feiern, um dann, kurz vor dem Abendessen, mit der Bekanntgabe der Verlobung von James und Clara überrascht zu werden.
Plötzlich stieg Clara der nach fauligen Eiern riechende Gestank von gegorenem Wasser in die Nase, sodass sie beinahe würgen musste. Der Gestank kam aus der Blumenvase auf dem Beistelltisch aus Kirschbaumholz. Sie trat von der Tür zurück und presste eine Hand auf Nase und Mund, um ihren Magen, der gerade in Aufruhr war, zu beruhigen. Sollte sie noch länger im Korridor stehen und ihre Ansprache üben, würde sie entweder in Ohnmacht fallen oder sich übergeben. Also jetzt oder nie.
Sie klopfte an die Tür des Arbeitszimmers.
„Was gibt es?“, brüllte ihr Vater.
„Ich bin es.“ Die Worte blieben ihr beinahe im Hals stecken. Sie räusperte sich leise und fuhr dann fort: „Ich bin’s, Clara. Darf ich hereinkommen?“
„Tritt ein!“, rief ihr Vater.
Clara legte die Hand auf den Türknauf und drehte ihn schon, als ihr auffiel, dass ihre andere Hand immer noch auf ihrem Bauch ruhte. Das Blut stieg ihr ins Gesicht, als sie ihre Fäuste hinuntersausen ließ. Sie wusste, dass ihre Mutter sie schon länger beobachtete und die Breite ihrer Taille eingehend musterte, ihren Appetit am Morgen genau beobachtete und die Anzahl der Damenbinden unter dem Waschbecken im Badezimmer nachzählte. Wenn Clara nun also mit einer schützenden Hand auf ihrem Bauch das Arbeitszimmer ihres Vaters betrat, dann wäre ihrer Mutter sofort klar, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet hatten.
Clara holte tief Luft und öffnete die Tür.
Ihre Mutter saß auf einem roséfarbenen Sofa neben dem Backsteinkamin und wedelte sich mit einem geblümten Fächer Luft zu, ihre Füße ruhten auf einem gepolsterten Hocker. Wie gewohnt hatte sie ihr kastanienbraunes Haar im Gibson-Girl-Stil auftoupiert und oben auf dem Kopf zu einem lockeren Knoten gebunden. Zu Claras großer Überraschung war das bodenlange, mit einem Reifrock versehene Kleid hochgezogen und entblößte blasse Waden oberhalb von spitzen Schnürstiefeln. Ruth war der Auffassung, dass eine anständige Frau immer ihre Arme und Beine bedeckt haben sollte, ganz gleich, was auch geschah. Sie musste wirklich aufgebracht sein, dachte Clara.
Clara war nicht sicher, wann es genau dazu gekommen war, aber sie hasste die viktorianischen Kleider ihrer Mutter sowie deren altmodische Frisuren, die Kameenbroschen und Ringe. Selbst traditionelle Eigenheiten und vorgestrige Redensarten erinnerten sie an die sittsame, prüde Art ihrer Mutter. Allein schon das Rascheln von Ruths mehrschichtigen Röcken im Korridor und das harte Klappern ihrer Schuhe auf dem Boden reichten aus, um Clara einen Schauder über den Rücken zu jagen.
Jetzt erhob sich Ruth und strich mit den Händen über ihr Kleid, bei dem das Sans-Ventre-Korsett ihre schmale Taille noch schmaler machte. Instinktiv straffte Clara die Schultern und zog den Bauch ein in der Hoffnung, ihre Mutter würde nicht bemerken, dass sie kein Korsett trug.
Im Alter von sechs Jahren war Clara in ihr erstes Korsett gezwängt worden, nachdem ihre Mutter ihre Taille gemessen und erklärt hatte, sie sei schrecklich dick und plump. Ruth hatte verkündet, dass, sollten nicht unverzüglich vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, Claras Haltung und Gesundheit Schaden nehmen würden und kein Mann, der bei vollem Verstand war, ein herumtobendes Mädchen mit einer Taille heiraten würde, die mehr als dreiundvierzig Zentimeter Umfang habe. An jenem Abend noch hatte Ruth sie in ein mit schweren Stäbchen versehenes Mieder geschnürt und darauf bestanden, dass es nur im Krankheitsfall oder zum Baden ausgezogen werden durfte. Eine Woche später hatte Clara mitten in der Nacht die Schnüre gelöst, um schlafen zu können. Am nächsten Morgen hatte Ruth das Korsett auf dem Boden liegend neben Claras Bett vorgefunden und Clara daraufhin aus dem Tiefschlaf gerissen, um ihr eine ordentliche Tracht Prügel zu verpassen. Danach hatte sie für die nächsten zwei Wochen jeden Abend Claras Handgelenke mit einem seidenen Taschentuch zusammengebunden, um sie von Dummheiten abzuhalten. Als Clara älter wurde, wurden ihre Korsetts von einem stämmigen Kammermädchen mit muskulösen Armen immer fester und fester zugeschnürt. Mit achtzehn maß Claras Taille dreiundvierzig Zentimeter, und immer noch zeigte sich Ruth nur verächtlich und erinnerte Clara unaufhörlich daran, dass ihre eigene Taille nur vierzig Zentimeter maß – wobei sie jedoch vergaß, dass Clara gute fünf Zentimeter größer war als sie selbst.
Im Arbeitszimmer ihres Vaters blickte Clara nun zu ihrer Mutter hinüber. Ruth wäre entsetzt, wenn sie die Armreifen, die Haarschmuckfedern und das Fransenkleid finden würde, die Clara ganz hinten in ihrem Schrank versteckt hatte, in dem Überseekoffer unter einem alten Wollanzug. Als könne sie Claras Gedanken lesen, schnaubte Ruth und sah zum Fenster hinaus, die Lippen zu einer schmalen, strengen Linie zusammengepresst. Ihr Vater zog die Augenbrauen hoch und trommelte mit einem silbernen Zigarrenanzünder auf dem Schreibtisch herum, während er auf seine Zigarre biss. Wie gewohnt trug er einen Nadelstreifenanzug; sein Walrossbart kräuselte sich über der Oberlippe.
„Was gibt es?“, wiederholte er.
Clara öffnete die Fäuste und faltete die Hände in Höhe ihrer Taille, damit sie nicht zitterten.
„Darf ich mit euch über etwas sprechen?“, fragte sie und hatte Mühe, ruhig zu bleiben.
Ihre Mutter murmelte etwas vor sich hin und ging vom Rascheln ihres Rockes begleitet zum Fenster hinüber. Sie zog den Vorhang zurück und tat, als würde sie hinausschauen.
Henry nahm die Zigarre aus dem Mund. „Falls es um morgen Abend geht“, stellte er fest, „ist das Gespräch hiermit beendet. Die Feier findet wie geplant statt.“
Clara schluckte. Wieder wurde ihr flau im Magen. „Natürlich!“, erwiderte sie. „Das soll sie auch. Du und Mutter, ihr habt schon seit Jahren keinen Hochzeitstag mehr gefeiert.“
Ihre Mutter wirbelte zu ihr herum. „Du weißt sehr genau, warum wir diese Feier veranstalten“, rief sie. „Das ist alles nur für dich! Und für James!“
Clara biss die Zähne zusammen und zwang ihre Lippen zu etwas, das wie ein Lächeln aussah, wie sie hoffte. „Ich weiß, Mutter“, antwortete sie. „Und ich weiß eure Mühen und Anstrengungen auch zu schätzen. Wirklich. Es ist nur …“
„Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie glücklich du dich schätzen musst, dass ein Mann wie James sich bereit erklärt, dich zu heiraten?“, fragte Ruth.
Bereit erklärt, dachte Clara. Weil ich so viele Defizite und Fehler habe, dass kein Mann, der bei vollem Verstand ist, mich je heiraten würde. Andererseits hast du vielleicht recht, Mutter. James ist nicht ganz bei Verstand. Er ist ein fieser, gemeiner, ausfallend werdender Schürzenjäger. Aber was interessiert es dich, solange er mich dir abnimmt? Und solange er mich von Bruno fernhält.
Mit brennenden Augen und Wangen trat Clara an den Schreibtisch ihres Vaters heran. „Aber Vater!“, sagte sie. „Ich bin noch nicht bereit zu heiraten! Und insbesondere nicht James!“
Henry erhob sich und drückte die Zigarre im Aschenbecher aus. Seine dicken Finger liefen rot an, je fester er drückte. „Das haben wir bereits geklärt. Deine Mutter und ich haben dir in aller Deutlichkeit mitgeteilt, wie wir in dieser Sache denken –“
„Und was ist damit, was ich darüber denke?“, rief Clara, der das Herz hämmerte, als würde es gleich zerspringen.
„Du bist noch zu jung, um zu wissen, was du willst“, erklärte ihr Vater.
„Nein.“ Clara sah ihm in die Augen. „Das bin ich nicht. Ich habe es euch bereits gesagt. Ich will aufs College gehen.“ Das war der einzige Vorwand, der ihr eingefallen war, um die Verlobung abzusagen. Zumindest für den Augenblick. Einst hatte sie zum College gewollt, um von ihren Eltern fortzukommen und den Beruf einer Sekretärin oder vielleicht einer Krankenschwester zu erlernen. Sie wollte in der Lage sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Doch jetzt hatten sich ihre Träume geändert. Zum ersten Mal in ihrem Leben wusste sie, wie es sich anfühlte, geliebt und geschätzt zu werden. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als ihr Leben mit Bruno zu teilen und mit ihm eine Familie zu gründen. „Lillian geht auch aufs College“, erklärte sie, obwohl sie wusste, dass dies nur ein schwaches Argument war.
„Mir ist völlig gleichgültig, was deine Freundinnen tun!“, polterte ihr Vater, während sich sein Gesicht rötete.
„Wir zahlen nicht unser gutes, schwer verdientes Geld, um unter dem Deckmäntelchen einer höheren Erziehung unsere Tochter fortzuschicken, damit diese dann in Wirklichkeit rauchen, trinken und hemmungslos mit Männern ins Bett hüpfen kann!“, rief ihre Mutter.
Clara verdrehte die Augen, während ihr ein ungläubiges Glucksen über die Lippen kam. Ihr war klar, dass ihre Mutter an eine Zeile des neuesten Liedes dachte, das im Umlauf war: „She doesn’t drink, she doesn’t pet, she hasn’t been to college yet.“ Es war klar, dass ihre Mutter so denken würde.
„Das ist nicht der Grund, warum Mädchen aufs College gehen, Mutter“, stellte Clara klar.
„Es geht um diesen Jungen, diesen Bruno, nicht wahr?“, fragte ihre Mutter. „Um diesen Einwanderer, den du vor ein paar Wochen zum Abendessen mitgebracht hast?“
Clara spürte, wie ihre Wangen ganz rot und heiß wurden. „Ich weiß nicht, Mutter“, entgegnete sie. „Ist das der wahre Grund? Willst du deswegen, dass ich James heirate? Um mich von Bruno fernzuhalten?“
Erinnerungen an jenen schrecklichen Abend, an dem sie Bruno eingeladen hatte, um ihn ihren Eltern vorzustellen, wurden wach und blitzten in ihrem Kopf auf wie Fotos in dem münzbetriebenen Automaten in der Spielhalle. Bruno in der Tür, lächelnd, das feste dunkle Haar aus seinem kantigen Gesicht mit Pomade zurückgekämmt, die Hände in den Taschen des geborgten Smokings vergraben. Clara dankte ihm dafür, hergekommen zu sein, und küsste ihn flüchtig auf die Wange, wobei sie den sauberen Duft seiner weichen Haut tief einatmete, eine angenehme Mischung aus Barbasol-Rasiercreme und Lifebuoy-Seife. Er war eine Viertelstunde zu früh, denn Clara hatte ihn gewarnt, dass Ruth Leute verachtete, die zu spät kamen.
Clara zog Brunos Hände aus den Taschen und rückte aufgeregt seine Krawatte zurecht. Sie bemühte sich, ruhig zu bleiben, damit er nicht nervös wurde, befahl ihm, tief Luft zu holen, und erinnerte ihn daran, ihrem Vater die Hand zu schütteln, bevor sie ihn dann durch die Eingangshalle führte, den Gang hinunter zum Salon. Beim Anblick der riesigen, teuren Kerzenleuchter und der gerahmten Gemälde war er sichtlich überrascht, dass Clara in einem solch verschwenderischen, prachtvoll eingerichteten Haus lebte. Sie hatte Bruno erzählt, dass ihr Vater in der Bankbranche tätig war, aus Angst, die Wahrheit könne ihn verschrecken. Henry Cartwright gehörte eine Hälfte der Swift Bank, eine der größten Banken in Manhattan, mit Filialen sowohl in allen New Yorker Stadtbezirken als auch in verschiedenen Gemeinden im Hinterland. Ihre Mutter, Ruth, war die einzige Erbin des Bekleidungsimperiums Bridge Bros.
Clara öffnete die elfenbeinfarbenen Türflügel, die in den Salon führten, und schob Bruno nach drinnen. Ihre Eltern nahmen vor dem Abendessen noch ihren Tee ein. Ruth saß neben dem Kamin, während ihr Vater mit einem Arm am marmornen Kaminsims lehnte. Henry sah auf, als Bruno und Clara hereinkamen, knurrte etwas und warf dann einen Blick auf seine Taschenuhr. Zunächst erhob Ruth sich mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Dann jedoch, als sie Brunos schlecht sitzende Smokingjacke und die abgewetzten Schuhe sah, setzte sie sich abrupt wieder hin.
Clara malmte mit dem Kiefer und führte Bruno zu ihrem Vater in der Hoffnung, dass er sich beeindruckt zeigen würde von Brunos Geschichte, wie er allein nach Amerika gekommen war, um sich dort im Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten eine neue Existenz aufzubauen. Denn immerhin hatte Henrys Vater 1871 das Gleiche getan und war mit seiner frisch angetrauten Ehefrau von England nach Amerika gekommen. Doch anstatt Brunos ausgestreckte Hand zu ergreifen, warf Claras Vater nur wieder einen Blick auf seine Taschenuhr und erklärte, dass es nun Zeit fürs Abendessen sei. Ruth erhob sich und hielt ihre zarten Finger in die Luft, als wolle sie Bruno erlauben, ihre Hand zu berühren. Bruno schüttelte ihre Hand und nickte.
„Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Mrs Cartwright“, begrüßte er sie.
Ruth bedachte ihn mit einem spröden Lächeln, hakte sich bei ihrem Mann ein und schlenderte ins Esszimmer. Clara tätschelte Brunos Arm und folgte ihnen. Sie nickte mit dem Kopf in deren Richtung und verdrehte die Augen. Bruno schaute sie finster an; zweifelnd runzelte er die Stirn. Dann holte er tief Luft und atmete ganz langsam aus. „Ich liebe dich“, flüsterte Clara ihm zu und küsste ihn auf die Wange. Endlich lächelte er. Wortlos nahmen sie ihre Plätze am Tisch ein, ihre Eltern jeweils am Kopfende, sie und Bruno einander gegenüber. Um Bruno sehen zu können, musste sie jedoch an einer der lächerlich großen Blumenvasen vorbeischauen. Ihre Mutter bestand darauf, diese überall im Haus zur Schau zu stellen.
Clara fragte sich immerzu, ob die riesige Vase auf dem Esstisch vielleicht dort stand, damit Ruth Henry während des Essens nicht anschauen musste, da sie zweifellos genervt davon war, wie er seine Suppe schlürfte oder zu hastig kaute. Henry aß mit Begeisterung und Heißhunger, schaufelte sich stets schon wieder Essen in den Mund, bevor er den vorherigen Bissen fertig gekaut hatte, redete mit vollem Mund und nahm sich bereits die letzte Portion Fisch oder Hühnchen, wenn die anderen kaum mit dem Essen angefangen hatten. Henry war immer der Erste, der mit dem Essen fertig war, und Ruth war das ein unglaublicher Dorn im Auge. Clara empfand die schlechten Manieren ihres Vaters als typisch dafür, wie er lebte: Er nahm sich, was er wollte, ohne Rücksicht auf die Menschen um ihn herum. Er pflügte alles unter, als habe er jedes Recht dazu. Schließlich stand Clara auf, hob die Blumenvase vom Tisch, trug sie quer durch das Zimmer und stellte sie auf der Anrichte wieder ab. Ruth schaute wortlos zu, den Mund vor Entsetzen weit offen.
Als das Dienstmädchen ihnen mit der Kelle Suppe in die Suppenteller löffelte, hielt Ruth den Blick starr auf den Teller vor sich gerichtet. Henry starrte Bruno und Clara an und legte die Stirn in tiefe Falten, während er die Situation abschätzte. Clara rutschte auf ihrem Stuhl herum und wartete darauf, dass er ein Gespräch begann. Sie sah zu ihrem Vater hinüber. Als sich ihre Blicke trafen, schaute er weg, plötzlich unglaublich interessiert daran, seine Serviette auf den Schoß zu legen. Normalerweise musste Ruth ihn immer daran erinnern, sie überhaupt zu benutzen.
Clara klammerte sich an den Saum der Tischdecke und straffte die Schultern. „Vater“, sagte sie und versuchte, fröhlich zu klingen. „Bruno arbeitet erst seit sechs Monaten unten im Hafen und ist schon zum Vorarbeiter befördert worden.“
Henry grunzte, nahm sich den Löffel und aß seine Suppe.
„Vielen Dank, dass Sie mich in Ihr Haus eingeladen haben“, bedankte sich Bruno. „Es ist sehr freundlich von Ihnen, den Freunden Ihrer Tochter die Tür zu öffnen.“
Clara sah zu ihrer Mutter hinüber und wartete auf eine Antwort. Als Kind hatte Ruth ihr immer wieder erklärt, dass sie Menschen in erster Linie nach ihren Umgangsformen beurteilte. Ruth pflegte stets zu sagen, dass man viel über die Erziehung der Leute erfahre anhand dessen, wie sie „bitte“ und „danke“ sagten. Aber offenbar spielte gutes Benehmen nur dann eine Rolle, wenn es Ruths Absichten entsprach. Am anderen Ende des Tisches tauchte Ruth ihren Löffel in die Suppe, den Blick starr auf den Teller gerichtet, als erfordere die Nahrungsaufnahme ihre gesamte Aufmerksamkeit. Clara merkte, wie sich ihre Wangen röteten. Normalerweise redete Ruth ohne Unterbrechung, wenn sie Gäste zum Abendessen hatten, diskutierte über Kunstwerke, das Theater sowie die allerneusten elektrischen Haushaltsgeräte und stellte so viele Fragen, dass es fast schon an Neugier grenzte. Selbst nach Williams Tod hatte sie für Gäste beim Abendessen ihr bestes Benehmen gezeigt. Schließlich wurde das erwartet.
„Mutter?“, fragte Clara. „Du hast doch immer betont, wie unhöflich es ist, Gesellschaft zu ignorieren.“
„Oh“, erwiderte Ruth. „Entschuldige bitte.“ Sie legte den Löffel beiseite, wischte sich mit der Serviette über den Mund und rutschte auf ihrem Stuhl herum. „Mir war nicht klar, dass dein Gast mit mir geredet hat.“ Sie musterte Bruno mit hochgezogenen Augenbrauen. „Was haben Sie gesagt, junger Mann?“
„Ich wollte Ihnen für die Einladung in Ihr wunderschönes Haus danken“, erklärte Bruno.
„Gern geschehen“, antwortete Ruth. Dann nahm sie, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wieder den Löffel in die Hand und aß weiter, während ihre tropfenförmigen Ohrringe neben ihrem blassen Hals baumelten.
Die Adern in Claras Hals pulsierten so stark, als würden sie gleich platzen. So sah es also aus. Sie warfen einen Blick auf Bruno und fällten sogleich ein Urteil über ihn. Lag es an seiner Kleidung, seinem Job, seinem Akzent oder seiner sonnengebräunten Haut? In ihrem Schoß ballte sie die Hände so sehr zu Fäusten, dass sich ihr die Fingernägel in die Handfläche bohrten.
Clara hatte Bruno erklärt, dass ihr Vater sicherlich davon beeindruckt wäre, wie schnell er die Karriereleiter hinaufgeklettert war, auch wenn es nur im hiesigen Seehafen war. Sie hatte angenommen, dass ihr Vater überrascht wäre, dass Bruno bereits genug Geld beisammenhatte, um eine kleine Wohnung zu mieten. Er sparte auch auf Kapitalanlagen und hoffte, sich in den Aktienmarkt einkaufen zu können. Clara hatte ihm erzählt, dass Henry ihn sicherlich gern beraten, ihm Tipps geben und vielleicht sogar den Namen eines vertrauenswürdigen Investors nennen würde, um ihn in die richtige Richtung zu lenken. Jetzt schalt sie sich selbst dafür, so dumm und naiv gewesen zu sein. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht, Bruno hierher mitzubringen?
Ihre Gedanken rasten auf der Suche nach einem Ausweg, um dieses desaströse Abendessen so schnell wie möglich zu beenden. Sie tat, als würde sie mit Appetit ihre Suppe essen, obwohl sie in Wahrheit keinerlei Hunger verspürte. Clara fragte sich, was Bruno wohl gerade dachte. Konnte er ihr ansehen, wie verzweifelt und außer sich sie war? Wusste er, dass sie, wenn sie auch nur geahnt hätte, wie ihre Eltern nun reagierten, ihn niemals gebeten hätte herzukommen? Oder dachte er etwa, dass dies hier ein abgekartetes Spiel war? Sie spürte, wie Brust und Nacken immer heißer und heißer wurden und ihre Wangen regelrecht brannten. Da ergriff plötzlich ihr Vater das Wort.
„Ich versuche gerade, etwas zu verstehen“, erklärte er und sah Bruno zum ersten Mal direkt in die Augen. Er hielt inne, stützte einen Arm mit dem Ellbogen auf den Tisch und zeigte mit dem Finger auf Bruno. „Wie lautet überhaupt Ihr Nachname?“
„Moretti, Sir“, antwortete Bruno. „Bruno Moretti. Ich wurde nach meinem verstorbenen Vater benannt.“
„Hmmm“, machte Henry und hob das Kinn. „Und was hat Ihr Vater in Italien beruflich gemacht?“
„Er war Schuhmacher. Ein sehr guter, Sir.“
„Ich verstehe“, erwiderte Henry. „Ihr Vater war also Schuhmacher, und Sie arbeiten im Hafen? Unten im South Street Seehafen?“
„Ja, Sir“, nickte Bruno. Der Hauch eines Lächelns umspielte seine Lippen.
Clara spürte, wie ihr Herz einen winzigen Satz machte. Sie atmete ein, holte zum ersten Mal seit Brunos Auftauchen vor ihrer Haustür tief Luft. Ihr Vater unterhielt sich mit Bruno. Das war der erste Schritt.
„Und wie viel verdienen Sie mit der Arbeit unten im Hafen?“, erkundigte Henry sich.
„Vater!“, rief Clara. „Du hast selbst immer gesagt, wie unhöflich es ist, andere Leute nach ihren persönlichen Finanzen zu fragen!“
Henry sah zu Clara hinüber und runzelte die Stirn. „Ich gehe davon aus, dass Bruno hier ist, weil er daran interessiert ist, meiner Tochter den Hof zu machen“, entgegnete er. „In diesem Fall habe ich jedes Recht der Welt, ihn zu fragen, wonach mir der Sinn steht.“
„Schon gut“, beschwichtigte Bruno Clara. Dann lächelte er und richtete seine Aufmerksamkeit auf Henry. „Ich verdiene genug, um mir eine eigene Wohnung zu leisten, Mr Cartwright. Und ich bin bereits zum Vorarbeiter befördert worden.“
„Und wo befindet sich diese Wohnung?“, wollte Henry wissen.
„In der Mulberry Street“, erwiderte Bruno.
„In Little Italy?“
„Ja, Sir“, nickte Bruno.
Henry murmelte etwas und fuhr sich dann mit der Hand über den Bart. „Meine Tochter ist an feine, edle Dinge gewöhnt“, erklärte er. „Glauben Sie wirklich, Sie können mit dem Gehalt eines Hafenarbeiters anständig für sie sorgen?“
„Vielleicht noch nicht, Sir“, antwortete Bruno, „aber ich arbeite hart und werde es zu etwas bringen.“
„Zu was denn? Streben Sie an, ein Schuhmacher wie Ihr Vater zu werden? Meine Tochter kann nicht für immer von meinen Almosen leben, wissen Sie? Ich hoffe nicht, dass Sie sich darauf verlassen haben.“
Clara starrte Bruno an. Ihr Herz zersprang, als hätte jemand mit einem Hammer darauf eingeschlagen. Bruno machte ein langes Gesicht und starrte auf den Tisch, seine Schläfen pulsierten. Doch er hatte den Blick nur kurz gesenkt. Ohne zu zögern hob er das Kinn und sah Claras Vater direkt an.
„Bei allem Respekt, Sir, aber Ihre Tochter hat mir erzählt, dass Sie Schuhe verkauft haben, bevor Sie in das Bankgeschäft eingestiegen sind. Wahrscheinlich genau die Schuhe, für die mein Vater Berühmtheit erlangt hat. Moretti Salvatore?“
Zu Claras großer Überraschung wurde ihr Vater blass. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und räusperte sich. „Nie gehört.“
„Kann es sein, dass man dort, wo Sie gearbeitet haben, nur die Schuhe vom unteren Ende der Preisskala verkauft hat, Sir?“, hakte Bruno nach. „Die Schuhe meines Vaters werden nur in teuren Fachgeschäften verkauft.“
Clara biss sich auf die Lippe und versuchte, ihr Gelächter zu unterdrücken. Sie hatte noch nie jemanden erlebt, der ihren Vater derart in Verlegenheit gebracht hatte. Doch ihre Belustigung war nur von kurzer Dauer. Sie hätte wissen müssen, dass niemand Henry Cartwright beschämen konnte, ohne unverzüglich dafür die Quittung zu erhalten.
„Wenn Ihr Vater ein so bekannter Schuhmacher war, was machen Sie dann hier in Amerika, und warum arbeiten Sie im Hafen, um sich Ihr täglich Brot zu verdienen?“
Bruno presste die Lippen aufeinander. Seine Wangen färbten sich rot. Dann räusperte er sich. „Mein Vater ist im letzten Jahr gestorben. Ein Onkel von mir und mein älterer Bruder haben das Unternehmen übernommen. Leider ist an der Redensart viel Wahres, dass man Berufliches und Privates nicht vermischen sollte. Mein Bruder und ich haben uns nicht gut verstanden. Um den Frieden zu wahren, bin ich gegangen. Außerdem war es immer mein Traum, in Amerika zu leben. Ich kam her, um mich zu beweisen. Ich weiß, dass ich es allein schaffen kann, weil ich stark und zielstrebig bin, genau wie mein Vater.“
Henry lehnte sich wieder auf seinem Stuhl zurück, die Arme vor seiner breiten Brust verschränkt. „Nun dann“, fuhr er fort, „sollten Sie sich das selbst erst beweisen, bevor Sie herkommen und versuchen, es mir zu beweisen. Denn bislang bin ich davon nicht beeindruckt.“
Clara ließ ihren Löffel in den Suppenteller fallen, sodass das schwere Silberbesteck auf das mit Gold umrandete Porzellan klirrte. Sie schob ihren Stuhl zurück und stand auf. „Es tut mir leid, Bruno“, entschuldigte sie sich. „Verzeih mir bitte, dass ich dir das hier angetan habe. Ich hatte keine Ahnung, dass meine Eltern derart engstirnig sind. Hätte ich es gewusst, hätte ich niemals versucht, dich ihnen vorzustellen. Wir hätten einfach in deiner Wohnung zu Abend essen sollen, wie wir es für gewöhnlich jeden Freitagabend tun.“
Ruth keuchte. Alle Farbe war ihren Wangen entwichen. Sie presste sich die Hand an den Hals und öffnete und schloss den Mund immer wieder wie ein sterbender Fisch.
„Schon gut“, entgegnete Bruno. „Ich verstehe das. Dein Vater hat Sorge …“
„Nein“, unterbrach Clara ihn. „Glaub mir, es ist zu spät für jegliche Art von Verständnis. Bitte, lass uns einfach gehen.“
Nachdem Bruno aufgestanden war, umrundete Clara den Tisch und nahm seine Hand. Ohne sich noch einmal umzudrehen, führte sie ihn aus dem Esszimmer. Hinter ihnen tobte und fluchte Henry und schrie sie an, unverzüglich zurückzukommen. Clara ignorierte ihn.
Dies war vor fast einem Monat geschehen. Drei Tage später hatten ihre Eltern sie über die arrangierte Hochzeit mit James in Kenntnis gesetzt. Seitdem hatte sie das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Sie wusste nicht einmal, ob Bruno vielleicht gekommen war, um nach ihr zu sehen, da sie weder zur Tür noch ans Telefon hatte gehen dürfen. Und sogar die Hausangestellte war angewiesen worden, nichts darüber zu sagen, wer zu Besuch gekommen war. Jetzt, im Arbeitszimmer, starrte ihre Mutter sie an.
„Bitte bring mir den sich geziemenden Respekt entgegen“, forderte Ruth. „Du weißt, dass ich für dich immer nur das Beste gewollt habe. Ich wünsche, dass du James heiratest, weil er ein guter Ehemann ist.“
„Aber das ist er nicht! Er ist –“
„Er wird sich um dich kümmern und dafür sorgen, dass du Nahrung und Kleidung bekommst und in einem schönen Haus wohnst“, erwiderte Ruth. „Er wird dir das Leben ermöglichen, das du gewohnt bist.“
„Ob du es glaubst oder nicht, Mutter“, widersprach Clara und konnte ihre Abneigung nicht mehr länger verbergen, „nicht jeder heiratet um des Geldes willen. Manche Leute heiraten aus Liebe.“
„Sprich nicht so mit deiner Mutter!“, brüllte Henry, und seine Wangen bebten.
Doch es war zu spät. Irgendetwas hatte sich in Claras Kopf gelöst. Nachdem sie nun einmal angefangen hatte, deutlich ihre Meinung zu sagen, konnte sie damit nicht mehr aufhören. Es war, als würden sich Jahre des Frusts und der aufgestauten Wut auf einmal entladen. „Das ist alles, was dich interessiert, oder?“, warf sie Ruth an den Kopf. „Du legst mehr Wert auf Schmuck und ein schönes Haus als darauf, deine Familie glücklich beisammenzuhaben.“
„Das stimmt nicht!“, rief Ruth mit einem verletzten Blick. „Wie kannst du bloß so gemein und verletzend sein, nach allem, was ich durchgemacht habe? Dein Bruder hätte niemals so mit mir geredet! Kein Wunder, dass er fortgegangen ist. Er hatte wahrscheinlich Angst, das Geschäft zusammen mit dir führen zu müssen.“
„Er ist nicht wegen mir fortgegangen!“, rief Clara. „Er ist fortgegangen, weil Vater ihn gefeuert hat und du dich nicht hinter ihn gestellt hast! Es tut mir leid, aber manchmal denke ich wirklich, du würdest noch über deinen toten Sohn hinwegsteigen, um einen Dollar von der Straße aufzuheben.“
Henry stürmte um den Schreibtisch herum, die Hände zu Fäusten geballt. „Du entschuldigst dich sofort, Fräulein!“, brüllte er mit zitternden Lippen. „Du heiratest James im September, Schluss, aus!“
Clara spürte, wie sich in ihrem Kopf etwas bewegte, massiv und endgültig, als würde sich eine schwere Tür schließen. Jahrelang hatte sie untätig zugeschaut und zugelassen, dass ihre Eltern über ihr Leben bestimmten, angefangen von der Kleidung, die sie zu tragen hatte, bis hin zu den Fächern, die sie in der Schule wählen sollte. Ihre Mutter wies das Hausmädchen an, wöchentlich Claras Zimmer zu durchsuchen, um sicherzugehen, dass sie darin nicht Zigaretten und Alkohol versteckte. Henry hatte „unangemessene“ Bücher aus der Bücherei verschwinden lassen und Clara nicht erlaubt, Klavierunterricht zu nehmen, da es sich nicht geziemte. Er befahl ihr, wie sie ihr Taschengeld auszugeben hatte, und gab Kleider zurück, die ihm nicht gefielen. Clara war sich nicht sicher, ob dies vielleicht eine Art Mutterinstinkt war, der schon wirkte, doch sie konnte das Ganze nicht mehr länger ertragen.
„Warum?“, schrie sie. „Warum wollt ihr mich mit aller Gewalt unter die Haube bringen? Liegt es daran, dass James’ Familie so reich ist und ihr mich nicht mehr länger unterstützen wollt? Oder willst du deine Geschäfte absichern, indem du dafür sorgst, dass James’ Vater für immer dein Geschäftspartner bleibt?“
Henry packte sie an der Schulter und schüttelte sie, wobei sich seine dicken Finger in ihr Fleisch gruben. „So redest du nicht mit mir!“, warnte er. In seinen Augen loderte die Wut. Clara wusste, dass er Mühe hatte, sich zu beherrschen, sie nicht durch das ganze Zimmer zu schleudern.
Clara starrte ihre Mutter böse an. „Wie kannst du einfach nur so dastehen und zulassen, dass er mir das antut?“, rief sie. „Wie kannst du deinen Ehemann deinen Kindern vorziehen? Ich weiß, dass er das William angetan hat! Ich weiß, dass er seinen eigenen Sohn verprügelt hat. Und du hast nichts dagegen unternommen!“
„Wage es ja nicht, William hier ins Spiel zu bringen!“, drohte ihre Mutter.
„Warum nicht?“, fragte Clara. „Du hast zugelassen, dass Vater ihn ruiniert hat, warum also nicht auch mich?“
Ruth presste ihr dürres Handgelenk an die Stirn und ließ sich auf das Sofa fallen. Henry ließ von Clara ab und eilte zu Ruth, wo er sich neben ihr auf die Knie fallen ließ.
„Jetzt sieh bloß, was du angestellt hast!“, rief er und warf Clara einen stechenden Blick zu. „Du hast deine Mutter zum Weinen gebracht!“
Clara starrte ihre Eltern an. Eine entsetzliche Wut schwoll in ihrer Brust an. „William hat doch alles für euch getan! Jahrelang hat er Tag und Nacht für euch geschuftet. Er hat alles aufgegeben, nur um sich zu beweisen. Aber es war nie genug, nicht wahr? Du hättest ihm niemals Anerkennung zuteilwerden lassen, weil das bedeutet hätte, ihm einmal das zu geben, was er verdient hätte!“
Und damit stand ihr Vater auf, eilte durch sein Arbeitszimmer und gab Clara eine schallende Ohrfeige. Sie taumelte zur Seite, fand Halt, hielt sich mit einer Hand die pochende Wange und blinzelte unter Tränen.
„Was hat er denn getan?“, fauchte sie und erwiderte den stierenden Blick ihres Vaters. „Was hat er so Schreckliches getan, das dich dazu gebracht hat, ihn nicht mehr zu lieben?“
„Ich warne dich!“, drohte Henry. „Noch ein Wort, und ich –“
„Ach, stimmt ja“, fuhr Clara fort, während ihr heiße Tränen über die Wangen liefen. „Du hast gedacht, er gehört dir, weil er für dich gearbeitet hat. Du hast ihn wie einen Sklaven behandelt, während du das ganze Geld eingestrichen hast. Irgendwann hatte er genug und hat sich für sich selbst starkgemacht. Aber damit konntest du nicht umgehen, weshalb du ihn auf die Straße gesetzt hast!“ Jetzt starrte Clara ihre Mutter an. „Und du hast ihn machen lassen! Du hast nicht ein einziges Mal nach Williams Sicht der Dinge gefragt. Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, herauszufinden, ob er ein Dach über dem Kopf oder etwas zu essen hatte!“
„Schweig, auf der Stelle!“, brüllte Henry. „Bevor du es nachher bereust!“
„Ich bereue nichts“, entgegnete Clara. „Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht früher begriffen habe, wie ihr in Wirklichkeit seid.“
Henry eilte um seinen Schreibtisch herum, nahm den Telefonhörer in die Hand und wählte. Mit puterrotem Gesicht und mahlendem Kiefer starrte er seine schluchzende Frau an, während er darauf wartete, dass am anderen Ende abgehoben wurde. Das Licht des Kronleuchters spiegelte sich im Schweiß auf seiner Stirn. Clara drehte sich um. Wenn sie nun ginge, wäre sie vollkommen mittellos. Wenn sie bliebe, wäre sie gefangen. Es gab keine andere Möglichkeit. Sie griff nach der Türklinke.
„Ja, Lieutenant?“, sprach ihr Vater in den Hörer. „Hier ist Henry Cartwright. Bitte schicken Sie unverzüglich jemanden her. Wir haben hier leider einen Vorfall.“ Clara hielt an der Tür inne, um zu hören, was ihr Vater als Nächstes sagen würde. „Es handelt sich um meine Tochter, Clara. Wir vermuten, sie hat einen psychotischen Schub.“
Clara riss die Tür auf und lief aus dem Arbeitszimmer.
Ich habe mich schon immer dafür interessiert, was früher in Psychiatrischen Anstalten vor sich ging, wie die Menschen dort behandelt wurden, und wie die Behandlungsmethoden sich über die Jahre geändert haben. Und ich habe mich gefragt, wie es sich anfühlt, dort gegen den eigenen Willen eingeliefert zu werden.
So wurde ich auf ein Buch über die Koffer ehemaliger Patienten von Willard State Hospital aufmerksam. Anhand der privaten Gegenstände in den Koffern konnte man sich ein Bild davon machen, was diese Patienten für Menschen waren, die mit ihren Koffern anreisten ohne zu wissen, dass sie das Gebäude nie wieder verlassen würden.
Nachdem ich das gelesen hatte, wusste ich, dass ich darüber schreiben wollte, wie die Koffer gefunden wurden und wie sich ein Patient damals gefühlt haben muss.
„Alles, was sie hinter sich ließ“ erzählt die Geschichte einer jungen Museumsmitarbeiterin, die in der berühmt berüchtigten Psychiatrischen Anstalt von Willard das alte Tagebuch einer Patientin findet und Nachforschungen über deren Leben anstellt – mit schockierenden, aber auch überraschenden Ergebnissen … Ich hoffe sehr, dass Ihnen der Roman gefällt! Ellen Marie Wiseman
„Dieser Roman hat mich die ganze Gefühlspalette hoch- und runtergejagt, von Freude über Angst, Fassungslosigkeit zu Wut und Trauer, aber auch Hoffnung. (...) Wiseman erzählt so lebhaft, dass man sich irgendwann selbst im Damals gefangen fühlt.“
„Sehr spannender und menschlich anrührender Roman, dem auch ein ernüchternder Blick in die psychiatrische ›Medizin‹ gelingt.“
„eine spannende und teilweise auch beklemmende Geschichte“
„berührender Roman“
„Kaum zu glauben, dass dieser Roman auf wahren Begebenheiten beruht.“
„Authentizität, Tiefe, und ein einzigartiges Verständnis der menschlichen Psyche machen dieses Buch zu einem packenden Lesegenuss.“


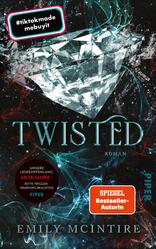
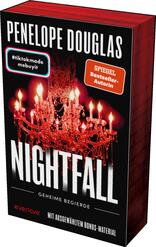










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.