
Als die Tage ihr Licht verloren - eBook-Ausgabe
Roman
„Ein gelungenes Debüt, unbedingt lesenswert.“ - Ruhr Nachrichten
Als die Tage ihr Licht verloren — Inhalt
Berlin, 30er-Jahre: In der Stadt brodelt das Leben, aber am Horizont drohen dunkle Wolken
Die fiktive Geschichte zweier Schwestern in Berlin und die wahre Geschichte eines verhängnisvollen Transports aus dem Jahr 1940 – eine faszinierender Roman um Liebe, Neid, Verrat und Ideologie.
Linda und Gitte, Töchter einer liberalen, gut bürgerlichen Berliner Familie, genießen ihre Jugend. Gitte, die als Sekretärin im Reichsinnenministerium arbeitet, hofft, einst als Juristin Karriere zu machen, Linda, die ungestüme Träumerin, schlägt den künstlerischen Weg ein und heiratet den sensiblen Erich, die Liebe ihres Lebens.
Als seine Nachrichten von der Front ausbleiben und sein Schicksal ungewiss ist, fällt sie in tiefe Melancholie – gefährlich in einer Zeit, in der psychische Krankheiten zum Todesurteil werden können. Denn die Nationalsozialisten planen bereits, was sie verharmlosend „Euthanasie“, den guten Tod, nennen …
„Eine hoffnungsvolle Geschichte aus Deutschlands dunkelster Periode. Absolut lesenswert.“ ― Mainhattan Kurier
Große Gefühle und dramatische Ereignisse vor dem Hintergrund des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte – packend erzählt und exzellent recherchiert.
Leseprobe zu „Als die Tage ihr Licht verloren“
TEIL I
Schmetterlinge
1932 –1938
Nichts für ein einzelnes Leben wirklich Veränderndes geschieht ohne die Zuneigung zweier Menschen zueinander. Nichts beginnt ohne Liebe. Wir neigen dazu, diesen Umstand zu vergessen, doch nur das unumstößliche Vertrauen, das ein Mensch dem anderen entgegenbringt, kann dem nahekommen, was wir unser Wesen heißen, und liegt nicht in dessen Entfaltung der Sinn unseres ganzen Daseins? Was aber passiert mit uns, wenn die große Liebe geht, wenn Schweigen und Stille an die Stelle von Gespräch und körperlicher Vereinigung treten? [...]
TEIL I
Schmetterlinge
1932 –1938
Nichts für ein einzelnes Leben wirklich Veränderndes geschieht ohne die Zuneigung zweier Menschen zueinander. Nichts beginnt ohne Liebe. Wir neigen dazu, diesen Umstand zu vergessen, doch nur das unumstößliche Vertrauen, das ein Mensch dem anderen entgegenbringt, kann dem nahekommen, was wir unser Wesen heißen, und liegt nicht in dessen Entfaltung der Sinn unseres ganzen Daseins? Was aber passiert mit uns, wenn die große Liebe geht, wenn Schweigen und Stille an die Stelle von Gespräch und körperlicher Vereinigung treten? Mit wem sollen wir fortan sprechen, wir Wesen der Sprache?
Edith Sundström
1
„Weil ich noch nicht den Richtigen gefunden habe!“, rief Linda. „Du dumme Nuss, glaubst du, ich lass mich in eine Ehe einsperren? Lene, hör doch mal: E-H-E. W-E-H-E. Reimt sich sogar. Und jetzt hör mal: L-i-e-b-e. Das eine kurz, das andere lang. Dreimal darfst du raten, was schneller vorüber ist.“
Linda lächelte Lene, ihre Freundin aus Kindertagen, mit hochgezogenen Augenbrauen und fliegenden Haaren an. Sie erntete einen verängstigten Blick. Zu Hause, bei Arnold, würde Lene Linda als „implusiv“ bezeichnen, „implusiv und unbeherrscht“. Ein feiner Schneestaub bedeckte Lindas Pelzkragen. Ihre Schuhe auszuziehen und ihren Mantel abzulegen hatte sie sich keine Mühe gemacht. Was tat Lene schon wieder hier?
„Schau dich an. Arnold hier, Arnold da, dein Arnold ist für jeden da, was? Dein ewiges Gerede. Meinst du, alle müssen sein wie du, so lieb und brav und nett und immer alles richtig machen und dem Mann Mantel und Hut abnehmen, wenn er nach Hause kommt?“
„Ich lieb meinen Mann eben.“
„Das nennst du Liebe? Dieses Hinterhergetrage? Hast du mal überlegt, wo du bleibst, Lene Gruber? Genau, wo bleibst du?“ Linda tippte sich mit ihrem Zeigefinger an die Schläfe.
„Ich mach das doch gern“, erwiderte Lene. „Ich hab eben nie eine Familie gehabt so wie ihr.“
„Deswegen musstest du doch nicht gleich heiraten“, sagte Gitte nüchtern und warf einen Seitenblick auf ihre Schwester, während ihre Finger langsam durch ihre bauchlange Perlenkette glitten. Der Stoff ihres hellgrauen Kleides, maßgeschneidert, ließ ihre weiße Haut durchschimmern, und die zu einem Knoten im Nacken gelegten dunklen Haare unterstrichen einen schmalen langen Hals.
„Und Kinder kriegen“, ergänzte Linda.
Lene riss die Augen auf, auf ihren Wangen schimmerten zartrosa Flecken, ihr Blick senkte sich in die Fransen des dicken Perserteppichs, hob sich wieder, fiel auf die schmale silberne Vase, die auf dem Wohnzimmertisch stand und die sich, sobald es Frühling wurde, mit Narzissen oder Tulpen füllte. „Dekorativ“, das Wort hatte Lene bei den Hoffmanns gelernt. Lene wirkte, als wolle sie gehen, unentschlossen sah sie sich um, vor ihr standen die Schwestern wie eine uneinnehmbare Festung. Auch wenn sie sich äußerlich unterschieden, machten ihre neugierigen hellblauen Augen und ihr gleichermaßen klirrend fröhliches Lachen sie unverkennbar zu Schwestern, und manch einer hielt sie für Zwillinge.
„Bist du Arnolds Bedienstete, oder was?“
„Ich … ich … Arnoldchen verdient doch das Geld, ich kümmere mich darum, ein Heim zu schaffen. Das ist doch viel schöner, als stumpfsinnig in der Fabrik zu schuften. Jetzt hab ich’s doch viel schöner!“
„Weißt du was, Lene, schmier weiter deine blöden Butterbrote, aber lass Gitte und mich außen vor, wir wollen nämlich unser Hirn benutzen, die Wahrheit suchen und sie vor allem auch leben. Fürs Heimchensein ist das Leben zu kurz. Lene, stell dir mal vor, wir benutzen nur einen Bruchteil unseres Gehirns, jetzt willst du auch noch dieses bisschen auf die Wickelkommode legen und Betten machen und waschen und dämlich lächeln, als wäre alles gut, alles gut, alles gut. Mensch, Lene, was ist denn daran so toll?“
Wie ein Lasso schwang Linda ihren Muff, den linken Arm in die Hüfte gestemmt. Lene zuckte zusammen wie ein verschrecktes Huhn vor dieser Angriffslust, vor diesem Übermut, der auf ein Kontern wartete, das nicht kam. Nicht jetzt, noch nicht. In dem Augenblick, als Linda wieder das Wort ergreifen wollte, betrat Mutter Margarete das Wohnzimmer. Das Gespräch der Mädchen hatte sie, da die Tür zur Bibliothek nur angelehnt war, mitgehört. Es war ihr nicht möglich gewesen, sich auf den Brief, den sie schreiben wollte, zu konzentrieren.
„Linda, sei nicht gehässig. Lass Lene ihr Leben, du hast deins.“
Das Wohnzimmer in der dritten Etage des bürgerlichen Wohnhauses lag im Dämmerlicht. Zwischen den beiden gegenüberliegenden, mit hellgrünem Samt überzogenen Kanapees standen Gitte und Lene. Linda lehnte am Türrahmen zwischen Salon und Flur. Ihr Muff aus Kaninchenfell baumelte etwas langsamer zwischen ihren Händen, sie knöpfte ihren Mantel auf und riss ihre Baskenmütze vom Kopf, unter der sich ihre hellen, kinnlangen Haare wellten. Die winterliche Kälte mischte sich mit der warmen Luft des Wohnzimmers.
In letzter Zeit kam Lene täglich, wie früher, wenn Gertrud, ihre Mutter, sie zu sehr quälte. Meistens saß Lene mit Margarete am Küchentisch bei einer Tasse Tee und redete. Das übliche Zeugs. Linda nannte es „Lenes Wehklagen“ und verdrehte die Augen. Seit sie denken konnten, kannten die Mädchen Lene und ihre Mutter. Sie wohnten im selben Viertel, Lene war auf dieselbe Volksschule wie Brigitte und Linda gegangen. Drei Jahre älter war sie als Linda, vier Jahre älter als Brigitte. Durch dieses Mehr an Jahren fühlte sich Lene offenbar berechtigt, mit Margarete von Gleich zu Gleich zu sprechen, erst recht seitdem sie mit ihrem Arnold vor zwei Jahren in eine Wohnung schräg gegenüber gezogen war. Wann Linda und Gitte endlich heiraten würden, fragte sie gerne bei jeder Gelegenheit, nur um noch einmal zu betonen, wie sehr sie Arnold den Rücken freihielt. Arnold war dabei, sich einen Namen zu machen, voranzukommen, comme il faut. Comme il faut war einer von Lenes Lieblingsausdrücken, den sie sich aus den Romanheftchen abgeschaut hatte, die sie jeden Freitag am Kiosk kaufte. Die Hoffmann-Mädchen, so hießen sie überall, belächelten Lenes Wunsch, vornehm sein zu wollen. Besonders sonntags bei ihrem Kirchgang trug Lene ihre dunkelblauen Kleider mit gestärktem weißen Kragen wie sichere Werte vor sich her. Zu Hause ersetzte sie die Kleider durch Kittel, das war praktischer für den Haushalt und wegen der zwei Kinder, und dann ahnte man: Lene kam ganz woandersher, als sie hinwollte. In welcher Abteilung ihr Mann im Reichsministerium des Inneren arbeitete, war keinem wirklich klar. „Sobald ein Posten frei wird in der Führung, das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, wird Arnold eine Stufe nach oben klettern“, sagte Lene und hob lächelnd ihren Kopf. Fragte man allerdings Vater Leonhard, brummte dieser: „In der Postabteilung ist er und wartet, bis die NSDAP an der Macht ist. Abteilungsleiter ist er jedenfalls nicht.“
Morgens sahen die Hoffmanns Arnold, wenn sie am Frühstückstisch saßen, wie er stets zur selben Uhrzeit das Haus verließ, den Völkischen Beobachter unter den Arm geklemmt und mit schnellen Schritten, als würde er das Leben selbst überholen wollen; eine kräftige Gestalt mit breitem Gesicht, das zwischen ebenso breiten Schultern saß und ihn gedrungen erscheinen ließ, den Mund im Halbmond Richtung Hals gekrümmt. Auf dem Kopf saß ein hellbrauner Hut, und sein Blick sagte nichts anderes als „vorwärts“. Seitdem Arnold in die NSDAP eingetreten war, als einer der Ersten, wie er gerne betonte, konnte ihn nichts mehr bremsen, den Auftrag auszuführen, den er in sich spürte.
Lene sah aus, als ob sie losheulen wolle.
Heute war Freitag! Wie konnte sie nur an einem Freitagabend hineinschneien. Mit dem Mantel war es heiß. Linda mochte ihn jedoch nicht ablegen, sonst würde Lene womöglich nie gehen. Gitte suchte nach beruhigenden Worten. Das hatte sie sich von ihrer Mutter abgeschaut. Das jedoch würde nur wieder dazu führen, dass Lene am nächsten Tag erneut bei ihnen klingelte. In Linda rief es nach einem anderen Dreh. Schneller pendelte der Muff zwischen ihren Händen. Draußen war es fast dunkel geworden. Lene verfiel in kindliches Quengeln. Linda hielt mit dem Muffschwenken inne und hob ihren Mantel ein wenig von den Schultern, um sich Luft zu verschaffen, und ließ ihn wieder fallen. Ihrer Mutter warf sie einen irritierten Blick zu. Den Moment nutzend, entschwand Lene im Flur. Vom Dienstmädchen ließ sie sich ihren Mantel geben und verabschiedete sich in aller Hast.
Margarete ging ihr hinterher, streichelte ihr über die Wange. „Nimm’s dir nicht zu Herzen, Lenchen, dieses Gerede. Du machst es, wie du denkst.“
Lene biss sich auf die Lippen, sie spürte das Gold von Margaretes Armreif auf ihrer Haut. Zu Hause bei Arnold würde sie den Kopf schütteln und wie so oft sagen, die Hoffmann-Mädels hielten zusammen wie „Pest und Cholera“, und Arnold würde darüber schimpfen, dass sie immer noch rübergehe und sich demütigen lasse, die Hoffmanns brauche sie doch nun wirklich nicht mehr.
Als sie die Tür ins Schloss fallen hörten, ließen Linda und Gitte ihre Mutter stehen, öffneten die Tür zum Balkon und zündeten sich Zigaretten an. Über ihnen hing ein grauer Januarhimmel, die Stille eines kalten Abends umgab sie, die eiskalte Luft drang in ihre Lungen, umhüllte die Worte, die nach einem Moment des nachdenklichen Schweigens aus ihren Mündern in die Schneeluft flogen. Über ihnen, aus den Dächern, stieg der Atem der Schornsteine, an den Straßenrändern unter ihnen türmten sich Haufen geschippten Schnees. Die kahlen Linden ringsum sahen aus wie Skelette im warmen Abendlicht der Gaslaternen. Die Schritte vereinzelter Fußgänger verschluckte die weiße Decke. Allmählich röteten sich die Wangen der Mädchen, und ihre Augen leuchteten in die Winternacht wie Eiskristalle. Margarete hatte ihnen verboten, im Haus zu rauchen. Ohnehin hielt sie es für unpassend. Gitte grinste und gratulierte ihrer älteren Schwester, die sie um knapp fünf Zentimeter überragte. Das sei mal wirklich gut gewesen, diese Hausfrau, die sich gerade mal die Goethestraße hoch- und runtertraue.
Linda verschränkte die Arme vor der Brust. „Plötzlich wurde ich so wütend auf ihre Art, immer alles besser zu wissen. Immer tut sie sich mit Mama zusammen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Sie tut mir ja leid, aber sie treibt mich auch zur Weißglut. Maßlos, Gitte, maßlos. Wenn ich könnte, würde ich ihr an die Gurgel springen und sie schütteln. Beinahe hätte ich sie noch gefragt, wo Arnold freitags hingeht. Es lag mir auf der Zunge.“
Gitte lächelte. Sie hatte ein breites Lächeln, Max hatte es „Dünungslächeln“ genannt. Dahinter verbarg sich ein wacher Verstand. „Frau Ostermann hat mir neulich verraten, was seine Vorlieben sind.“
„Wirklich?“
„Es muss immer dunkel sein. Bei Helligkeit kann er nicht.“
Linda zog den Pelzkragen ihres Mantels dichter unters Kinn und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus.
„Und weiter?“
„Rote oder schwarze Schuhe muss sie tragen, möglichst mit Schnüren oder Riemchen.“
„Riemchen? Aus Silber etwa? Ist nicht wahr? Warum das denn?“
Gitte zuckte mit den Schultern. „Jeder, was er muss.“
„Meinst du, Lene ahnt was?“, fragte Linda.
Statt einer Antwort zuckte Gitte wieder mit den Schultern.
„Arme Lene, da sitzt sie in ihrem Traum, und ihr Mann verrät ihn.“
Eine Weile schwiegen die Mädchen. Schließlich stieß Linda die Balkontür auf, warf ihren Mantel auf das Sofa und setzte sich an die Nähmaschine. Sie würde ihr Kleid fertig nähen. „Und dann gehen wir tanzen heute, was, Gitte? Darauf ist die Lene nämlich auch neidisch, dass sie das nicht mehr kann, jetzt, da sie ihre beiden Bamsen hat und so wunderbar glücklich ist. Tütüt.“
2
An den Augenblick, als Arnold in ihr Leben getreten war, würde Lene sich ihr Leben lang erinnern. Kurz zuvor war es ihr nach vielen Anläufen gelungen, auszuziehen und den Schikanen ihrer Mutter zu entkommen. Margarete hatte ihr ein Zimmer mit Küche vermittelt und freundlich zugeredet, und die Hoffmann-Schwestern hatten mit ihrer mitreißenden Art – „Lene, dein eigenes Zuhause! Wir nähen dir Vorhänge, Großvater schenkt uns bestimmt einen Stoff!“ – vermocht, sie anzustecken, sodass in ihr fast ein Gefühl der Freude entstanden war, das ihre Angst zwar nicht beiseiteschob, ihren Blick jedoch auf anderes gelenkt hatte. Dieses winzige Stückchen Vorfreude auf etwas Eigenes, wenn sie diese nur zuließe, würde sich ihr Leben womöglich verändern. In der Anfangszeit, als es gegolten hatte, ihre Wohnung einzurichten, hatte Margarete Lene noch etwas Geld zugesteckt und ihr zuweilen ein Stück Butter mitgegeben. Nach dem Auszug hatte Gertrud sich bitterlich bei Margarete beschwert – „die Mutter im Stich gelassen von der eigenen Tochter, ohne ein Wort, wie der Vater, sie kommt nach dem Vater“. Gertrud beschwerte sich immerzu. Verwickelt in eine Klage über ihren Bluthochdruck, ihre Monatsblutungen, ihre Atemschwierigkeiten, machte sie das Leben ihrer Tochter unfroh. Lene hatte Margarete so lange angefleht, ihr zu sagen, was und wie ihre Mutter auf ihren Auszug reagiert hatte, dass Margarete schließlich gemeint hatte: „Lenchen, Kopf hoch. Du bist jung. Sie nicht.“
„Mutti, ach Mutti, ich mach mir solche Sorgen, das war nicht recht von mir“, hatte Lene gejammert und schon den Rückzug erwogen, hätten nicht Linda und Gitta gerufen, sie kämen doch morgen mit den Vorhängen und mit einem Bettvorleger, den Großmutter nicht mehr brauche, und ein paar Kaffeetassen, die hätten sie auch noch. Tags darauf hatten sich Pusteln auf Lenes Armen ausgebreitet, bis in den Abend hinein waren sie die Schultern hinauf bis zum Hals gekrochen. Zwei Tage später waren aus den roten Pusteln eitrige Bläschen geworden, die so schmerzhaft waren, dass Lene sich schließlich ins Wartezimmer von Dr. Elias Ruben gesetzt hatte. Dr. Ruben war ein freundlicher, sechsfacher Familienvater aus Österreich mit viel Erfahrung, auf den die Nachbarschaft große Stücke hielt. Bis vor Kurzem jedenfalls.
Als Lene ins Behandlungszimmer getreten war, hatte sie nicht viel zu sagen brauchen. Dr. Ruben hatte gefragt: „Die Mutter?“, und Lene hatte genickt, den Blick gesenkt vor den duldsamen und wohlwollenden Augen von Elias Ruben. Dieser hatte die Krankenschwester eine Tinktur auftragen und Lene täglich wiederkommen lassen, drei Wochen lang. Im Wartezimmer der Arztpraxis waren Lene und Arnold sich zum ersten Mal begegnet. Arnold hatte dort gesessen und heftig in sein Taschentuch gehustet, ein Husten, der sich in ein Würgen und in Atemnot verwandelt und Lenes mütterliche Instinkte wachgerufen hatte. Sie war zu ihm geeilt und hatte den Arm um seine Schultern gelegt. „Husten Sie nur, husten Sie nur, das ist besser.“ Arnold hatte sie, von seinem Hustenanfall in Beschlag genommen, verwundert angesehen, und etwas in ihm hatte damals beschlossen – ob der Weichheit ihrer Berührung oder der Bestimmtheit, mit der Lene ihn zum Husten aufgefordert hatte, war ihm später nicht mehr gewiss –, diese Frau solle die Mutter seiner Kinder werden.
„Eine endlose Sache“, hatte Arnold schweißüberströmt nach seinem Anfall hervorgepresst. „Es ist eine endlose Sache. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.“
„Der Herr Doktor wird’s richten. Er hat auch mich fast geheilt.“ Und so hatten sie eine ganze Weile gesprochen und die Patienten um sich herum vergessen. Arnold hatte von Lenes tropfendem Wasserhahn erfahren, den der Hausmeister geflissentlich übersah, und versprochen vorbeizukommen. Einige Tage später, halb von seiner Bronchitis genesen, hatte Arnold mit Werkzeug und einem Strauß weißer und rosafarbener Nelken vor Lenes Tür gestanden. Als Dankeschön hatte Lene ein Süppchen gekocht, von Margarete hatte sie ein altes Suppenhuhn bekommen, woher Margarete es hatte, hatte auch Lene nicht gewusst, aber dankbar hatte sie es angenommen, und dankbar hatte Arnold die Suppe gelöffelt und sich urplötzlich völlig gesund gefühlt. Ein Wunder, hatte er gesagt, wie ein Wunder, die Suppe und Lene. Bald hatte sich herausgestellt, dass Arnold ganz in der Nähe wohnte und sie ihren Arbeitsweg teilten. Jeden Morgen trafen sie sich um Punkt sieben an der Straßenecke, Lene, um in die Fabrik zu gehen, Arnold auf dem Weg ins Ministerium. Ein Beamter vielleicht, hatte Lene gedacht und gehofft. Auf ein bisschen Glanz.
Inzwischen dachte Lene mit Wehmut an diese erste Zeit, als sie noch ohne Kinder gewesen waren und ihr Leben diesen Schimmer in sich getragen hatte, einen Schimmer, der ihrem Leben zuvor nicht vergönnt gewesen war. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, Gertrud auf die Hochzeit einzuladen, wieder Kontakt aufzunehmen, aber für Lene hatte es auch eine Erleichterung bedeutet, und schließlich, wen sonst außer den Hoffmanns hätte sie einladen können? „Gell, ich bin das dritte der Hoffmann-Mädels, nicht?“, hatte Lene das erste Mal auf ihrer Hochzeit gesagt und später immer wieder, und Vater Leonhard hatte sie zum Altar geführt. Das Wiedersehen mit ihrer Mutter hatte dazu beigetragen, dass Gertruds Jammern in Lenes und Arnolds Haushalt Einzug gehalten hatte und damit auch wieder in den der Hoffmanns. Arnold war dagegen gewesen, Gertrud einzuladen. Chronisch wie ihre Trunksucht sei ihr Jammern, die Kinder müsse man fernhalten, an deren Veranlagung sei nichts mehr zu ändern, aber das Umfeld, wenigstens das, könnten sie sauber halten und durch eine sportliche, gesunde Erziehung Einfluss ausüben.
Neuerdings war jedoch nicht Gertrud Gesprächsgegenstand Nummer eins.
„Er wirkt so weit weg“, verkündete Lene am Küchentisch, „was hat er nur? Es ist, als hätte sich etwas verschoben.“ Lene zerbrach sich den Kopf darüber, was sie falsch gemacht haben könnte, und – überbot sich in der Küche.
„Sein Lächeln ist müde.“
Gitte fügte hinterher dazu, als Lene sie nicht mehr hören konnte: „Es ist nicht echt.“
Am Ende eines solchen Gesprächs erklärte Lene sich Arnolds Verhalten mit einem Seufzer: „Es ist eben die viele Arbeit, die er jetzt hat.“
„Die viele Arbeit“, murmelte Linda, „sie will einfach nur diesen Satz sagen. Die viele Arbeit.“
„Wie ungeordnet das Leben in Deutschland geworden war. Margarete fühlte sich an das Elend des letzten Hungerwinters erinnert. Ihre Mädchen sollten das unbeschwerte Dasein genießen, das sich in den Cafés, Tanzlokalen, Theatern und Kinos fand. Doch Margaretes Angst war groß, wenn die Mädchen nachts unterwegs waren.“
Mein Roman „Als die Tage ihr Licht verloren“ beginnt im Jahr 1932, einem turbulenten und blutigen Jahr, dem letzten der Weimarer Republik. Deutschland befand sich in einer schweren Krise. Die Straßen Berlins waren unsicher, geprägt von Kämpfen bewaffneter Verbände. Meist kämpften Kommunisten und Nationalsozialisten gegeneinander. Gleichzeitig amüsierte sich das Bürgertum im Theater und Kino oder in den Revuen.
Das Radio und die Schallplatte fanden Verbreitung, ebenso das Telefon. Leuchtreklamen und Plakate prägten das Stadtbild, Kutschen fuhren neben dem Automobil. Junge Frauen strömten in die Angestelltenberufe, waren Verkäuferinnen oder übten Büroberufe wie Sekretärin oder Stenotypistin aus.
„Ich hatte immer so viel vor. Nach Amerika wollte ich reisen und die Welt sehen und helfe Nun weiß ich gar nicht mehr, was träumen heißt. Was soll nur aus mir werden? Sekretärin ein liebes langes Leben? Ich bleibe im Dazwischen, immer zwischen zwei, nie zu Hause, nie, nie zu Hause, nie, nie.“
Meine Hauptfiguren Linda und ihre Schwester Brigitte absolvieren auf Drängen ihrer Mutter eine Ausbildung zur Sekretärin. Während Gitte das praktisch angeht und sich sagt, danach studiere ich eben Jura, macht Linda zwar, was ihre Eltern sagen und was zu dieser Zeit auch üblich war.
Zugleich aber ringt sie mit der Suche nach ihrer Bestimmung, nach dem, was ihr Leben erfüllen soll. Sie spürt Schaffenskraft in sich, Gefühle, die nach einem Ausdruck suchen, den sie aber erst einmal nicht findet. Bestimmung, Berufung, Begehren … das sind unterschiedliche Worte, die alle mit dem zu tun haben, wie man sein Leben leben will.
„Ein gelungenes Debüt, unbedingt lesenswert.“
„Stephanie Hayek hat mit ›Als die Tage ihr Licht verloren‹ einen ersten Roman vorgelegt, in dem die jede Vorstellung von Grauen übersteigende Szenerie der Euthanasie-Verbrechen im Schicksal einer Frau und ihrer Schwester, den Beziehungen und familiären Verhältnissen beider exzellent recherchiert erzählt wird.“
„Eine hoffnungsvolle Geschichte aus Deutschlands dunkelster Periode. Absolut lesenswert.“
„Ein düster-melancholisches Epos aus Deutschlands dunkelster Periode.“
„Eine große, hoffnungsvolle Geschichte über Mut und Freundschaften, die größer sind als jede Ideologie. Atmosphärisch, warm und voller erzählerischer Kraft.“
„›Als die Tage ihr Licht verloren‹ behandelt, eingebettet in eine spannende Liebesgeschichte, die Euthanasie im Dritten Reich.“
„Von Dramatik, über Zusammenhalt, von Liebe über Leid, hier ist alles vorhanden, verpackt in die unvorhergesehene Tücke des Krieges. Ganz tolles Buch!“






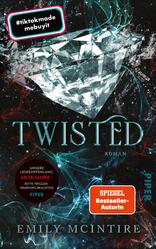
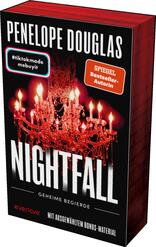






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.