
Als ich ihr Balzac vorlas — Inhalt
Die Hommage eines Sohns an seine Mutter
Als seine Mutter krank wird, stellt der Universitätsprofessor Rachid Benzine sein Privatleben in ihren Dienst. Er pflegt sie und liest der Analphabetin allabendlich aus ihrem Lieblingsbuchvor, Balzacs „Chagrinleder“. Bis zu ihrem 93. Lebensjahr wohnte sie in derselben Zweizimmerwohnung, die sie bei ihrer Ankunft aus Marokko mit ihrem Mann und den fünf Kindern bezog. Bewegend und mit politischem Subtext blickt Benzine auf das Leben seiner Mutter zurück, die ihre Kinder über Jahrzehnte mit ihrem mageren Gehalt als Zugehfrau ernährte und deren Herz stets weit offen war für die Sorgen anderer.
Leseprobe zu „Als ich ihr Balzac vorlas“
1
Bestimmt fragen Sie sich, was ich hier im Schlafzimmer meiner Mutter mache. Ich, der Literaturdozent an der katholischen Universität Louvain. Für den zu heiraten sich nie ergeben hat. Der mit einem Buch in der Hand dasitzt und darauf wartet, dass seine Erzeugerin irgendwann aufwacht. Seine Maman, müde, erschöpft, vom Leben und seinen Unwägbarkeiten mit Runzeln gezeichnet. Bei dem Buch handelt es sich um Das Chagrinleder von Honoré de Balzac. Eine alte, zerschlissene Ausgabe, so abgegriffen, dass an manchen Stellen schon die Druckerschwärze fehlt. Meine [...]
1
Bestimmt fragen Sie sich, was ich hier im Schlafzimmer meiner Mutter mache. Ich, der Literaturdozent an der katholischen Universität Louvain. Für den zu heiraten sich nie ergeben hat. Der mit einem Buch in der Hand dasitzt und darauf wartet, dass seine Erzeugerin irgendwann aufwacht. Seine Maman, müde, erschöpft, vom Leben und seinen Unwägbarkeiten mit Runzeln gezeichnet. Bei dem Buch handelt es sich um Das Chagrinleder von Honoré de Balzac. Eine alte, zerschlissene Ausgabe, so abgegriffen, dass an manchen Stellen schon die Druckerschwärze fehlt. Meine Mutter kann nicht lesen. Sie könnte sich für hunderttausend andere Werke interessieren. Warum ausgerechnet für dieses? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewusst. Sie weiß es selbst nicht. Aber ich soll ihr ständig daraus vorlesen, weil ihr gerade danach ist oder sie Beruhigung braucht oder sie einfach ein wenig Freude am Leben haben möchte. Und an ihrem Sohn.
Vor allem abends zum Einschlafen ist ihr das Vorlesen unverzichtbar geworden. Mit angezogenen Beinen schmiegt sie sich in ihr Kissen und schließt die Augen. Wie ein Kind, das ein Märchen schon etliche Male gehört hat und genau weiß, was es verzaubern und was es ängstigen wird. Ich habe ihr Das Chagrinleder bestimmt schon zweihundert Mal vorgelesen. Entdeckt hat sie es durch eine Kassette, die ich vor gut fünfundzwanzig Jahren in der Bibliothek ausgeliehen hatte. Damals wollte ich ihr auf diesem Wege die Schätze der Literatur nahebringen. Mit Hörbüchern, die eigentlich für Blinde und Sehbehinderte gedacht sind. Von den Dutzenden Ausleihkassetten gefiel ihr diese mit Abstand am besten. Auf Anhieb. Kaum hatte ich sie zurück in die Bibliothek gebracht, bat mich meine Mutter, ihr das Hörbuch zu kaufen. Und ich sollte ihr regelmäßig aus dem Roman vorlesen. Um ein wenig mit meiner Zeit zu haushalten, beschaffte ich, obwohl mich ihre Faszination für immer dasselbe Werk ein wenig beunruhigte, alle möglichen Adaptationen des Chagrinleders. Ich kaufte ihr Videokassetten, später DVDs, mit den Bearbeitungen als drame lyrique, als Oper, als Ballett und die vielfältigen Verfilmungen für Kino und Fernsehen. Aber keine davon genügte den Ansprüchen meiner Mutter dahingehend, dass sie auf mein Vorlesen verzichten wollte.
Wenn ich nicht da war, hörte meine Mutter unablässig die Kassette, von der ich mehrere Exemplare nachkaufen musste, da sie leierten – und auch die von mir angefertigten Kopien waren nach kurzer Zeit abgenudelt. Irgendwann ließ sich die Kassette im Handel nicht mehr finden. Sie war vergriffen. Also versuchte ich, sie auf Flohmärkten aufzustöbern. Ohne Erfolg. Ich log sogar in der Bibliothek und gab vor, das ausgeliehene Hörbuch verloren zu haben. Doch auch diese Kassette gab bald ihren Geist auf. Daraufhin sah ich mich gezwungen, ihr täglich vorzulesen. Ich machte sogar selbst eine Kassettenaufnahme, verstand aber schnell, dass dies meine Mutter nicht zufriedenstellte. Ich engagierte einen Schauspieler für eine digitale Aufnahme, die ich, da der Umgang mit nicht analogen Medien meiner Mutter völlig fremd ist, auch wieder auf eine Kassette überspielte. Den Segen meiner Mutter bekam sie nicht. Sie duldete nur die Kassette, mit der sie das Buch kennengelernt hatte, und mein Vorlesen.
Plötzlich fing meine Mutter stark an zu altern. Vergaß eines Tages, das Gas abzustellen. Dann wieder ließ sie sich in nur einer Woche gleich drei Wunder-Staubsauger aufschwatzen. Zudem hatte sie einen schweren Sturz und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Als einziger Junggeselle unter meinen Geschwistern zog ich vor fünfzehn Jahren einen Strich unter die Idee einer Familiengründung und zog zu meiner Mutter in die kleine Zweizimmerwohnung in Schaerbeek, in der ich fünfundvierzig Jahre zuvor zur Welt gekommen war. Meine vier älteren Brüder leben schon länger in anderen Teilen des Landes. Sie alle führen ein Familienleben und haben bereits Enkel, derweil ich, seit meine Mutter achtundsiebzig ist und nicht mehr alleine zurechtkommt, mit ihr zusammenwohne.
Seit fünfzehn Jahren pflege ich sie, wechsle ihre Windeln, wasche sie und kleide sie an. Mehrmals am Tag kümmere ich mich um ihre „Intimpflege“. Eine recht neutrale Bezeichnung für einen Vorgang, von dem ich nie gedacht hätte, ihn einmal auszuführen, seit ich vor gut sechzig Jahren mit blutverschmiertem Schreikopf durch ebendiese Intimität hinaus in die Welt gelangte.
In diesen Momenten führt meine Mutter meine Hand. Sie lächelt traurig. Wir sind beide befangen und glücklich zugleich. Ein seltsames Gefühl. Neben dem Pflegepersonal, das die Bettlägerige unter der Woche versorgt hat, bin ich der Einzige, von dem sie diese gewiss demütigende, aber von ihr als sehr wichtig erachtete Pflege annimmt.
Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich mich darum kümmern musste. Ihre Pflegerin konnte nicht kommen, hatte einen Unfall gehabt und würde erst am darauffolgenden Tag vertreten werden. Ich sah die Not im Blick meiner Mutter. Sie bat mich, sie bis dahin einfach mit dem Lappen zu waschen, das Gesicht, den Hals, die Arme. Doch wusste ich, wie unangenehm es ihr war, nicht wie gewohnt ganz gewaschen zu werden. Also schaute ich sie an und sagte, ich würde mich darum kümmern. Sie sagte nichts, ihre Augen wurden feucht, doch sagte sie nichts. Vorsichtig hob ich sie also von ihrer Unterlage hoch und wusch sie. Meine Hände zitterten. War es das plötzliche Bewusstsein, wie ausgeliefert meine Mutter war, wenn sie sich mir für so etwas Intimes vollkommen überließ? War es, weil ich spürte, wie verschämt und verletzlich sie war? Wir haben nicht gesprochen. Wir teilten diesen bewegenden Moment, suchten Zuflucht in unserer Menschlichkeit, der eine half der anderen, ohne dass Konventionen und Restriktionen etwas daran aussetzen könnten. Eine für sie in gewisser Weise befreiende Situation. Ja, sie, die niemanden je um etwas bitten wollte, konnte sich bei allem fortan ganz auf die Familie verlassen. Die Familie war in diesem Falle ich, denn keiner meiner Brüder hätte sich wohl bereit erklärt, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Jeder tut, was er kann.
Aus all diesen Gründen sagte ich sämtliche Einladungen und sonstigen Unternehmungen ab, und beschränkte mein Leben in der Außenwelt auf lediglich dreizehn Seminarstunden, die ich an der Uni gab. Bei meiner Mutter bilden nun Balzac und sein Chagrinleder den Horizont meiner Gedanken und Gefühle. Immerhin schaffe ich es noch, andere Dinge zu lesen. Denn Bücher sind mein Leben.
Seit gut sechzig Jahren hänge ich an Büchern. Die ersten habe ich mit dem Hintern gelesen. Sie dienten mir in der frühen Kindheit als Windel. Ich bekam von der in meinen Ausscheidungen aufgelösten Druckerschwärze am Po sogar eine Schmierflechte. Mein Vater arbeitete unweit von Brüssel in einer Papierfabrik. Er verbrachte den ganzen Tag damit, tonnenweise unverkaufte Druck-Erzeugnisse aller Art einzustampfen. Vom Taschenbuch bis zum Lokalblatt. Von der politischen Zeitschrift bis zum Bilderbuch. Vom Erotikmagazin bis zu veralteten Messbüchern. Jeden Tag brachte er Bücher, Zeitschriften, Zeitungen mit nach Hause. So viel er tragen konnte. Wir nutzten sie für alles: zum Heizen, Fenster-Abdichten, wir klemmten sie unter wackelnde Möbel, verwendeten sie als Toilettenpapier und eben als Windeln für die Kleinsten. Und manchmal lasen wir sie sogar. Doch weder mein Vater noch meine Mutter konnten anfangs das Französische lesen. Sie waren Mitte der 1950er-Jahre aus Zagora in Marokko nach Belgien gekommen. In einer Zeit, in der eigentlich niemand auswanderte. Und wenn doch, dann eher nach Frankreich als in das „flache Land“. Ich habe nie ganz verstanden, wie es meine Eltern hierhin verschlagen hat. Aber wollte ich das überhaupt? Meine Eltern und ich haben zwar unter demselben Dach gelebt, aber nie in derselben Zeit.
Da sie ganz durch die Erziehung von meinen vier Brüdern und mir – dem Nachzügler, der „Altersstütze“ – in Beschlag genommen waren, verschwand ich schon früh hinter den Bücherbergen im Schuppen neben unserem Haus in Schaerbeek. Einem Dorf in der Stadt, in dem wir es letztlich ganz gut getroffen hatten. Eine Zweizimmerwohnung am schmalen Ende eines Weges, mit einer Außentreppe und einem fünfzig Quadratmeter großen schief und krumm gepflasterten Hof. Ständig stolperte man, stieß sich an den Buckelsteinen die Füße oder rutschte aus, sobald drei Tropfen Regen fielen. Doch er war auch ein großartiger Tummelplatz. Für meine vier Brüder. Sie tobten sich dort nach Herzenslust aus. Ich war derweil von meinen Bücherstapeln nicht wegzubekommen. Die mein Vater, wenn er abends von der Arbeit heimkehrte, weiterwachsen ließ. Mich faszinierten die Größe der Bücher, die Fotos, die kolorierten Zeichnungen. Es war ein wunderbares Gefühl, mit geschlossenen Augen die Finger über die Seiten fahren zu lassen. Und ich lernte mit diesen Büchern lesen, noch bevor ich die Schule besuchte. Meine Brüder konnten bereits lesen und nahmen sich manchmal die Zeit, mir ein paar Wörter beizubringen. Die restlichen erschloss ich mir allein. Auch mein Vater hat auf diese Weise noch spät lesen gelernt. Er zeigte eine Vorliebe für die Zeitschrift Modes et Travaux, deren Zielpublikum klar umrissen war: die vornehme Pariser Hausfrau. Stundenlang vertiefte er sich in Mode- und Einrichtungstipps, Kochrezepte und Artikel zur Schönheitspflege. Besonders lange verweilte mein Vater auf den Seiten zum Nähen und Schneidern, insbesondere zum Stricken. Manchmal verlor er darüber zwei, drei Worte an meine Mutter. Mehr nicht.
Nie hatte ich das Gefühl, sein Lesen hätte in irgendeiner Weise Einfluss auf sein Leben gehabt. Ein Leben, das dem aller anderen eingewanderten Arbeiter in dieser Zeit sehr ähnelte. Wir beide lasen viel und gerne, doch ohne dass wir jemals miteinander darüber sprachen. Er interessierte sich nicht für das, was ich las. Und ich verstand nicht, wie er sich für seine Lektüren überhaupt interessieren konnte. Meine erste Schulbildung ließ in mir bereits eine unbewusste, aber sehr reale Klassenverachtung aufkeimen. Die mir heute noch anhaftet und für die ich mich unendlich schäme.
Kurzum, seit meiner frühen Kindheit verschlang ich Bücher wie andere Nudeln. Um heimliche Sehnsüchte in die Realität zu holen. Alles in allem die Suche nach einem anderen Leben. Darin unterschied ich mich seit jeher von meinen Brüdern, die schon sehr früh zum Überleben der Familie beitragen mussten. Mein Vater kam nämlich wenige Tage vor meinem siebten Geburtstag zu Tode, unter einer herabgefallenen Palette Bücher. Ein Schicksalsschlag, der mich allerdings nicht gegen das Lesen aufbrachte. Nur gegen Paletten. Und nicht einmal das.
2
In Sachen Tod und Sterben weist meine Mutter eine Besonderheit auf – auch wenn sie die wahrscheinlich mit allen Hypochondern, Nosophobikern und Dauerkranken dieser Erde gemein hat. Sie ist bereits viele Male gestorben … Beim ersten Mal war ich acht oder neun. Sie kehrte vom x-ten Behandlungstermin im Krankenhaus zurück. Bis zu den Ohren im Sofa eingesunken las ich begierig in einem Abenteuer-Comic. War vollkommen gefangen von der Handlung, den Kleidern der Figuren und der Frage, was wohl als Nächstes passierte. Ich bekam kaum mit, dass meine Mutter die Haustür öffnete. Dafür hörte ich sehr genau, wie sie mit lautem Plumps auf dem Stuhl zusammenbrach. Ich drehte mich um. Ihre rechte Hand ließ wie leblos ihre Handtasche zu Boden gleiten. Ihr Kopf fiel in den Nacken, und sie schluchzte los. Sobald ich merkte, welches Drama sich abspielte, warf ich mich vor ihr auf den Boden. Verzweifelt starrte sie mich an, schrie: „Ich sterbe!“, schloss mich in die Arme und brach erneut in Tränen aus.
Meine Mutter ist an diesem Tag nicht gestorben, auch nicht in den darauffolgenden Monaten. Mit der Zeit habe ich mich an ihre Dramaturgie gewöhnt, an die Inszenierung ihres angekündigten Todes, den sie in voller Aufrichtigkeit erlebte, ohne gemeinhin irgendetwas davon zu verstehen, was die Ärzte über ihren Gesundheitszustand sagten. Stets trug sie einen Koffer voller Medikamente bei sich, die sie peinlich genau zu den ärztlich verordneten Zeiten einnahm. Zweifellos hatten diese eine Wirkung, denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, bin ich bereits sechzig und sie … dreiundneunzig.
Ich kann Sie beruhigen. Auch heute noch bekomme ich regelmäßig ihren Tod verkündet. Mittlerweile nicht mehr von ihr selbst, sondern von ihren Ärzten. Mit zerknirschter Miene erklären sie mir, dass meine Mutter laut ihrer jüngsten Diagnose nicht mehr lange zu leben habe. Man könnte operieren, um sie noch ein wenig dazubehalten, könnte aber nicht allzu viel Hoffnung machen. Doch aufgrund ihres schwachen Herzens und ihres Alters … operiere man lieber nicht. Das würde sie umbringen. Sie, die so oft Gestorbene … jedenfalls würden ihr nur noch wenige Stunden zu leben bleiben, höchstens ein paar Tage. Wenn unser Hausarzt hört, was die Spezialisten an endgültigen Urteilen fällen, hebt er nur den Blick zum Himmel und sieht mich mit spitzen Lippen an: „Ich sage nichts mehr. Ich habe ihren Tod in den letzten zwanzig Jahren so oft angekündigt … ich glaube, sie wird uns alle überleben.“
Ich weiß nicht, was damals vor sechs- oder siebenundvierzig Jahren der Medizinprofessor meiner Mutter im Krankenhaus genau gesagt hat, woraufhin sie ihren baldigen Tod angekündigt hatte … Meine Mutter hat die französische Sprache nie richtig beherrscht. Wenn ein Mediziner oder jemand von der Stadtverwaltung oder ein Lehrer in der Schule ihr eine Frage stellte, antwortete sie unabänderlich mit „Ja“ – ohne sich Sorgen über die Folgen ihrer Antwort zu machen. Das hat uns schon Probleme mit der gesamten Weltbevölkerung eingebracht: mit der Polizei, dem Finanzamt, dem Sozialamt, der Bank, den Krankenhäusern und sämtlichen Verwaltungsstellen. Wie oft haben meine Brüder und ich sie bedrängt, nicht einfach jede Frage, deren Sinn sie nicht verstand, zu bejahen. Wie oft haben wir sie bekniet, nicht ohne einen von uns zu irgendwelchen Terminen zu gehen.
Sie hat uns immer viel gegeben, hat aber nie gewagt, um etwas zu bitten. Denn ihr oberster Grundsatz ist die Aufopferung. Und der Dienst am anderen ihre zweite Natur. Die Einwanderung von ihr und meinem Vater mit nicht ganz ordnungsgemäßen Papieren Mitte der 1950er-Jahre hat diesen Charakterzug bei ihr zweifellos verstärkt. Stets senkte sie respektvoll den Kopf vor Herren und Damen mit Hut, mit Titel, mit schickem Auto, mit überhaupt einem Auto, und sogar im Sozialbau. Denn für uns, die wir zu siebt in einer Zweizimmerwohnung ohne warmes Wasser und ohne Toilette lebten, gehörten Mieter in einem Sozialbau-Kaninchenkäfig bereits zur Bourgeoisie, die als solche zu respektieren und angemessen zu grüßen waren. Und die Besitzerin des kleinen Eckladens war eine Neureiche, deren sozialer Aufstieg für uns schier unerreichbar schien.
Die nur ungefähre Kenntnis des Französischen verlieh meiner Mutter zusätzlich das Gefühl, sie wäre ein Nichts. Es war für sie schon eine Ehre, wenn man überhaupt das Wort an sie richtete. Die Sprache Molières lernte sie unter Demütigungen und Hieben. Einige unverschämte Arbeitgeberinnen ließen sich tatsächlich hemmungslos gegen das kleine „arabische“ Dienstmädchen aus, das lange keinen Aufenthaltstitel besaß. In vierzig Jahren unermüdlicher Arbeit in den Haushalten skrupelloser Menschen hat sie, vom Boden bis zum Dach, eine Strecke sauber geschrubbt, die zusammen genommen mehrmals um die Erde reicht. Ein modernes Sklavendasein, das sich mit dem Tod meines Vaters noch verschärfte, das ihr aber erlaubte, sich selbst und ihre fünf Söhne mit allem Notwendigen zu versorgen. Bis vor sehr Kurzem hat meine Mutter uns nie erzählt, was sie alles durchlitten hat.
Bescheidenheit und die Befürchtung, andere zu stören, waren die Leitlichter im Geiste meiner Mutter. Niemals und für nichts auf der Welt hätte sie jemanden um seine Zeit oder Aufmerksamkeit gebeten. Sie versuchte immer, mit egal welcher Situation allein zurechtzukommen, „aus Angst zu stören“, wie sie sagte. Aber ich glaube, dass sie im Grunde eine andere, weniger sichtliche und sägliche, doch genauso tief sitzende Angst plagte: sich verletzlich zu zeigen. Denn für meine Mutter hieß „um Hilfe bitten“, seine Grenzen und Schwächen einzugestehen. Als ich mich einmal wunderte, wie schnell sie sämtliche Bus- und Metrolinien der Stadt auswendig konnte, wenn sie bei neuen Kunden sauber machen ging, erzählte sie mir mit gesenktem Blick, während sie ihre Wolldecke zerknetete, von einem Zwischenfall, der ihr für immer eingebrannt blieb. Es war an einem Wintermorgen, als ich noch nicht geboren war. Sie hatte wie jeden Morgen sehr früh das Haus verlassen, nachdem sie für meinen Vater und meine großen Brüder eine Kanne Tee auf der Kochplatte und ein noch warmes Brot auf dem Tisch bereitgestellt hatte, um zum Putzen zu einer Firma zu fahren. Verärgert über einen Streit mit meinem Vater, den sie am Vorabend gehabt hatten, stieg sie in den falschen Bus und landete in einer ihr unbekannten Gegend am Stadtrand. Verirrt und in der Sorge, zu spät zur Arbeit zu kommen, wandte sie sich an einen tief in seinen Mantel gehüllten Herrn, der mit schnellem Schritt daherkam, um sich den Weg zu ihrer Arbeit erklären zu lassen. Als der Mann den Akzent meiner Mutter hörte und bemerkte, mit welcher Mühe sie ihre Sätze hervorbrachte, blickte er sie an … und hielt ihr eine schonungslose Strafpredigt. In ihrem Alter sei es an der Zeit, dass sie lesen lerne und sich wie eine Erwachsene zurechtfinden könne. „Ich habe nicht alle Worte verstanden, aber sein Ton und sein böser Blick waren sowieso schlimmer als das, was er gesagt hat“, flüsterte meine Mutter mit einem langen Seufzer. An diesem Tag habe sie sich geschworen, nie wieder irgendjemanden um irgendetwas zu bitten und sich fortan allein durchzuschlagen, egal wohin sie gehe. Ich erklärte ihr liebevoll, meine Brüder und ich wären nicht „irgendjemand“. Sie lächelte nur und legte sich die Hand aufs Herz. Sie hatte uns viel gegeben, aber würde es nie wagen, etwas von uns zu erbitten.
Die französische Sprache brachte sich meine Mutter mehr schlecht als recht durch das ständige Wiederholen von Silben bei – ohne irgendwelche Regeln zu kennen oder zu beachten –, die sie sich mühevoll aus Zeitschriften zusammenbuchstabierte, die ihre Arbeitgeberinnen wegwarfen und die sie wie einen großartigen Schatz heimlich wieder aus dem Müll herausfischte. Erstaunlicherweise hatte sie sich zu Lebzeiten meines Vaters, als dieser noch kiloweise aus der Papierfabrik gerettete Bücher anschleppte, für das Lesen nicht interessiert. Mittlerweile waren die aus dem Abfall geretteten Zeitschriften meiner Mutter die einzigen Novitäten, auf die ich Zugriff hatte.
Schnell machten meine Brüder und ich uns der Reihe nach daran, ihrem Lesen etwas mehr Sinn zu verleihen. Und vor allem, uns hemmungslos über ihren unmöglichen Akzent zu belustigen, der ihre ausländische Herkunft verriet – auch wenn wir allein vom Hören nicht hätten sagen können, woher sie genau stammte. Der gemeinsame Wunsch, dass unsere Mutter lesen lernte, trieb uns jedoch nie ausreichend um, als dass wir ihn ernsthaft verfolgt hätten, und so machte sie kaum Fortschritte. Wir gaben uns damit zufrieden, ihr die Wörter beizubringen, die uns wirklich interessierten, also die, die sie brauchte, um im Laden die Süßigkeiten, Kekse und sonstige Leckereien zu erkennen, mit denen wir uns die Bäuche vollschlugen, oder den Namen von Panini-Alben für Fußballer-Bilder, für die wir Vater und Mutter verkauft hätten.
Doch war es nicht das Analphabetentum, für das wir uns bei meiner Mutter am meisten schämten – sie hatte im Alltagsleben selten Gelegenheit, damit aufzufallen. Es war ihr starker Akzent, der uns für immer unabänderlich schien. Und ihr irreparabler Satzbau, der einen ausländischen, bäuerlichen Ursprung verriet. Wir wissen alle, dass mein Vater und meine Mutter aus Zagora in Marokko stammten. Meine Mutter hatte mehrfach erzählt, wie sehr sie sich geniert hat, sich vor den Herren der Stadt in der Berbersprache auszudrücken, vor Herren, die selbst nur Arabisch sprachen und die über das kleine, in Lumpen gekleidete Mädchen, das im Winter bei ihren Schafen im Stall schlief, die Nase rümpften. Sie erinnerte sich auch an die Zeit, als ihre Spielkameraden sie wegen ihrer naiven, arglosen Freundlichkeit schonungslos zum Dorfdummchen erklärten.
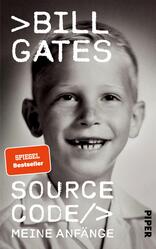
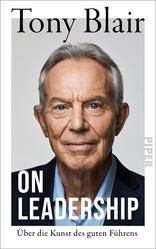

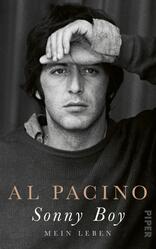

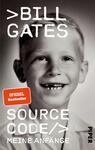


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.