„›Amsterdamer Novelle‹ ist ein virtuos erzähltes, literarisches Kleinod, viel mehr als ein Geschichtchen, schon gar kein Krimi – aber steinfestes Kunsthandwerk!“
literaturblatt.ch (CH)„Kurzweiliger Lesespaß, spannend, pointiert, fantasiereich und mit überraschenden Wendungen – eben ein echter Steinfest.“
frischvomstapel.de„Man spürt auf jeder Seite die Freude am Fabulieren und Erzählen. Ein echter/echtes Steinfest.“
doppelpunkt.de„Ein Spiel mit der Zeit, mit der Wahrnehmung, mit Manipulation, Science Fiction und Martin Heideggers Hauptwerk veranstaltet Heinrich Steinfest in seiner kompakten Amsterdamer Novelle.“
culturmag.de„Heinrich Steinfest (…) schreibt seit Jahren extravagante Bücher mit unverkennbarem Sound, viel Schmiss und noch mehr Witz. Seine frisch erschienene ›Amsterdamer Novelle‹, rund 100 Seiten kurz und als Hardcover und E-Book erhältlich, macht da keine Ausnahme. Viel mehr wirkt sie sogar wie der konzentrierte Steinfest, und das auch noch mit ein paar interessanten, fantastischen Extras.“
christianendres.de„›Amsterdamer Novelle‹ ist also nicht nur inhaltlich reizvoll, sondern auch literarisch sauber durchkomponiert – ein weiteres Beispiel steinfestscher Kunstfertigkeit.“
booksterhro.com„In der ›Amsterdamer Novelle‹ zu versinken fühlt sich ungefähr so an wie einen toll erzählten Film zu sehen.“
WDR 5 „Scala“„Amüsant und intelligent.“
Südkurier Überlingen„Amüsant und intelligent“
Südkurier„Diese ›Amsterdamer Novelle‹ ist mehr als das Kabinettstückchen eines virtuosen Erzählers.“
Stuttgarter Nachrichten„Brilliant.“
Stuttgarter Nachrichten„Originell, skurril und voller unerwarteter Wendungen – wie ein samstäglicher Besuch in Amsterdam.“
Ruhr Nachrichten„Spannend und in der wunderbaren Formulierkunst Steinfests geschrieben“
Ruhr Nachrichten„Wirklich ein großartiges Buch“
Radio freeFM „Freunde reden Tacheles“„Sein neuestes Werk ›Amsterdamer Novelle‹ ist ein unterhaltsames Vexierspiel mit Zeit, Raum und Kausalität, in dem die Feinsinnigkeit der Überlegungen von gleich mehreren Morden kontrapunktiert wird.“
Oberösterreichisches Volksblatt (A)„In diesem Kabarettstück springt Steinfest, der zu den originellsten Gegenwartsautoren deutscher Sprache zählt, gewohnt leichtfüßig zwischen literarischen Gattungen (Krimi, Liebesroman, Science-Fiction) und den unterschiedlichsten Themen . und versprüht dabei, ganz beiläufig, philosophische Sentenzen. Ein skurriles, voltenreiches Vexierspiel mit Hang zum Übersinnlichen.“
Nürnberger Nachrichten„Eine Novelle muss kein ungelesenes Antiquariat sein. Vielmehr beweist Heinrich Steinfest, dass sie nach wie vor auf engstem Raum komplexen Fragen nachgehen und gleichzeitig eine verführerische Spannung erzeugen kann.“
Norddeutsche Neueste Nachrichten„Steinfests pointiertes kleines Werk ist ein Literatur-Häppchen, das den Bogen spannt von Krimi zu Philosophie und Mystik.“
Neue Presse Stadtausgabe„Heinrich Steinfest erlaubt sich einen literarisch reizvollen, elegant verspielten und verschachtelten Scherz mit uns. Eine Art literarische Zwischenmahlzeit für Menschen, die viel und gern lesen und etwas brauchen für die Zeit zwischen zwei vielleicht wuchtigeren Büchern.“
NDR Kultur „Neue Bücher“ „Heinrich Steinfest ist mit seiner nur 108 Seiten langen ›Amsterdamer Novelle‹ – im Kleist-Jahr übrigens geradezu klassisch im Kleistschen Sinne – eine Novelle gelungen, die auf engstem Raum alles, wirklich alles hat: Mysterium, kribbelnde Spannung, Überraschungen, starke Charaktere, Wendungen, ein offenes Ende. Meisterlich.“
Musenblätter„Ich verrate gar nichts, nur dass man mit großer Freude in eine völlig verrückte Geschichte eintaucht, die sowohl spannend als auch fantastisch ist, philosophisch und witzig.“
Kölner Stadt-Anzeiger„Fesselnd und vergnüglich.“
HÖRZU„Eine wunderbare Mischung aus Spannung und Reflexion. Denn Steinfest (…) lädt seine Geschichte in eleganten Sätzen mit Bedeutung auf “
Gießener Anzeiger„Zielstrebig treibt Heinrich Steinfest die Handlung voran, der man gerne folgt, weil sie spannungsgeladen ist und überdies nicht nur den Mord und seine Aufklärung beinhaltet, sondern auch eine empfindsame Liebesgeschichte.“
Freie Presse„Steinfest, der abermals eine Mischung aus aufwendig konstruiertem Plot und großer Sprachkunst präsentiert, hebt diesmal sogar die Zeit aus den Fugen. Und was ist das nun für ein Text? Ein bisschen Krimi. Etwas Mystery. Science-Fiction in Spurenelementen. Ein Quantum Liebesgeschichte. Aber unverkennbar Heinrich Steinfest.“
Frankfurter Allgemeine Zeitung„Es ist ein typischer Steinfest: hoch spannend und auf leichtfüßige Weise philosophisch äußerst ambitioniert.“
Die Rheinpfalz„Hoch spannend und auf leichtfüßige Weise philosophisch äußerst ambitioniert.“
Die Rheinlandpfalz„Eine mustergültige Prosagattung“
Deutschlandfunk „Büchermarkt“„Fast jeder Satz bei Heinrich Steinfest ist ein lautmalerisches Fest.“
Badische Neueste Nachrichten„Aberwitziges und kurzweiliges Buch“
(A) ServusTV - LiteraTour„Spannend, mit einigen Überraschungen“
(A) Die Presse am Sonntag„Heinrich Steinfest hat mit der ›Amsterdamer Novelle‹ ein literarisches Kleinod vorgelegt, bei dem man sich wundert, wie viel Handlung, Gedanken, Stimmungen und Wendungen auf 100 Seiten Platz haben. Ein Buch, das man gelesen haben sollte.“
(A) Die Presse am Sonntag„Stilistisch und inhaltlich pointiertes und leider sehr kurzes Lesevergnügen“
(A) Bibliotheksnachrichten„›Amsterdamer Novelle‹ ist ein Vexierspiel mit Zeit, Raum und Kausalität, in dem die Feinsinnigkeit der Überlegungen von gleich mehreren Morden kontrapunktiert wird.“
(A) APA - Austria Presse Agentur„Ein großes Lesevergnügen. Sehr gut.“
ulrike-heitmueller.de











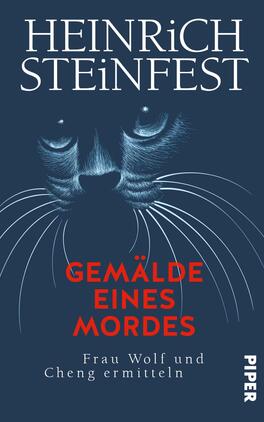





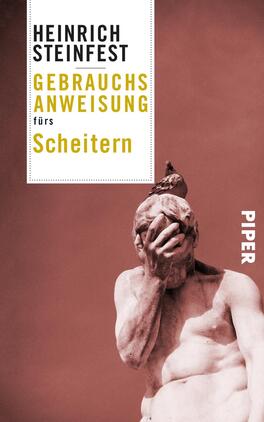

















Die erste Bewertung schreiben