

Beelitz Heilstätten Beelitz Heilstätten - eBook-Ausgabe
Roman
— Historischer Roman über einen Ort mit vielen Geschichten„Autorin Lea Kampe hat ihren historischen Roman einfach ›Beelitz Heilstätten‹ genannt und verbindet fiktive Geschichte mit dem realen Ort und der angespannten politischen Situation in Nazideutschland.“ - Landkreisbroschüre Potsdam-Mittelmark
Beelitz Heilstätten — Inhalt
Das modernste Tuberkulose-Sanatorium seiner Zeit
1938: Die zwanzigjährige Antonia wird mit einer Tuberkulose-Diagnose in die hochmodernen Beelitzer Heilstätten geschickt. Schnell geht es ihr besser, doch der strenge Tagesablauf und die ständigen Liegekuren sorgen dafür, dass die junge Frau sich alsbald langweilt. Nur die Gespräche mit dem jungen Assistenzarzt Henrik bieten Zerstreuung. Wenige Jahre später kehrt sie als angehende Ärztin für Lungenheilkunde nach Beelitz – und zu Henrik – zurück. Doch die Zeiten haben sich geändert, der Schatten des Nationalsozialismus liegt über dem gesamten Komplex. Finden Antonia und Henrik dennoch ihr Glück?
Leseprobe zu „Beelitz Heilstätten“
Teil 1
Berlin, September 1938
1
Im Hörsaalgebäude war es völlig still. Antonia hastete den leeren Gang entlang. Sie schien die Einzige zu sein, die sich verspätet hatte. Vor der Tür der Aula blieb sie stehen, schöpfte Luft und hustete kurz. Erst als sich ihr Atem wieder beruhigt hatte, öffnete sie die Tür und trat ein. Einige Köpfe wandten sich ihr zu, aber zu ihrer Erleichterung nahm Professor Schulte keine Notiz von ihr. Antonia mochte den Mann nicht, bei dem sie in diesem Herbst eine Einführung in die Grundlagen der Vererbungslehre hörte, denn immer [...]
Teil 1
Berlin, September 1938
1
Im Hörsaalgebäude war es völlig still. Antonia hastete den leeren Gang entlang. Sie schien die Einzige zu sein, die sich verspätet hatte. Vor der Tür der Aula blieb sie stehen, schöpfte Luft und hustete kurz. Erst als sich ihr Atem wieder beruhigt hatte, öffnete sie die Tür und trat ein. Einige Köpfe wandten sich ihr zu, aber zu ihrer Erleichterung nahm Professor Schulte keine Notiz von ihr. Antonia mochte den Mann nicht, bei dem sie in diesem Herbst eine Einführung in die Grundlagen der Vererbungslehre hörte, denn immer wieder nahm er seine Ausführungen zum Anlass, die aktuellen Rassengesetze der Regierung zu loben. Leise setzte sie sich auf eine Holzbank.
„In unserer letzten Stunde bin ich ausführlich auf die Mendel’schen Gesetze eingegangen, die noch immer die Grundlage unserer Vererbungslehre bilden“, sagte Professor Schulte eben. „Heute wollen wir unser neu erworbenes Wissen mit verschiedenen Aufgabenstellungen vertiefen. Kaudewitz, an die Tafel, wenn’s beliebt.“
Ein blasser junger Mann stand auf, drängte sich umständlich an seinen Kommilitonen vorbei und ging die Treppe hinunter zur Tafel.
»Die Krankheit A wird autosomal-dominant vererbt. In wel¬chem Verhältnis sind gesunde und kranke Kinder möglich, wenn der Vater an dieser Krankheit leidet, die Mutter aber gesund ist? Zeichnen Sie die möglichen Erbgänge auf. Verwenden Sie als Bezeichnung für das kranke Gen ein großes F und für das gesunde Gen ein kleines.« Er drückte ihm ein Stück Kreide in die Hand.
Der junge Mann arbeitete schnell und präzise und durfte sich wieder setzen.
„Wie Sie sehen, meine Damen und Herren“, erklärte Schulte, „gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Paar insgesamt vier Kinder hat, werden statistisch gesehen mindestens zwei von ihnen die Krankheit ebenfalls haben, im schlimmsten Fall sogar alle, was mich erneut zu dem Punkt bringt, den wir schon mehrfach angesprochen haben: Keine Regierung, die das Wohl ihres Volkes ernst nimmt, kann vor einer solchen Tatsache die Augen verschließen. Wir können uns glücklich schätzen, dass unser Führer in seiner Weitsicht entsprechende Maßnahmen getroffen hat. Bitte öffnen Sie Ihre Bücher im Anhang auf Seite 367.“
Irritiert blätterte Antonia, obwohl sie bereits wusste, was auf dieser Seite zu finden war. Sie konnte ein leises Husten nicht unterdrücken. Ein paar Kommilitonen sahen sie an. Unwillkürlich prüfte sie den Sitz ihrer grünen Strickjacke. Obwohl das Tuberkulinpflaster auf ihrem Arm nicht zu sehen war, zupfte sie den Ärmel noch ein wenig weiter nach unten.
„Fräulein Marquardt, würden Sie uns den Gefallen tun, den entsprechenden Abschnitt zu lesen?“
Antonia unterdrückte einen neuen Hustenanfall, presste sich kurz die Hand auf den Mund und hob an: »Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes (Ehegesundheitsgesetz), vom 18. Oktober 1935. § 1 Eine Ehe darf nicht geschlossen werden, wenn einer der Verlobten an einer ansteckenden Krankheit leidet, die eine erhebliche Schädigung der Gesundheit des anderen Teils oder der Nachkommen befürchten lässt, oder wenn einer der Verlobten an einer Erbkrankheit …« Es folgten weitere Punkte.
„Sie als angehende Biologen werden die Hüter dieser Gesetze sein, meine Damen und Herren“, fuhr Schulte fort, „denn Sie verstehen besser als jeder andere, warum diese Gesetze, die von vielen als barbarisch verschrien werden, notwendig sind. Ja, sie mögen hart sein, doch spätere Generationen werden uns dafür danken, dass wir die unliebsame Aufgabe auf uns genommen haben, unseren Volkskörper von allem Kranken, Hässlichen und Unreinen zu reinigen. Das Entfernen alles Degenerierten und Kranken aus unserer Mitte, wozu übrigens auch die jüdische Rasse zählt …“
Antonias Gedanken drifteten ab. Hatte der Professor sie absichtlich den Gesetzestext lesen lassen, weil er bemerkt hatte, dass sie seit Wochen hustete? Sie selbst konnte und wollte nicht glauben, dass sie unter Tuberkulose litt, dieser tödlichen Krankheit, doch ihr Hausarzt schloss diese Möglichkeit nicht mehr aus. Das Tuberkulinpflaster, das sie auf dem Arm trug, würde schon an diesem Nachmittag Aufschluss geben. Antonia betete darum, dass der Test negativ ausfiel, denn falls nicht, wäre auch sie eines der Subjekte, vor denen die deutsche Volksgesundheit geschützt werden musste.
Als sie nach der Vorlesung in die Septembersonne trat, war sie versucht, die Strickjacke auszuziehen, doch sie tat es nicht. Wie ein Stigma prangte das Pflaster auf ihrem Arm. Sie versuchte, sich zu entspannen. Die Promenade Unter den Linden war voll von Müttern mit Kindern und Paaren, die ohne Hast auf den breiten Bürgersteigen flanierten, und in den Straßencafés herrschte Hochkonjunktur. Gerne hätte Antonia sich unter die gut gelaunten Menschen gemischt und einen Mokka getrunken, doch bis zum Olivaer Platz, wo ihr Vater an seinem Kiosk auf sie wartete, war es noch ein gutes Stück, und wie immer wollte Antonia sich die Groschen für die Elektrische sparen. Als der runde grüne Kiosk mit dem spitz zulaufenden Dach endlich in Sicht kam, schwitzte sie in der Wolljacke, trotzdem legte sie die letzten Meter im Laufschritt zurück. Ihr Vater trat aus der Hintertür, und Antonia umarmte ihn.
„Du siehst aus, als könntest du eine Limonade vertragen“, lachte er.
„Oh, gerne, krieg ich auch ein paar Brausestängelchen?“
Ihr Vater lächelte. „Manchmal frage ich mich, ob meine Tochter je erwachsen wird.“ Sie betraten den Kiosk, und Antonia nahm sich mehrere Brausestangen aus einer Schale, die gut sichtbar in der Durchreiche stand, damit Kinder, die mit ihren Eltern kamen, sie gleich bemerkten. Sie beobachtete ihren Vater, während er Limonade in ein Glas füllte. Dass er selbst nie von den Süßigkeiten naschte, die er neben Zeitungen, Getränken und Tabak verkaufte, war offensichtlich, denn er war beinahe mager für seine Größe. Antonia konnte sich erinnern, dass das nicht immer so gewesen war. Erst als ihre Mutter an Tuberkulose starb und ihr Vater im Zuge der schweren Wirtschaftskrise um 1930 auch noch sein Juweliergeschäft schließen musste, hatte er stark abgenommen. Doch das war nicht sein eigentliches gesundheitliches Problem. Ihr Vater litt schon lange unter einer Herzschwäche, die durch den Verlust von Antonias Mutter und den seines Geschäftes schlimmer geworden war, körperliche Anstrengung und emotionale Belastungen musste er vermeiden. Oft fühlte Antonia sich schuldig, weil sie sich den Luxus eines Studiums leistete, obwohl der Wohlstand ihrer Familie in den letzten Jahren zusammengeschmolzen war wie Eis in der Sonne. Mit dem Kiosk am Olivaer Platz konnte Antonias Studium nur finanziert werden, weil der Vater ihre geräumige Wohnung in der Pariser Straße verkauft hatte und die Miete in der wesentlich kleineren in der Schaperstraße nicht sehr hoch war.
Ein Kunde kam, Antonia reichte ihm die gewünschte Zeitung und gab das Wechselgeld heraus. An seinem Blick, der von ihr zum Vater und wieder zurück ging, erkannte sie, was er dachte – das Verwandtschaftsverhältnis hätte nicht eindeutiger sein können. Beide waren sie blond, groß und schlank mit graugrünen Augen, auch wenn Antonias lange Haare lockiger waren als die des Vaters. Dafür hatte sie seine markante gerade Nase und das starke Kinn geerbt. „Willensstark, nicht stark“, scherzte ihr Vater, wann immer er ihre Nase oder das Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger nahm.
Antonia trank die Limonade aus.
„Müssen wir los?“, fragte sie. Ihr Vater nickte stumm. Sie wusste, wie groß seine Angst vor dem Arztbesuch war. Nachdem er seine Frau an die Tuberkulose verloren hatte, als Antonia noch ein Schulkind gewesen war, fürchtete er nichts mehr als dieselbe Diagnose bei seiner Tochter.
„Du wirst sehen, ich bin gesund, und mein Husten ist nichts weiter als eine verschleppte Erkältung“, sagte sie aufmunternd, obwohl ihr selber mulmig war. Ihr Vater antwortete nicht. Schweigend schloss er das Fenster des Kiosks und die äußeren Läden.
Als sie wenig später in Doktor Grumbachers Sprechzimmer saßen, konnte Antonia es kaum abwarten, das Pflaster endlich loszuwerden, doch der ältere Arzt ließ sich Zeit und wiederholte noch einmal, was sie bereits wusste.
„Der Mendel-Mantoux-Hauttest ist die Standardmethode zum Nachweis einer Tuberkuloseinfektion“, sagte er, an ihren Vater gewandt. „Ich habe Ihrer Tochter vor drei Tagen ein Pflaster mit Tuberkulin auf eine vorher angeritzte Hautstelle geklebt. Falls das Immunsystem schon Kontakt mit den Tuberkulosebakterien hatte, wird der Körper auf das Tuberkulin reagieren, und wir werden eine sichtbare Hautverhärtung an der entsprechenden Stelle vorfinden. Eine Rötung allein sagt gar nichts, und selbst bei einer Verdickung kommt es ganz auf die Größe der Schwellung an. Sie entscheidet über ›positiv‹ oder ›negativ‹.“
Antonia sah ihrem Vater an, dass er die Spannung ebenso wenig ertrug wie sie selbst. Da er nicht antwortete, kam Doktor Grumbacher endlich zur Sache.
„Ich löse nun also das Pflaster …“
Ungläubig starrte Antonia auf die gerötete Hautstelle mit der kleinen Verdickung in der Mitte.
„Da ist eine Schwellung … was bedeutet das? Bin ich positiv?“, brachte sie heraus, ohne den Blick von ihrem Arm zu lösen. Doktor Grumbacher betastete die Stelle, dann nahm er ein Maßband und notierte die Ergebnisse.
„Herr Doktor, wie sieht es aus?“, drängte ihr Vater. Der Arzt strich sich die grauen Strähnen über den Hinterkopf.
„Ja, also … fünf Millimeter … das ist tatsächlich nur eine kleine Schwellung. Im Normalfall wäre der Test wohl negativ.“ Er schwieg einen Augenblick.
„Aber?“, hakte Antonias Vater ungeduldig nach.
„Aber auch bei einer zu kleinen Schwellung muss man immer noch weitere, persönliche Faktoren in Betracht ziehen, um zu einer Diagnose zu kommen. Zum Beispiel bestehende Symptome wie den anhaltenden Husten Ihrer Tochter, dazu ein etwaiger Kontakt zu Personen mit Tuberkulose. Wie ich weiß, ist Ihre Frau an der Krankheit gestorben. Bei derartigen Risikopatienten müssen wir auch eine solch geringfügige Schwellung ernst nehmen.“
„Aber meine Frau starb vor vielen Jahren, und meine Tochter war bisher immer gesund.“
„Sie könnte eine latente Tuberkulose gehabt haben, eine, die nicht aktiv war. Eindeutig ist der Test in Ihrem Fall jedenfalls nicht. Ich schlage vor, dass Sie eine Röntgenaufnahme machen lassen, am besten von einem Facharzt in einer Klinik, die auf Tuberkulose spezialisiert ist. Ich denke da an meinen geschätzten Kollegen Professor Doktor Saalfeld in den Beelitzer Heilstätten. Wir haben zusammen studiert, und er ist eine Koryphäe.“
Antonia konnte sehen, dass ihr Vater erfolglos versuchte, die Nachricht zu verdauen. Ihr ging es ähnlich.
„Falls das Röntgenbild Hinweise liefert, die eine Tuberkulose-Diagnose unterstützen, könnte Ihnen meine Freundschaft mit Professor Saalfeld nützlich sein“, fuhr Doktor Grumbacher fort. „Mit etwas Glück würde er Ihre Tochter gleich zu einem Therapieaufenthalt in Beelitz behalten. Sie sind doch Mitglied in der Berliner Landesversicherungsanstalt, wenn ich mich richtig erinnere?“
Antonias Vater nickte fahrig.
„Sehr gut. Die Versicherungsanstalt wird die Kosten übernehmen. Allerdings sind die Plätze in Beelitz sehr begehrt, keine andere Lungenheilstätte in Deutschland ist so großzügig gebaut und technisch so gut ausgestattet.“
Antonias Angst wuchs. „Wie lange müsste ich denn dortbleiben?“, fragte sie. „Ich studiere Biologie, und das neue Semester hat eben erst angefangen.“
Doktor Grumbacher zog die Augenbrauen hoch. „Mit ein paar Monaten müssten Sie schon rechnen. Aber, mein Fräulein, um das Studium bräuchten Sie sich im Krankheitsfall ohnehin keine Sorgen mehr machen. Da es noch keine Medikamente oder andere effektive Heilmethoden für die Krankheit gibt, haben Schonung und ein gesundes Leben absolute Priorität. Die Anstrengung einer beruflichen Tätigkeit ist Gift. Natürlich, ein Arbeiter, der seine Familie ernähren muss, verbessert in den Heilstätten seine Konstitution, um möglichst schnell an den Arbeitsplatz zurückzukehren – er hat keine Wahl. Aber eine junge hübsche Frau wie Sie …“ Er sprach nicht weiter. Bis vor wenigen Jahren hätte er seinen Satz damit beendet, dass Antonia sich auf ein Leben als wohlbehütete Ehefrau einstellen solle, aber das hatten die vor drei Jahren erlassenen Ehegesundheitsgesetze ebenfalls unmöglich gemacht.
2
Mit Ehrfurcht hatte Doktor Grumbacher von der Schönheit, Modernität und Weitläufigkeit der Beelitzer Lungenheilanstalten gesprochen, doch zu diesem Zeitpunkt hatte Antonia dafür jeglicher Sinn gefehlt. Zu bedrohlich waren die Möglichkeit einer chronischen Krankheit und die Aussicht darauf, Wochen, wenn nicht Monate in einer Lungenheilanstalt zu verbringen. Trotzdem musste sie zugeben, dass er recht gehabt hatte. Kurz vor der Jahrhundertwende war der erste Teil der Arbeiter-Lungenheilstätte von der Berliner Landesversicherungsanstalt gebaut worden. Nur vierzig Kilometer von Berlin entfernt lagen die beiden Sanatorien – eines für Männer und eines für Frauen – im Beelitzer Stadtwald. Das Areal für die nicht ansteckenden Krankheiten hatten Antonia und ihr Vater bei der Ankunft auf der anderen Seite der Gleise hinter dem Bahnhof liegen sehen. Nun standen sie vor den viel weitläufigeren Lungenheilstätten für Tuberkulosekranke, und die Vielzahl an großen und kleinen Gebäuden erweckte den Eindruck einer ganzen Stadt.
„Guten Tag, wir haben einen Termin zum Röntgen bei Professor Doktor Saalfeld“, sagte Antonias Vater unsicher, als sie hinter dem Tresen des Pförtnerhäuschens nur einen schlaksigen, etwa siebzehnjährigen Jungen antrafen.
„Sehr gerne, meine Herrschaften, darf ich um Ihren Namen …“
„Jojo, geh nach hinten, lass mich das machen.“ Aus einem Hinterzimmer kam ein junger Mann, der der ältere Bruder des Jungen sein musste. Ihre Gesichter waren ähnlich geschnitten, und sie hatten beide braune Haare sowie braune, wache Augen. Doch damit endete die Gemeinsamkeit, denn während der ältere Bruder sonnengebräunt und breitschultrig war, wirkte der jüngere feingliedrig und blass, und im Gegensatz zu den kurz geschnittenen und streng gescheitelten Haaren des Älteren fiel dem jüngeren Jojo der Pony fransig in die Stirn. Bereitwillig machte der Junge Platz und zog sich zurück.
„Bitte entschuldigen Sie“, sagte der Ältere nun. „Ich heiße Ronald Berggruen. Eigentlich ist mein Vater hier der Pförtner, aber heute ist sein freier Tag, da vertrete ich ihn. Wie war Ihr Name?“ Bei der Frage ging Ronalds Blick vom Vater zu Antonia.
„Friedrich Marquardt und Tochter.“
Ronald nickte, konnte seinen Blick aber nicht von Antonia lösen.
„Hm.“ Friedrich Marquardt räusperte sich. Ronald Berggruen schreckte auf und blickte in das Buch vor ihm.
„O ja, Herr Marquardt“, sagte er schnell. „Ich sehe Ihren Termin. Ich werde sofort nach einer Krankenschwester telefonieren, die Sie begleiten wird. Offenbar ist das Ihr erster Besuch bei uns, da kann man sich auf dem Gelände leicht verlaufen.“ Er griff zu einem schwarzen Telefon. Nur einmal noch erlaubte er sich einen Seitenblick auf Antonia.
Von da an lief alles wie am Schnürchen. Eine Schwester, die sich als Oberschwester Hilde vorstellte, holte sie ab und geleitete sie zum Klinikgebäude, das erst vor wenigen Jahren im Heilstätten-Komplex errichtet worden war, um auch schwer kranke Tuberkulöse mit den neuesten chirurgischen Eingriffen behandeln zu können.
Verstohlen sah Antonia sich um. Die schönen, von Parkanlagen umgebenen Pavillonensembles mit ihrer Mischung aus roten Dachziegeln und Fachwerk, großen Rundbogenfenstern, Erkern, Rosetten und spitz zulaufenden Türmchen hatten so gar nichts von einer Klinik. Die lang gestreckten, hellen Gebäude mit den roten Ziegelsteinornamenten, umgeben von weitläufigen Rasenflächen mit hohen Laubbäumen, Tannen und Fichten, glichen eher den hübschen Häusern einer Ferienkolonie an der Ostsee. Üppige Hortensien leuchteten in Blau und Lila, und in großzügigen Rabatten blühten Rosen, Herbstastern und Dahlien. Dazwischen verliefen Spazierwege, gesäumt von Bänken, die zum Ausruhen einluden.
Aber niemand geht spazieren, dachte Antonia. Sie war hin- und hergerissen zwischen der Freude an der schönen Anlage und der Furcht vor der bevorstehenden Röntgenuntersuchung. An einer Kreuzung mehrerer Wege standen Schilder, die zu verschiedenen Teilen des Areals wiesen: Verwaltung, Frauenpavillons, Liege- und Wandelhallen, las Antonia im Vorübergehen, aber auch unerwartete Wegweiser wie Bäckerei, Fleischerei, Waschküche, Maschinen- und Pumpenhaus, Obstplantage, Gärtnerei, Schlosserei, Feuerwehr und Stallungen.
„Das ist ja eine ganze Stadt hier!“, bemerkte Antonias Vater beeindruckt.
„O ja.“ Oberschwester Hilde lächelte stolz. „Und dabei ist das hier längst noch nicht alles. Auf der anderen Seite des Männersanatoriums gibt es noch die Wohngebäude der Ärzteschaft und die Villa unseres ärztlichen Direktors. Außerdem gehören zu den Beelitzer Heilstätten mehrere landwirtschaftliche Güter in der unmittelbaren Umgebung, die Milch und Fleisch produzieren oder Gemüse und Getreide anbauen. Viele der nahrhaften Dinge, die täglich bei uns auf den Tisch kommen, stammen von dort. Auch für die vielen Arbeiter und Arbeiterinnen gibt es Wohnsiedlungen, allerdings sind die nicht auf dem Areal der Heilstätten.“
Die moderne Klinik, in der Antonia geröntgt werden sollte, kam in Sicht. In der Mitte des zweistöckigen, lang gestreckten Gebäudes befand sich eine gläserne Fassade, die sich bis ins Dach zog. Die Linien des Baus waren streng geometrisch, es fehlte das Romantisch-Verspielte der übrigen Sanatoriumsgebäude.
„Viel Licht und Luft“, erklärte Oberschwester Hilde, die ihre Blicke bemerkte. „Unsere Chirurgie wurde erst 1930 fertiggestellt. Es gibt vierzig Betten für Frauen, vierzig für Männer, dazu drei Operationssäle, Einrichtungen für Lichttherapie und ein hochmodernes Röntgeninstitut, zu dem wir jetzt gehen. In den Flügelbauten befinden sich außerdem wunderschöne, von Kuppeln überdachte Baderäume.“ Sie traten ein, und Oberschwester Hilde ging ihnen voran. Das Treppenhaus war luftig. In hellen Farben gehaltene und von Säulen getragene Arkaden umgaben die bereits von unten sichtbaren Stockwerke, zu denen breite Steinstufen mit verzierten schmiedeeisernen Geländern führten.
„Herr Friedrich Marquardt und seine Tochter Antonia sind hier zum Röntgen“, verkündete sie einem Arzt mit markant geschnittenem Gesicht. Seine leicht gewellten blonden Haare hatten nichts von der kurz gestutzten Frisur, wie sie derzeit bei Männern üblich war, vor allem aber hatte Antonia hinter dem Titel Professor Doktor einen wesentlich älteren und gesetzteren Herrn vermutet. Nur der strenge, beinahe abweisende Gesichtsausdruck des jungen Mannes entsprach dem Stereotyp des autoritären Arztes. Mit einem knappen Nicken als Begrüßung bedeutete er ihr, mit ihm zu kommen, und auch während der schweigend verlaufenden Vorbereitungen für die Röntgenaufnahmen erfolgten seine knappen Anweisungen ohne Blickkontakt. Aufrecht musste sich Antonia in den Röntgenapparat stellen. Die Bilder selbst waren schneller gemacht als erwartet, und der Arzt befestigte sie vor einer Lichtquelle. Antonias Herz klopfte, während sie sich wieder vollständig anzog, aber noch schien der Arzt zu keinem Ergebnis gekommen zu sein.
Um sich zu beruhigen, hatte Antonias Vater sich ans Fenster gestellt und sah hinaus in den herbstlichen Park. Antonia ließ den Blick durch den Raum schweifen. Die Wände waren mit hellgelber Farbe lackiert, die abwaschbar aussah, das Septemberlicht verlieh ihr eine freundliche, zuversichtliche Note. Ihr Herz flatterte, als sie bemerkte, dass sich der Anflug eines Lächelns auf das Gesicht des Arztes geschlichen hatte. Er nahm die erste Aufnahme vom Lichtschirm und griff zu einer zweiten. Antonia wollte eben eine Frage stellen, doch ihr Vater kam ihr zuvor.
„Herr Professor, was sagen die Röntgenaufnahmen?“, platzte Friedrich Marquardt heraus. „Was hat meine Tochter?“
Wieder stahl sich ein kurzes Lächeln auf das Antlitz des Arztes, und Antonia bemerkte den Ansatz zweier Grübchen, die sein ganzes Gesicht veränderten. Doch sofort wurde er wieder ernst.
„Ich bin nicht der Professor, aber ich glaube, ich kann Sie beruhi…“ Die Tür wurde mit Schwung geöffnet, und ein stattlicher Mann im weißen Kittel trat ein. Seine grauen Haare waren nach hinten gekämmt, der Schnurrbart akkurat gestutzt, und in der Brusttasche seines weißen Kittels steckte ein adrett gefaltetes rotes Seidentaschentuch.
„Entschuldigen Sie die Verspätung“, polterte er. „Herr Friedrich Marquardt aus Berlin, wenn ich nicht irre? Gestatten, Professor Doktor Rudolf Saalfeld.“ Er reichte erst Antonias Vater, dann ihr selbst die Hand. Überrascht blickte Antonia zu dem jungen Arzt. Wenn er nicht Saalfeld war, wer war er dann? Sie musste nicht lange auf die Antwort warten.
„Meine rechte Hand, Doktor Henrik Westphal, haben Sie ja schon kennengelernt.“ Der junge Doktor, der automatisch einen Schritt zur Seite getreten war, wies auf die Röntgenaufnahmen.
„Hm“, machte der Professor nach eingehender Betrachtung, während Antonias Spannung ins Endlose stieg. „Soso.“
Er drehte sich wieder um und bat Antonia, auf einem Patientenstuhl Platz zu nehmen. „Wenn ich Sie bitten dürfte, Ihre Bluse ein wenig zu öffnen. Ich werde jetzt die Perkussion vornehmen.“ Antonia kannte die Prozedur schon von Doktor Grumbacher. Ausführlich beklopfte der Arzt ihre Brust und den Rücken und lauschte auf die Atemgeräusche.
„Gut, und nun die Auskultation. Darf ich das junge Fräulein bitten, stark zu atmen und zu husten?“ Antonia tat wie geheißen, und wieder horchte der Professor mit seinem Stethoskop.
Endlich setzte er sich. „Ich habe Ihre Akte gelesen, die junge Dame ist familiär vorbelastet.“
„Aber …“, setzte Friedrich Marquardt sofort an, doch der Professor ließ ihn nicht zu Wort kommen. „Ich sehe den Ansatz eines Schattens auf dem linken Lungenflügel“, sagte er bestimmt.
Alarmiert blickte Antonia zu Doktor Westphal, der kurz den Mund öffnete, ihn aber wieder schloss, ohne etwas einzuwenden.
„Dazu gewisse Geräusche im Lungenbereich, vor allem beim Husten“, fuhr der Professor fort.
„Ich hatte schon häufiger schwere Bronchitis“, warf Antonia ein. „Die letzte war besonders schlimm. Ich bin nie ganz über sie hinweggekommen.“
Der Professor sah sie ernst an. „Müssen Sie manchmal ausspucken?“, fuhr er fort.
„Ja, schon, wenn ich huste, aber nicht sehr viel, und …“
„Wenn es das nächste Mal passiert, dann bitte hier hinein.“ Er reichte ihr eine kleine blaue Flasche. „Wir nennen sie den Blauen Heinrich“, erklärte er. „Ihr nächstes Sputum werden wir auf Tuberkulosebazillen untersuchen. Haben Sie häufiger leichtes Fieber oder Schüttelfrost, vor allem nachts?“
„Ab und zu habe ich erhöhte Temperatur, aber keinen Schüttelfrost.“
„Vielleicht ist es nur eine schlecht verheilte Bronchitis mit hartnäckigem Husten?“, beharrte Antonias Vater.
Der Professor räusperte sich. „Ich sehe immer das Gesamtbild. Die Röntgenaufnahme, der grenzwertige Tuberkulintest meines geschätzten Kollegen Grumbacher, die Atemgeräusche und vor allem die familiäre Vorbelastung“, führte Professor Saalfeld aus. „In Ihrem individuellen Fall rate ich dringend zu einem Aufenthalt hier. Sie haben Glück. Obwohl unsere Heilstätten die größten in Deutschland sind, kann auch bei uns der Platz knapp werden, denn wir können uns vor Anfragen kaum retten. Aber ich bin mit Ihrem Hausarzt befreundet und bereit, Ihre Aufnahme unbürokratisch zu vollziehen. Die Sache mit der Berliner Landesversicherungsanstalt werde ich persönlich klären. Haben Sie denn Ihr Gepäck dabei?“
„Gepäck?“
„Hat Doktor Grumbacher Sie nicht instruiert, was Sie mitzubringen haben?“
„Ehrlich gesagt, nein. Wir gingen ja auch nicht davon aus, dass meine Tochter sofort hierbleiben soll“, sagte Friedrich Marquardt, bestürzt über die Wendung des Gesprächs.
Doktor Saalfeld seufzte. Ohne auf die Bemerkung einzugehen, erklärte er: „Tuberkulose ist eine ansteckende Krankheit, weshalb jeder Patient in Bezug auf Kleidung und Hygieneartikel völlig autonom sein muss. Unsere Oberschwester wird Ihnen eine Liste der Dinge aushändigen, die Ihre Tochter hier benötigt. Bitte bringen Sie nicht mehr und nicht weniger mit, als auf dieser Liste steht. Wäre Ihnen das bis morgen möglich?“
„Ja, natürlich“, antwortete Friedrich Marquardt überrumpelt.
Aber Antonia gab sich noch nicht geschlagen. „Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Da kann ihre Krankheit doch unmöglich etwas mit mir zu tun haben. Hätte ich mich bei ihr angesteckt, wäre ich sicher schon damals krank geworden, und mein Vater dann wohl auch.“
„Das ist leider nicht richtig“, belehrte sie der Professor. „Nur ein kleiner Prozentsatz derer, die mit einem Tuberkulosekranken in Berührung kommen, erkrankt selbst. Außerdem kann die Krankheit latent und inaktiv im Menschen schlummern und erst nach Jahren zum Ausbruch kommen, zum Beispiel, wenn der Körper und das Immunsystem geschwächt werden.“
„Aber wenn die Sputumprobe negativ ausfällt, kann ich doch wieder nach Hause, oder?“, insistierte Antonia bang.
„Mein Fräulein“, erwiderte der Professor mit einem Anflug von Ungeduld, „ein negativer Sputumtest würde nur besagen, dass Sie im Augenblick keine Tuberkulosebakterien im Auswurf haben, andere also zu diesem Zeitpunkt nicht anstecken können. Es besagt nicht, dass Sie nicht erkrankt sind. Möglicherweise nur leicht, ja, aber genau für diese Phase der Krankheit sind die Heilstätten ja gedacht. Wir zielen darauf ab, Erkrankte im frühestmöglichen Stadium zu uns zu holen, um die größten Heilungschancen zu haben. Außerdem neigen gerade junge Menschen wie Sie zu unvernünftigem und gesundheitsschädlichem Verhalten. Alldem wirken wir hier entgegen. Ich kann außerdem gar nicht genug betonen, wie viele da draußen sich glücklich schätzen würden, ihre Kraft an diesem wohltuenden Ort wiedererlangen zu dürfen.“
„Mein Semester hat gerade angefangen, ich studiere Biologie“, sagte Antonia leise und fügte hinzu: „Darf ich hier wenigstens an meinen Seminarstoffen weiterarbeiten?“
„Soso, eine angehende Naturwissenschaftlerin, beinahe schon eine Kollegin.“ Professor Saalfeld lächelte wohlwollend. „Wie Ihnen Oberschwester Hilde erklären wird, unterliegen unsere Patienten dem Reglement eines streng durchgeplanten Tagesablaufs. Viel Zeit zum Lesen wird Ihnen dabei nicht bleiben, zumal jede Form von geistiger Anstrengung, jede Aufregung zu vermeiden ist. Tuberkulose ist keine heilbare Krankheit, aber die Chancen, seine Körperkraft zurückzuerlangen und einen schweren Verlauf zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern, stehen nur dann gut, wenn der Patient den Orts- und Luftwechsel als Chance begreift und nicht als Strafe.“
Er sah Antonia prüfend an, doch die blickte wieder auf den Assistenzarzt. Hatte dieser Doktor Westphal ihr nicht gerade Mut zusprechen wollen, als der Professor ins Zimmer getreten war, oder war das nur eine Floskel gewesen? Wahrscheinlich, denn Doktor Westphal hatte sich nicht in das Gespräch eingemischt, er fixierte hartnäckig einen Punkt auf der gegenüberliegenden Wand. Entmutigt ließ Antonia den Kopf sinken, als ihr Vater ihre Hand ergriff. „Es ist ja nur für ein paar Wochen“, sagte er schwach, doch Antonia ahnte, dass er es besser wusste. Sollte sie wirklich an Tuberkulose leiden, würden sich die Heilstätten-Aufenthalte in ihrem Leben aneinanderreihen wie Perlen auf einer Schnur, bis sie irgendwann … Sie konnte den Gedanken nicht zu Ende denken.
„Willkommen in Beelitz.“ Oberschwester Hilde lächelte sie aufmunternd an, als Antonia nach dem Gespräch mit Professor Saalfeld allein mit ihr im Schwesternbüro des Frauensanatoriums stand. Ihr Vater hatte sich verabschiedet, und Antonia fühlte sich niedergeschlagen.
„Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an mich oder jede andere Schwester im Haus wenden.“ Schwester Hilde hatte ein großes schwarzes Buch geöffnet, auf dem Patientenverzeichnis stand. In sauberer Schrift trug sie Antonias Daten ein. Dann holte sie ein Fieberthermometer aus der Schublade des Schreibtisches. „Eines bekommen Sie von uns, ein zweites muss Ihr werter Herr Vater Ihnen morgen mitbringen. Eine halbe Stunde vor jeder Mahlzeit läutet eine Glocke, die Sie daran erinnert, Fieber zu messen.“
Antonia wollte noch einmal erklären, dass sie nur ab und zu Temperatur hatte, doch Schwester Hilde war schon beim nächsten Punkt. „Die blaue Sputumflasche, unseren Blauen Heinrich, haben Sie ja schon. Sie sind verpflichtet, ihn immer bei sich zu tragen. Ausspucken auf den Boden ist strengstens verboten, auch draußen im Park. Falls Sie die Flasche je vergessen sollten, hängen in allen Fluren in regelmäßigen Abständen Spucknäpfe, die regelmäßig geleert und desinfiziert werden. Die vollen Flaschen übergeben Sie uns Schwestern zur Entsorgung und Desinfektion. So, kommen Sie, ich werde Ihnen nun die wichtigsten Räume und anschließend Ihr Zimmer zeigen. Sie haben Glück, bei Frau Linde Walz ist ein Bett frei geworden. Sie kommen also in ein Zweibettzimmer, das haben hier längst nicht alle.“
„Wie viele Betten gibt es denn insgesamt?“, fragte Antonia, um überhaupt etwas zu sagen.
„Wenn man die Anlage als Ganzes nimmt, sind es über tausend“, sagte Schwester Hilde stolz.
„Oh, das sind tatsächlich sehr viele.“ Antonia betrachtete die Frau verstohlen. Als Kind hatte sie sich Krankenschwestern immer klein, rund und grauhaarig vorgestellt. Auf Schwester Hilde traf kaum etwas davon zu. Zwar war sie nicht sehr groß, dafür schlank mit kräftigen Schultern, vollen Wangen und langen schwarzen Haaren, die hochgesteckt waren und teilweise von ihrer weißen Kappe verdeckt wurden. Obwohl Antonia sie auf um die fünfzig schätzte, hatte sie noch kein graues Haar, und ihre weiße Schwesternschürze über der gröber gewebten dunkelgrauen Bluse war vor dem Bauch akkurat gebunden.
Während sie durch die Korridore liefen, begegneten ihnen weitere Schwestern, die die Oberschwester höflich grüßten, aber keine Patientinnen. Der in Hell und Dunkel gekachelte Boden strahlte frisch gewischt, und auch die mit Emaillefarbe gestrichenen Wände – hellgelb mit grünem Sockel – glänzten. In regelmäßigen Abständen bemerkte Antonia die kleinen Metallbecken, von denen die Schwester gesprochen hatte. „Alle Oberflächen in unserem Haus sind glatt und leicht abzuwaschen, um höchsten Hygienestandards zu genügen“, erklärte Schwester Hilde, als hätte sie ihre Gedanken erraten. „Von den Spucknäpfen habe ich ja bereits gesprochen.“
Waren es diese Informationen, die Antonias flaues Gefühl verstärkten, oder lag es an den stillen, menschenleeren Fluren, in denen ihre eigenen Schritte laut und bedrohlich widerhallten? „Dafür, dass es hier so viele Patienten gibt, ist es erstaunlich leer“, sagte sie bang, aber Schwester Hilde hatte sofort eine Erklärung.
„Zwischen 14 und 16 Uhr ist obligatorische Hauptliegekur. Sämtliche Patientinnen ruhen jetzt in den Liegehallen im Park. So, hier sind wir …“ Sie öffnete eine zweiflügelige Tür, hinter der sich ein großer Saal mit langen Tischen und unzähligen Holzstühlen befand. Durch die vielen Rundbogenfenster, die ebenso breit wie hoch waren, fiel warmes Licht in den Raum, sodass er trotz seiner funktionalen Einrichtung hell und freundlich wirkte. Sofort fiel Antonia die mit Stuck gestaltete Kassettendecke auf, von der hübsche, zierliche Lampen hingen. Auch an den Wänden über den Rundbogenfenstern gab es vereinzelte Stuckverzierungen in Form von Girlanden und Umkränzungen. Antonia war beeindruckt. So viel Eleganz und Liebe zum architektonischen Detail hatte sie in einer Heilstätte für Kranke nicht erwartet.
„Unser Speisesaal“, sagte Schwester Hilde. „Regelmäßige, kräftigende Mahlzeiten sind ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Schließlich soll der Körper gestärkt werden. Zum Frühstück um 8 Uhr gibt es Weißbrot oder Mehlspeisen, dazu Milch und Kaffee. Das zweite Frühstück um 11 Uhr besteht aus belegten Broten sowie ein bis zwei Gläsern Milch. Zum Mittagessen um 13 Uhr gibt es Suppe, außerdem eine Fleischspeise, Kartoffeln und Gemüse. Um 16 Uhr ist Vespertee mit Weiß- oder Butterbrot, und zum Abendessen um 18 Uhr erhalten Sie wieder Suppe, Kartoffeln, ein Stück Fleisch und anschließend ein bis zwei Gläser Milch. Beim Essen ist übrigens die größtmögliche Ruhe einzuhalten. Für jeden Tisch gibt es eine sogenannte Tischälteste, die dafür zuständig ist. Erst wenn sie die Tafel aufhebt, dürfen Sie den Tisch verlassen.“
Antonia konnte kaum fassen, wie oft und wie viel sie in den nächsten Wochen essen sollte, aber das war ja wohl nicht die einzige Therapie?
„Und was machen die Patientinnen zwischen den Mahlzeiten?“, fragte sie.
„Nach dem ersten Frühstück gibt es einen Spaziergang. Diese Zeit haben Sie zur freien Verfügung, solange Sie sich draußen im Park aufhalten. Auch Kegeln ist als Spiel auf bestimmten Grünflächen gestattet, allerdings keine anstrengenden Ballspiele. Danach eine Stunde Liegekur. Weitere Liegekuren folgen auf alle anderen Mahlzeiten. Die Orgel dort drüben“, sie wies auf das Instrument, das in der Nische des breitesten Rundbogenfensters stand, „wird ab und zu für Konzerte im Haus verwendet. Und nun kommen Sie, ich zeige Ihnen die Dusch- und Baderäume.“ Schwester Hilde verließ den Saal, schloss die Tür und ging Antonia in dem Labyrinth an Korridoren voraus.
Antonias Herz sank erneut. Einerseits waren die Räumlichkeiten schön und einladend. Aber stundenlang liegen? Mehrfach am Tag? Doch dann kam ihr eine Idee.
„Während des Liegens ist Lesen doch sicher erlaubt?“, fragte sie hoffnungsvoll.
„Nur während der Abendliegekur und der abendlichen freien Zeit in den Aufenthaltsräumen. Morgens erlauben wir ab und zu Gesellschaftsspiele, aber nur, wenn sie die Gemüter nicht zu sehr erhitzen.“
„Lesen nur nach dem Abendessen?“ Antonia waren die Gesellschaftsspiele schnurz. „Aber warum? Lesen ist doch nicht anstrengend.“
„Das sehen unsere Ärzte anders. Schauen Sie, da sind unsere Duschen.“ Schwester Hilde öffnete die Tür zu einem riesigen Raum. In seine Mitte war ein großes Becken mit kleinen, treppenartigen Zugängen eingelassen. Statt einer normalen Decke gab es gekachelte, von Säulen getragene Gewölbe, die Antonia eher an eine Kirche als an einen Baderaum erinnerten. An mehreren Stellen entlang der Wände standen Duschen. Auch hier waren der schwarz-weiß gekachelte Boden und die Wände spiegelblank.
„Jeden Tag um 7 Uhr finden noch vor dem Frühstück die kalten Abreibungen statt“, erklärte Schwester Hilde. „Sie werden sehen, in ein paar Tagen kennen Sie die Routine in- und auswendig. Außerdem ist Ihre Bettnachbarin Frau Walz sehr nett, sie wird Ihnen sicher helfen, sich zurechtzufinden.“
Antonia nickte zerstreut, obwohl sie sich kaum vorstellen konnte, dass dies nun für die nächsten Wochen oder sogar Monate ihr Leben sein sollte.
Das erklärte sie auch ihrem Vater, als sie ihm ein paar Tage später einen ersten Brief schrieb.
Liebster Vati!
Du willst wissen, wie meine Tage hier so aussehen. Das ist nicht schwer zu beschreiben, denn viel Abwechslung gibt es nicht. Schön ist es, dass die Fenster unserer Zimmer immer geöffnet sein müssen, auch nachts, so haben wir den Rosenduft aus dem Park in unserem Schlafraum, und wenn ich mich anstrenge, meine ich auch die Kiefern und das Harz aus dem umliegenden Wald zu riechen. Heute Nacht habe ich mäßig gehustet, aber trotzdem Hustensaft bekommen, ebenso wie meine Zimmergenossin Linde Walz, die seit einer Woche einen negativen Sputum-Test hat und vielleicht bald entlassen wird. Sie kann es kaum erwarten, denn sie hat einen dreijährigen Jungen, Walter. Überhaupt geht es hier den lieben langen Tag nur darum: Wessen Sputum-Test jetzt bald negativ sein könnte, wer beim Wiegen ab- oder zugenommen hat, wessen Temperatur um 7 Uhr schon über 38 Grad lag und zu wem Schwester Gerda in der Nacht wieder erst nach langem Rufen gekommen ist. Es gibt sogar eine Patientin, die glaubt, Schwester Gerda hätte sie auf dem Kieker; sie versucht, während der Liegekuren gegen sie mobilzumachen! Ach ja, und natürlich rätseln alle, ob eventuell wieder neue Fälle in die Lungenklinik eingeliefert werden. Das sind die Schwerkranken, die dort einen Pneumothorax bekommen oder sogar eine Plastik. Bei der Plastik werden die Rippen teilweise entfernt, und das klingt doch sehr schaurig, nicht wahr? Wie du siehst, bin ich Knall auf Fall in eine andere Welt eingetaucht. Meine Zimmergenossin Linde ist sehr nett. Sie isst gerne Nüsse und Sonnenblumenkerne, die sie sich von ihrem Mann schicken lässt. Einen Teil davon füllt sie in eine flache Tabakkiste, die sie von einer anderen Patientin bekommen hat, obwohl Rauchen hier strengstens verboten ist. Trotzdem duftet es in den Toiletten aromatischer als in jedem Tabakladen. Jedenfalls stellt sie diese Kiste während unserer Liegekuren für die Vögel in die Liegehalle, und die kommen in Scharen, als wenn sie wüssten, dass wir nicht aufstehen dürfen und deshalb völlig ungefährlich sind. Wenn keine Aufpasserinnen anwesend sind, stehen wir aber trotzdem ab und zu auf. Das viele Liegen macht einen sonst ganz steif. Eine Amsel kommt jeden Tag, die anderen wahrscheinlich auch, aber die kann man nicht auseinanderhalten. Der Amsel aber fehlt am rechten Fuß eine Zehe, deshalb haben wir sie besonders gern und sprechen mit ihr, als wäre sie ebenfalls hier in den Heilstätten zur Kur und zum „Mästen“. Sie legt dann immer den Kopf schief und hört andächtig zu.
Siehst du, und jetzt hätte ich beinahe noch etwas besonders Kurioses vergessen. Es gibt nämlich hier im Frauenpavillon jemanden, der ab und zu Klavier spielt, allerdings nicht auf dem Instrument, das in den Aufenthaltsräumen steht und das wir abends selber benutzen können (was aber niemand tut, denn keine der Patientinnen hat eine musikalische Ausbildung genossen). Nein, das ferne Klavierspiel kommt von irgendwoher in diesem doch recht großen Gebäude. Es ranken sich schon allerlei Mythen und Gerüchte darum, und die Schwestern, denen wir immer damit in den Ohren liegen, machen sich einen Spaß daraus, uns nichts zu sagen, obwohl sie den Spieler natürlich kennen. Eine besonders abergläubische Patientin sprach neulich sogar vom „musikalischen Geist von Beelitz“. Daraufhin hat meine Zimmergenossin Linde ihr einen großen Schreck eingejagt, indem sie so tat, als wäre auch sie davon überzeugt, und hinzufügte, es sei bestimmt eine ehemalige verstorbene Patientin, deren Seele keine Ruhe findet. Das fanden dann doch alle ein bisschen zu gruselig, und seither überwiegen wieder die Spekulationen, welche Schwester oder welcher Arzt es wohl sein könnte. Ich persönlich tippe auf den Professor, der mir ein wahrer Mann der Kultur zu sein scheint, was meinst du?
Und zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Wäre es nicht schön, wenn du mir mein Herbarium schicken könntest? Der Park hier ist wirklich wunderbar, vielleicht finde ich ja ein paar Pflanzen, die ich meiner Sammlung hinzufügen kann? Besuchstag ist ja leider nur einmal im Monat, und bis zum nächsten ist es noch so lange hin.
So, und jetzt muss ich enden. Unser Tagesablauf ist ganz und gar durchorganisiert. Um dir schreiben zu können, musste ich extra den Spaziergang nach dem Frühstück eine Viertelstunde früher beenden, obwohl das eigentlich nicht zulässig ist.
Schreibe auch du mir oft, denn nichts ist schöner als ein Brief am Morgen!
Deine Antonia
An die umliegenden Wälder dachte Antonia auch einige Stunden später, als sie mit geschlossenen Augen auf einem Liegestuhl lag. Es war die letzte Liegekur des Tages, und obwohl es noch nicht dunkel war, konnte Antonia das Fortschreiten der Zeit anhand der rötlicher werdenden Sonne jeden Abend genau ablesen. Sie hatte nicht übertrieben, wenn sie im Brief an den Vater von einer „anderen Welt“ gesprochen hatte. Natürlich hatte das etwas mit der Abgeschiedenheit zu tun. Wie eine geheime Stadt duckte sich der riesige Heilstättenkomplex in die Wälder um die Hauptstadt. Eine heilige Stadt, deren Einwohner alle das Gleiche verband: die Krankheit. Sie waren eine eingeschworene Gemeinschaft von Menschen aus den verschiedensten Lebenskreisen. Bunt zusammengewürfelt und doch geeint durch die Regeln der geheimen Stadt, die nun ihr Leben bestimmten.
Noch immer hielt Antonia die Augen geschlossen und lauschte auf die Vogelstimmen. Wie schön wäre es, sie erkennen und zuordnen zu können, doch mit Vögeln kannte sie sich nicht aus, nur mit Pflanzen. Wann ihr Vater wohl das Herbarium schicken würde? Seit sie ihn am Morgen darum gebeten hatte, konnte sie es kaum mehr erwarten. Wenn sie schon so wenig zum Lesen und Lernen kam, würde das Sammeln und Trocknen von Pflanzen wenigstens einen kleinen Teil ihres vorherigen Lebens zurückbringen.
„Schläfst du?“
Antonia schlug die Augen auf und drehte sich zu Linde Walz um, die neben ihr lag. „Schön wär’s!“ Antonia grinste. „Dann ginge die Zeit schneller rum.“
Linde strich sich die langen rotblonden Haare hinter die Ohren und stützte sich auf einen Ellenbogen. „Du könntest versuchen, ein Buch mit hierherzuschmuggeln, so wie Gertie das macht.“
„Was mach ick?“, fragte eine Frau um die fünfzig mit rot gefärbten Haaren, die am Ansatz ergraut waren. Sie lag eine Reihe hinter ihnen. Als Antonia sich zu ihr umwandte, sah sie durch die Fenster der hinteren Wand spätes Sonnenlicht zwischen den Stämmen der hohen Bäume hindurchfiltern. Das dunkle Holz der Seitenwände und die weiß gestrichenen metallenen Kolonnen, die das pavillonartige Dach trugen, färbten sich rot. Auch Linde hatte sich zu Gertie Liebknecht umgedreht.
„Antonia könnte Bücher hierherschmuggeln, so wie du den Berliner Lokal-Anzeiger“, erklärte Linde. „Bei dir haben unsere Aufpasserinnen jedenfalls noch nie etwas gemerkt.“
„Ha!“, rief Gertie. „So dünn, wie ick bin, müssten die schon ’ne Leibesvisite machen, um det Blatt in meinem Hosenbund zu finden.“ Sie lachte ein derbes Lachen, hörte jedoch auf, als sie stark husten musste. Sie kramte nach ihrem Blauen Heinrich.
„Was steht’n drinne in dem Käseblatt?“, fragte eine andere Mitpatientin, als Gerties Husten nachließ.
„Is aber nich von heute“, warnte Gertie sie vor. „Meine Schwester schickt mir die Blätter immer mit ’ner Woche Verspätung, und das hier is sogar schon ’n paar Wochen alt.“ Sie blätterte. „Also hier. Es jibt ’ne neue Ausbürjerungsliste. Liste Nr. 51. Lauter Zwangsausbürjerungen. Darunter ein Willy Brandt, ein Bruno Frank, ein Erich Maria Remarque …“
„Das spricht man Remark, qu wie Käse, nich qu wie Quark … kannst du kein Französisch?“, unterbrach sie die Dame von vorhin, die Gisela hieß. Doch der Name interessierte Gertie nicht die Bohne. „Warum verliert ein Franzose die deutsche Staatsbürjerschaft?“, wunderte sie sich. „Hatte der die überhaupt?“
„Gertie, das ist ein deutscher Schriftsteller“, rief Gisela in gespielter Empörung.
„Was weeß denn icke?“ Gertie lachte vergnügt. „Jetzt tu man nich so jebildet. Det is hier ’ne Volksheilstätte, wenn du wen Schlaues willst, musste nach Davos, wo se die Jutbetuchten hinschicken … obwohl, was man so hört, is det da so ’ne Wucht in den Schweizer Berjen, die müssen da nich hinjeschickt werden, die jehn da von janz alleene hin.“
„Ich hab auch noch nichts von dem Remarque gelesen“, gab Gisela zu. „Und jetzt ist es eh zu spät. Ich erinner mich an den Namen nur, weil er auf der Liste der volksschädlichen Autoren stand, von denen sie vor ein paar Jahren die Bücher verbrannt haben, und weil der Name so speziell aussah. Keine Ahnung, was der so schreibt und warum se den nich mehr haben wollen.“
„Er schreibt Bücher, in denen der Krieg als grausam geschildert wird“, mischte sich Antonia ein. „Eines davon heißt Im Westen nichts Neues.“
„Siehste, Jisela, det is wahre Bildung, wat unser Frollein Antonia da hat. Die is nich so ’n Arbeiterjör wie wir. Die is was Besseres“, verkündete Gertie gutmütig.
„Wenn dieser Herr solche Lügen schreibt, ist es auch richtig, dass das Buch und der ganze grässliche Mensch verboten wurden“, mischte sich eine hagere Fünfzigjährige mit strähnigen Haaren ein, die sonst nur selten an ihren Gesprächen teilnahm, aber offenbar gut zugehört hatte. „Mein Mann liest den Stürmer, und da steht, Kriege liegen in der Natur der Dinge. Alle Lebewesen auf dieser Erde kämpfen um ihren Lebensraum. Da ist es doch nur natürlich, dass wir Menschen das ebenfalls tun. Aber grausam müssen sie ja nicht unbedingt sein, zumindest nicht für die, die gut vorbereitet sind. Deutschland wird jedenfalls keinen Krieg mehr fürchten müssen, dafür hat unser Führer gesorgt. Das sagt auch mein Mann, und der muss es wissen, er ist nämlich in der Partei, und das nicht erst seit gestern. Ein Mann der ersten Stunde ist mein Eduard.“ Mehrere Frauen murmelten Zustimmung, andere schüttelten leicht den Kopf, wagten aber keine Widerrede.
Gisela legte sich wieder hin, und Gertie verschanzte sich hinter ihrem Berliner Lokal-Anzeiger. In diesem Moment erklang der Gong, die letzte Liegekur des Tages war zu Ende. Erleichtert schlugen die Frauen die Decken zurück.
Linde hielt die Hand in militärischem Gruß an die Stirn. „Alle die Fieberthermometer rausholen … anlegen … messen … los.“
„Jawoll“, antwortete Antonia mit derselben Stimme. Sie mussten beide lachen.












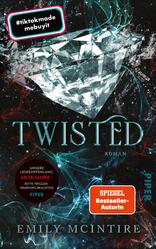
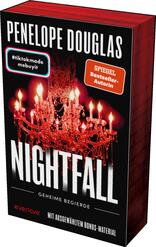








Inhalt: 1938 – während ihres Biologiestudiums wird Antonia mit Tuberkuloseverdacht in die hochmoderne Lungenklinik Heilstätten nach Beelitz geschickt. Die strengen Tagesabläufe sind sehr mühselig, zumal sich keine Symptome zeigen. Doch die Freundschaften zwischen den kranken Frauen dort und dem Assistenzarzt Henrik bieten etwas Ablenkung. Doch die Einflüsse durch die Nationalsozialisten machen auch vor der Klinik nicht halt und schon bald gibt es gespaltene Lager und Intrigen. Als Antonia sich ihr Studienfach gegen Medizin tauscht, wird ihre Hilfe schon bald in der überfüllten Klinik gebraucht. Aber der Krieg bringt massive Veränderungen… Die Geschichte um die Lungenheilanstalt, die von der Berliner Landesversicherungsanstalt für Patienten mit Lungentuberkulose gebaut wurde und auch der ärmeren Bevölkerung Möglichkeit bot, sich von der schlimmen, damals noch unheilbaren Krankheit zu erholen und Kraft zu tanken hat mich total fasziniert. Die Verläufe der Erkrankung, ebenso wie die Anwendungen sind in eine lebendige, bewegende Geschichte eingebaut, weil es hier um persönliche, wenn auch fiktive Schicksale geht, die mir sehr nahe gegangen sind. Viele von ihnen sind mit Beginn des Nazi Regimes der Willkür der neuen Verordnungen ausgeliefert gewesen, die auch mit anderen Einrichtungen zu tun hatten teils unter schockierenden geheim gehaltenen Abläufen. Wieder mal hat es die Autorin geschafft, die Leser auf eine interessante Reise zu nehmen, die zu unserer Geschichte gehören, die zeigen, wozu Menschen imstande sind, die sich von falschen Vorstellungen und Versprechen mitreißen lassen. Ich hab einiges dazugelernt und mit der Mischung aus Fiktion und historischen Begebenheiten ist hier ein wundervoller, einfühlsamer, aber auch zerreißender Roman entstanden, den man nicht so schnell vergisst. Viel Spannung und Abwechslung wird durch die vielen verschiedenen Charaktere reingebracht. Jeder von ihnen hat eine eigene Geschichte, in die man einen Blick werfen darf. Es werden Gefühle und Emotionen geweckt, die einen ordentlich durchrütteln. Es gibt trotz aller Tragik und Dramatik auch etliche lustige Momente, Augenblicke, bei denen man mit den Tränen kämpft und auch die eingebundene Liebesgeschichte ist toll abgestimmt und genau passend. Trotz etwas vorhersehbarer Entwicklung, ein paar kleineren Längen und einem überraschenden, etwas gerafften Abschluss hat dies die Lesestimmung nicht getrübt, zu sehr war man gefangen im Geschehen und wollte nun auch wissen, wie alles ausgeht. Ein lesenswerter Roman, der viele Schicksale aufgreift, die unter die Haut gehen und der zeigt, was Mut, Mitgefühl und Verständnis bewirken können.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.