

Bis es für immer ist Bis es für immer ist - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein ergreifender London-Roman über das Suchen und Finden der großen Liebe„Den Schreibstil der Autorin fand ich sehr angenehm und flüssig“ - victorias_bibliophilie
Bis es für immer ist — Inhalt
Was, wenn du deiner großen Liebe immer zur falschen Zeit begegnest?
Als die schüchterne Jen 1986 im College auf den coolen Nick trifft, glaubt sie nicht, dass aus ihnen mehr werden kann als gute Freunde. Seither haben sich die beiden schon unzählige Male aus den Augen verloren – und dann zufällig wiedergetroffen. Dass es für beide Liebe auf den ersten Blick war, haben sie einander nie gesagt. Und es scheint, als würden sie den richtigen Moment dafür immer verpassen: Mal sind sie in Beziehungen, mal jagen sie anderen Träumen hinterher, mal kommt es zwar zu einem Kuss, doch kurz danach auch zu einem Streit. Erst als 2005 ein Anschlag London erschüttert und beide sich auf die Suche nacheinander begeben, erkennen sie, dass sie jetzt endlich bereit füreinander sind.
Die Großstadt London: Neun Millionen Menschen, 270 U-Bahn-Stationen. Jeden Tag Tausende von Begegnungen, aber nur eine mit einem so schönen Happy End!
Nach „Zusammen sind wir einmalig“ legt Sarra Manning mit „Bis es für immer ist“ eine neue herzergreifende, romantische und tief berührende Liebesgeschichte vor, die nicht nur London-Fans begeistern wird!
„Eine absolut perfekte Liebesgeschichte voller Zärtlichkeit, Humor und großer Sehnsucht. Ich habe jedes einzelne Wort dieser wunderschönen, epischen Geschichte über verpasste Verbindungen und zweite Chancen geliebt.“ Rosie Walsh
„Sarra Mannings atemberaubendes, wunderschön geschriebenes Buch ist nicht nur eine Liebeserklärung an London, sondern auch an das, was im Leben wirklich zählt: die Liebe. Witzig, klug und herrlich romantisch: ›Bis es für immer ist‹ ist die perfekte Lektüre, um Sie selbst an den regnerischsten Tagen zum Lächeln zu bringen.“ Katy Birchall
„Ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann – brillant ausgearbeitet, mit Charakteren, die sich wie Freunde fürs Leben anfühlen. Schön, romantisch, echt, ergreifend, nostalgisch und absolut fesselnd. Ich liebe dieses Buch von ganzem Herzen.“ Alex Brown
„Dies ist schon jetzt eines meiner Bücher des Jahres! Ein sehr besonderes Buch: eine jahrzehntelange ›Beinahe‹-Liebesgeschichte, die mich an ›Zwei an einem Tag‹ erinnert. Es ist großartig, echt, glaubwürdig und einfach schön.“ Marian Keyes
„Die Lektüre von ›Bis es für immer ist‹ hat mich wieder daran erinnert, warum Sarra Manning eine meiner Lieblingsautorinnen ist. Der Roman ist wundervoll: romantisch, sexy, bewegend, so dass man ihn gar nicht mehr aus der Hand legen kann.“ Louise O'Neill
„Liest sich wie ein Liebesbrief an die Stadt London, die den Hintergrund für einen Großteil der Geschichte bildet. Mit zwei fesselnden Hauptfiguren ist der Roman romantisch, bewegend und unmöglich aus der Hand zu legen. Wenn Sie David Nicholls‘ ›Zwei an einem Tag‹ geliebt haben, wird Sie dieses Buch begeistern.“ Daily Mirror
„Witzig, temporeich und wunderbar unterhaltsam, mit einer Heldin, die man wirklich gern hat.“ Daily Mail
„Ich habe diese fabelhafte und authentische Geschichte abgöttisch geliebt.“ Prima
„Wir waren von dieser schönen, nostalgischen Liebesgeschichte begeistert.“ Fabulous
„Die Beschreibungen Londons in den 1980er Jahren bis hin zur Gegenwart, die Stadtteile, die Musik, die Kleidung, sind in diesem Roman wunderbar gelungen.“ Good Housekeeping
„Sarra Manning schreibt in dieser kraftvollen, intimen und absolut fesselnden Liebesgeschichte direkt aus dem Herzen.“ Woman’s Own
Leseprobe zu „Bis es für immer ist“
Teil 1
1986
1 9. September 1986 U-Bahn-Station High Barnet
High Barnet war das Ende. Das Ende der Northern Line. Obwohl es sich eigentlich anfühlte wie der Beginn. Der Beginn des Nirgendwo. Es befand sich im Grunde nicht einmal mehr in London.
Jen, die gerade den steilen Hügel von der U-Bahn-Station nach oben stapfte, war eine stolze Londonerin. Die Stadt definierte, wer sie war – genau wie ihre blauen Augen und die Tatsache, dass sie, abgesehen von Tomaten und Gurken, kein Gemüse aß. Wobei ihr Dad meinte, Tomaten wären Obst, und ihre Mutter ihr erklärt [...]
Teil 1
1986
1 9. September 1986 U-Bahn-Station High Barnet
High Barnet war das Ende. Das Ende der Northern Line. Obwohl es sich eigentlich anfühlte wie der Beginn. Der Beginn des Nirgendwo. Es befand sich im Grunde nicht einmal mehr in London.
Jen, die gerade den steilen Hügel von der U-Bahn-Station nach oben stapfte, war eine stolze Londonerin. Die Stadt definierte, wer sie war – genau wie ihre blauen Augen und die Tatsache, dass sie, abgesehen von Tomaten und Gurken, kein Gemüse aß. Wobei ihr Dad meinte, Tomaten wären Obst, und ihre Mutter ihr erklärt hatte, dass Gurken größtenteils aus Wasser bestanden und so gut wie keine Nährstoffe enthielten, weshalb sie lieber einmal eine Zucchini probieren sollte, die reich war an Vitamin C und Kalium. Worauf Jen erwidert hatte, dass sie genauso gut eine Orange essen konnte, wenn sie Vitamin C brauchte (ihre streitlustige Art definierte sie ebenfalls.)
Jen stellte sich gerne vor, dem Hexenkessel der Londoner Innenstadt und den schmierigen Gassen Sohos entstiegen zu sein. Die traurige Wahrheit war jedoch, dass sie in der Vorstadt aufgewachsen war. Mill Hill hatte zwar eine Londoner Postleitzahl, doch die Doppelhaushälfte, in der sie mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihren nervtötenden Zwillingsbrüdern wohnte, befand sich praktisch in der allerletzten Straße Londons, bevor Hertfordshire begann.
Und obwohl sie in London aufs College hätte gehen können, hatte sie beschlossen, das Abi am Barnet College zu machen. In Hertfordshire. Wobei diese Kleinigkeit sie nicht definieren würde.
Jen hatte während der Sommerferien so einiges beschlossen, und es hatte alles mit dem Vorsatz zu tun, zu einem neuen Menschen zu werden.
Zum Beispiel nannte sie sich nicht mehr Jennifer, sondern Jen.
Jen.
Es klang kompromisslos und gleichzeitig geheimnisvoll. Drei Buchstaben, die die Welt versprachen (zumindest hoffte Jen, dass es vielleicht so sein könnte).
In ihrem Jahrgang hatte es sieben Jennifers gegeben, und sie wurden alle Jenny genannt, ob es ihnen nun gefiel oder nicht. Für ihre Klassenkameraden war sie Jenny R gewesen, und die Zicken, die ihr die Schulzeit – die allgemein doch als die schönste Zeit des Lebens galt – zur Hölle gemacht hatten, hatten sie Jenny Rotschopf gerufen. Dabei waren ihre Haare nicht einmal rot. Die Farbe nannte sich Kastanienbraun. Dunkles Kastanienbraun. Es war allerdings nicht einfach gewesen, die fünf Zicken auf derart feine Unterschiede hinzuweisen, während sie Jen durch die nach Desinfektionsmittel und gekochtem Fleisch stinkenden Flure jagten. Während Jen zitternd und nur mit einem Handtuch bekleidet nach dem Sportunterricht in der Umkleide stand und sie ihren Namen skandierten. Oder während sie Jen an der Bushaltestelle in die Ecke trieben.
Kein Wunder, dass Jen sich alles Wissenswerte zum Thema „rheumatoide Arthritis“ angeeignet hatte, um anschließend ihre Sportlehrerin davon zu überzeugen, dass ihre Knie langsam zerbröselten und sie ihre Zeit anstatt beim Ballspielen besser in der Schulbibliothek mit einem Buch verbrachte.
Aber das gehörte der Vergangenheit an. Die Schulzeit war nur noch eine entfernte Erinnerung. Eine Ansammlung unangenehmer Zwischenfälle, die Jen in eine Handvoll Anekdoten verwandeln würde, die nichts von dem Schmerz und der Einsamkeit in den ersten Jahren ihrer Teenagerzeit erahnen ließen.
Jetzt konnte Jen die Person sein, die sie bereits versuchsweise an den Wochenenden oder innerhalb der vier Wände ihres winzigen Zimmers in dem kleinen Pseudo-Tudor-Haus gewesen war, wo ihr Leben von dem ständigen Rauschen des Verkehrs auf der Autobahn am anderen Ende des Gartens begleitet wurde, hinter der sich schließlich auch noch die Bahngleise erstreckten.
Jen hatte ihr neues Ich nach den Büchern geformt, die sie so sehr liebte – angefangen bei Ballettschuhe bis zu Die Glasglocke –, und nach all den Songs, die sie unter der Bettdecke auf ihrem blechernen Transistorradio in der John Peel Show gehört hatte. Doch so richtig das Licht der Welt erblickt, hatte die neue Jen erst vor ein paar Tagen auf einer Shoppingtour, die sie sich von ihrem Ersparten geleistet hatte, das sie beim Babysitten und während des Sommerjobs in einem Copyshop in Edgware verdient hatte. Und von dem einmaligen Klamottenzuschuss ihrer Eltern, die genau wussten, dass sie mit ihrem ältesten Kind und einzigen Tochter den genetischen Jackpot geknackt hatten. Klar war Jen streitlustig und hatte schon in einem bedenklich jungen Alter begonnen, aus dem Zimmer zu stürzen, die Treppe hochzustapfen und die Tür hinter sich zuzuknallen, aber mehr gab es nicht zu beklagen. Sie tolerierte Martin und Tim, ihre jüngeren Brüder, sie kam direkt nach der Schule nach Hause, begann nach den Hausaufgaben mit der Zubereitung des (gemüsefreien) Abendessens, und nachdem sie bisher ohnehin keine echten, bedeutsamen Freundschaften geschlossen hatte, ging sie selten aus. Gruppenzwang war ihr fremd, und so hatte Jen noch nie Alkohol getrunken oder eine Zigarette geraucht, hing nicht mit Jungs im Park oder am Bahnhof ab und ließ sich auch nicht von besagten Jungs schwängern.
Aus all diesen Gründen hatte ihre Mutter nur kaum hörbaren Widerspruch eingelegt, als Jen ihr die – ihrer Meinung nach – essenzielle College-Grundausstattung präsentierte: eine Levi’s 501, die sie zwei Mal aufschlug, damit ihre neuen schwarzen Dr.-Martens-Stiefel mit den berühmten acht Löchern besser zur Geltung kamen; zwei gestreifte T-Shirts und mehrere wild gemusterte Röcke und Kleider aus dem Secondhand-Laden, die ihre Großmutter gekürzt hatte, sodass sie an der magischen Stelle zwischen dem Knie und der Mitte des Oberschenkels endeten; eine ausgeleierte, viel zu große Strickjacke aus irischer Schafswolle, die sie aus Dads Kleiderschrank gemopst hatte; und einen klassischen Crombie-Mantel aus Dads Teenagertagen. Abgerundet wurde ihre Verwandlung von einer umfassenden Auswahl an Make-up aus der Drogerie (die Schminkköfferchen aus dem Kaufhaus, die sie jedes Jahr zu Weihnachten bekam, hatten ausgedient) und den üblichen Notwendigkeiten, wie Stiften, Notizbüchern und Heftmappen.
Jen stapfte an einem Fish-&-Chips-Laden, dem Gerichtsgebäude und einem Zeitschriftenshop vorbei. Sie trug ihre neuen Dr. Martens, die Levis, ein Smiths-T-Shirt und die Strickjacke und begann langsam zu schwitzen. Die dicke, schwere Wolle war zu warm für Anfang September, doch Jen wollte einen aufsehenerregenden ersten Eindruck hinterlassen. Immerhin war heute der erste Tag ihres restlichen Lebens. Sie hatte die Schule hinter sich gelassen, und vor ihr lag das freie, ungezwungene Collegeleben. Keine Stundenpläne, kein Klassenbuch und niemand, der zu brüllen begann, wenn jemand den Flur entlanglief.
Es war ein vollkommener Neuanfang. Zumindest sollte es das sein, denn als sich eine Stunde später die Studentinnen und Studenten des Abi-Vorbereitungskurses zum Thema Englische Literatur in einem Zimmer im Erdgeschoss des Hauptgebäudes einfanden, hatte Jen das Gefühl, unsichtbar zu sein. Niemand schien sie zu bemerken, dabei hatte sie absichtlich eine französische Ausgabe von Bonjour Tristesse vor sich platziert. Sie hatte das Buch in einem Secondhand-Laden in Paddington entdeckt, und obwohl sie bei der Mittleren Reife in Französisch eine Zwei bekommen hatte, tat sie sich schwer damit. Außerdem hatte es wenig Sinn, Bonjour Tristesse auf Französisch zu lesen, wenn niemand Jen dabei beobachtete und sich dachte: O Gott, was für eine mysteriöse, faszinierende und coole junge Frau. Ich muss mich sofort mit ihr anfreunden!
Im Gegensatz zur Schule, wo altmodische Tische mit Aussparungen für Tintenfässchen und aufklappbaren Tischplatten in geschlossenen Reihen standen, waren die Tische und Stühle hier hufeisenförmig angeordnet, und ihre Dozentin (es gab jetzt keine Lehrer mehr) stand in der Mitte. Es gab zwanzig Studentinnen und Studenten, zwei an jedem Tisch, und Jen saß neben Miguel, einem muskulösen Jungen mit brauner Haut und lässigem, amerikanischem Akzent, der sich von ihr weggedreht hatte, damit er und seine Freunde am Nachbartisch besser aufeinander herumhacken konnten.
Jen hielt den Blick gesenkt und konzentrierte sich auf das zweite Buch, das sie mitgebracht hatte. Eine Sammlung englischer Lyrik von 1900 bis 1975. In den Einführungsunterlagen, die alle Studenten zugeschickt bekommen hatten, hatten sie die Aufgabe bekommen, sich ein Gedicht aus der Sammlung auszusuchen, das sie persönlich ansprach.
Jen stützte das Kinn auf die Hand und lauschte ihren Kommilitonen, von denen sich viele für die rhythmischen Reime von John Betjemens A Subaltern’s Love Song entschieden hatten, das offenbar gerade besonders populär war. Rob, ein knochiger Junge mit wulstigen Lippen und Haartolle, rezitierte This Be The Verse von Philip Larkin, obwohl es nicht zur Sammlung gehörte, weil es ihn daran erinnerte, „dass meine Mum und mein Dad es ebenfalls mit mir verkackt haben“.
Jen knetete unter der Tischplatte nervös ihre Hände, während ein hübsches Mädchen auf der anderen Seite des Zimmers mit atemloser, fesselnder Stimme Die Brandparole aus T. S. Eliots Das wüste Land vortrug. Vermutlich hatte sie auch den Theaterkurs belegt, eine Richtung, zu der sich Jen ungemein hingezogen fühlte, auch wenn sie lieber aus dem Fenster gesprungen wäre, als auf der Bühne ein Gedicht vorzutragen.
„Jen, was hast du für uns?“
Nun war Jen an der Reihe. Sie schob ihren Stuhl zurück und erhob sich vor neunzehn desinteressierten Kommilitonen und unter dem leidgeprüften Blick ihrer Dozentin Mary. Mary war Mitte zwanzig, trug ein fließendes Blumenkleid und hatte ihnen bereits ausführlich von ihrem Freund erzählt, womit sie die Art von Semi-Autoritätsperson darstellte, der Jen echten Respekt entgegenbringen konnte.
„Lady Lazarus von Sylvia Plath.“ In ihren Gedanken rezitierte Jen das Gedicht voller Inbrunst, nüchtern betrachtet wollte sie es nur so schnell wie möglich hinter sich bringen, ohne Aufsehen zu erregen. Vor allem, als Mary die Lippen aufeinanderpresste, als wollte sie ein Grinsen unterdrücken, das gut zu dem Funkeln in ihren Augen gepasst hätte. Als gäbe es jedes Jahr ein auf Bücher versessenes Mädchen, das sich nicht integrieren konnte und dachte, Sylvia Plath hätte mit dem Gedicht zu ihr – und zwar ausschließlich zu ihr – gesprochen. Als wäre Jen nichts Besonderes.
Trotzdem war Lady Lazarus Jens Lieblingsgedicht und Sylvia Plath ihre Lieblingsschriftstellerin, und während sie las, wurde ihre Stimme lauter und klarer und bebte vor Gefühl. Nicht nur wegen der Geschichte der Verfasserin, der so viel Unrecht widerfahren war, dass sie sich wenige Monate nach der Fertigstellung das Leben genommen hatte, sondern auch, weil es so emotionsgeladen und anstrengend war, ein sechzehnjähriges Mädchen zu sein. Außerdem hatte Jen rotes Haar und gab wie Sylvia Plath eine tragische Figur ab.
Nachdem sie geendet hatte, herrschte sieben Sekunden lang Stille (Jen zählte in Gedanken mit), dann meinte Mary: „Sehr schön“, und spitzte die Lippen, als müsste sie ein weiteres Grinsen unterdrücken. Jen ließ sich auf den Stuhl fallen, und nachdem sich der Boden nicht auftat, um sie zu verschlucken, legte sie die Ellbogen auf den Tisch und beugte sich darüber, bis der Großteil ihres Gesichts hinter ihren Händen verborgen war.
Jen aß keineswegs Männer, wie es in dem Gedicht hieß – nicht einmal ansatzweise. Sie sah keinen Sinn darin. Stattdessen griff sie nach einer Haarsträhne, um darauf herumzukauen. Es war eine nervöse Angewohnheit, die sie nie ganz losgeworden war.
Es blieb nur noch ein Student übrig, der sein Gedicht vortragen sollte, und er hieß …
„Nick?“, fragte Mary. „Du warst letzte Woche nicht bei der Orientierungsveranstaltung.“
„Nein“, stimmte Nick ihr zu.
Jen war so mit den Gedanken an ihren bevorstehenden Vortrag, dem anschließenden Zusammenbruch über der Tischplatte und der Haarsträhne in ihrem Mund beschäftigt gewesen, dass der Junge ihr nicht aufgefallen war. Doch jetzt sah sie nichts anderes mehr. Es war, als hätten alle anderen Anwesenden aufgehört zu existieren. Sie waren bloß Füllmasse. Unbedeutende Hintergrundgeräusche.
Nick war groß und dürr, hatte die schlaksigen Arme vor der Brust verschränkt und die langen Beine von sich gestreckt. Er trug eine Lederjacke – eine richtige Lederjacke wie James Dean auf der Postkarte, die in Jens Zimmer hing –, enge Jeans und spitz zulaufende Stiefel. Seine dunklen Haare waren lang genug, dass er sie mit den Fingern aus dem Gesicht streichen konnte, und die darunterliegenden Wangenknochen waren so geometrisch, wie Lloyd Cole es in Perfect Skin besang. Er hatte einen kleinen Leberfleck rechts über dem Mund, und nur ein kurzer, aber alles umfassender Blick genügte Jen, um zu wissen, dass sie ihre Lippen für alle Ewigkeit auf seine pressen wollte.
Sie wandte sich mit glühenden Wangen ab, obwohl ohnehin niemand auf sie achtete. Alle hatten nur Augen für Nick. Weil er Schönheit und Gefahr in sich vereinte. Und weil er mit Mary debattierte, obwohl sie eine Semi-Autoritätsperson war.
„Was, wenn mich kein Gedicht direkt angesprochen hat?“, wollte er wissen und hielt sich das Buch ans Ohr, als wäre es eine Muschel und er wollte das Meer rauschen hören.
„Dann würde ich sagen, dass du dir nicht genügend Mühe gegeben hast“, erwiderte Mary, und Jen fühlte sich in ihrer Vermutung bestätigt, denn sie spitzte erneut die Lippen, als wäre das – ein hübscher, vorlauter Junge, der mit ihr über die vorgegebenen Texte stritt – ebenfalls etwas, womit sie sich jedes Jahr herumschlagen musste.
Vielleicht spielte sie Studenten-Bingo mit den anderen Dozenten: Ja, ich hatte eine Sylvia Plath. Fünf Punkte für mich. „Wie wäre es mit Louis MacNeice? In einigen Jahren wirst du womöglich zu schätzen wissen, was er …“
„Aber jetzt ist nicht in einigen Jahren.“ Nick legte das Buch nieder und griff unter den Tisch, um seinen Gettoblaster hervorzuholen. „Es gibt noch andere Arten von Poesie. Ich mache den Mal an, ja?“
Er wartete nicht auf Marys Antwort – ein amüsiertes „tu, was du nicht lassen kannst“ –, sondern stand auf und sah sich nach der nächsten Steckdose um. Sie befand sich direkt hinter Jen, die sich zwang, sich nicht umzudrehen, auch wenn der Rest der Klasse kein Problem damit hatte, Nick ungeniert zu beobachten, während er sein Gerät an den Strom anschloss.
Jen fragte sich, was diesem Jungen aus der Seele sprach. Allen Ginsberg, vielleicht? Nein! Er war eher ein Rimbaud-Typ. Oder vielleicht Baudelaire. Aber warum las er dann nicht einfach ein Gedicht vor, wie alle anderen auch?
Es klickte laut, als er den Wiedergabeknopf nach unten drückte, dann folgten ein Knistern und Zischen, und ein Tambourin gab den Takt vor, bis vertraute, sanfte Akkorde erklangen, die Jen nur allzu gut kannte, und eine Frau mit starkem deutschen Akzent zu singen begann.
Es war I’ll Be Your Mirror, der dritte Song auf der zweiten Seite des Albums von The Velvet Underground & Nico. Ein Liebeslied, das von einem Menschen handelte, der alles sieht, was du vor der Welt verbirgst, und genau das liebt. Der dich liebt …
Jen wandte sich auf ihrem Stuhl herum und sah zu Nick, der immer noch neben dem Gettoblaster hockte, den Takt auf dem Knie mitklopfte, und dessen Haare den Großteil seines Gesichts verdeckten. Sie seufzte leise, und er sah auf, als hätte der sanfte Windstoß ihres ausgestoßenen Atems ihn erreicht. Sein Blick blieb an Jens Gesicht hängen, und sie konnte sich nicht von ihm lösen, bis Miguel sich zur Seite drehte und sich den Ellbogen an der Tischplatte stieß.
Miguel fluchte, und der Song war zu Ende. Nick sah Jen mit hochgezogenen Augenbrauen herausfordernd an, und der Moment war vorüber.
Jen wünschte, er hätte nie stattgefunden.
„Das war’s für heute. Bis Montag will ich zwei Seiten über das von euch gewählte Gedicht“, verkündete Mary, während die Studenten ihre Unterlagen und Stifte zusammensuchten und die Bücher in die Taschen stopften. „Rob, Nick – von euch bekomme ich zwei Seiten über ein Gedicht aus dem vorgegebenen Buch.“
Jen huschte zur Tür hinaus und zog sich in die Sicherheit der Mädchentoilette zurück. Zwischen den Kursen war hier einiges los, doch sie leerte sich schnell, sodass sie einen Blick in den Spiegel werfen konnte. Sie experimentierte gerade mit einem grünen Korrekturstift, um die rote Haut im Gesicht zu kaschieren, doch sie bekam es nie richtig hin, sodass sie immer ein wenig grün um die Nase war. Was ein wenig Puder allerdings schnell beheben konnte. Jen betupfte ihre Wangen mit dem hellsten Puder, den sie in der Drogerie auftreiben hatte können, doch ihr starrte immer noch ein rotes Mondgesicht entgegen. Sie nahm noch mehr Eyeliner und mehr Mascara und war sich nicht sicher, welchen Effekt sie erzielen wollte. Sie wusste nur, dass sie ihn noch nicht erreicht hatte.
Sie trug gerade etwas von ihrem matten, fliederfarbenen Lippenstift auf, als die Tür aufging und das Mädchen eintrat, das Das wüste Land vorgetragen hatte. Ihr Blick fiel auf Jen, und sie hielt inne, als hätte sie nicht erwartet, Jen hier auf der Toilette und vor dem Spiegel anzutreffen. Sie nickte ihr kurz zu, und Jen wartete, bis sie in der Kabine verschwunden war, dann drehte sie den Wasserhahn auf, damit es für sie beide nicht zu peinlich wurde.
Jen wollte so schnell wie möglich verschwinden, doch sie wurde von einem Klecks verschmierter Mascara und einer Stimme aufgehalten, die aus der Kabine drang: „Also … was hältst du von der Sache?“
Es kam Jen falsch vor, ein Gespräch zu beginnen, während man auf der Toilette saß. Wenn Jen mit ihrer Großmutter in der Innenstadt war und sie eine Kaufhaustoilette aufsuchten, unterhielt sie sich jedes Mal schreiend mit Jen, und Jen war es jedes Mal schrecklich peinlich.
„Von welcher Sache?“, fragte Jen, während die Toilettenspülung rauschte.
„Von diesem Kerl. Nick.“ Die Kabinentür öffnete sich, und die Blicke der beiden Mädchen trafen sich im Spiegel. „Er ist so überheblich. Und was war das überhaupt für ein Song?“
„I’ll Be Your Mirror von The Velvet Underground. Er ist auf dem Album mit der Banane auf dem Cover“, erklärte Jen.
Das Mädchen schüttelte den Kopf, als könnte sie es nicht glauben. Sie trug ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil, schwarze Levi’s 501 und niedrige schwarze Dr. Martens. Die glänzend schwarzen Haare waren zu einem wippenden Pferdeschwanz gebunden, und ihre riesigen, dunkelbraunen Rehaugen brauchten keine Unmengen an Mascara und Eyeliner.
„Noch nie von denen gehört“, meinte sie herablassend über die Band, auf die andere Bands in Interviews regelmäßig Bezug nahmen. Jen hatte anfangs erwartet, dass die Songs laut, überladen und ohne richtige Melodie sein würden, doch dann hatte sie fünf Pfund riskiert, die sie bekommen hatte, um sich zum Geburtstag eine Schallplatte zu kaufen, und hatte erkannt, dass alle elf Songs auf dem Album mit der Banane auf dem Cover tief in ihre Seele drangen. Oder vielleicht auch nur zehn, nachdem ein Song den Titel Heroin trug und sie damit absolut nichts zu tun haben wollte. „Ich werde Rob fragen. Er kennt sich mit Musik aus. Anscheinend verpasst er keine Ausgabe der John Peel Show.“
Ich höre auch die John Peel Show!, schrie Jens Unterbewusstsein, doch sie nickte nur.
„Also, du hast mir noch nicht verraten, was du von ihm hältst. Von Nick, meine ich?“, fuhr das Mädchen herausfordernd fort und sah Jen erwartungsvoll an, als würde ihre Meinung Licht ins Dunkel bringen.
Jen dachte daran, wie Nick sich die Haare aus dem Gesicht gewischt hatte. An die kaum merkliche Spannung in der Luft. Und dass sie ihn nicht ansehen konnte, sich seiner aber trotzdem schmerzhaft bewusst gewesen war. Die Form des winzigen, verheerenden Leberflecks über seiner Oberlippe und die Linie seiner Wangenknochen hatten sich schon jetzt in ihr Herz gebrannt, und sie hatte noch immer den Anblick vor sich, wie die Stirnfransen seine Augen verdeckten, in deren Tiefen sie gerne versunken wäre.
„Er ist nichts für mich“, platzte sie heraus, denn es war die Wahrheit. Er sah älter aus als die anderen, und während Jen den Grund für Robs absichtlich abgefucktes, aber dennoch gutes Aussehen verstand und die Bedeutung hinter seiner Tolle und dem Smiths-T-Shirt kannte, versetzte Nick sie in Angst und Schrecken. „Solche Jungen sind … ich glaube …“
„Schrecklich überheblich?“, schlug das andere Mädchen erneut vor, aber das traf es nicht wirklich – auch wenn es der Inbegriff von Überheblichkeit war, einen Song von The Velvet Underground in einem Literaturkurs zu spielen, anstatt ein Sonett von Siegfried Sassoon vorzutragen.
Der Grund war auch nicht, dass Nick nicht in ihrer Liga spielte.
Es waren vielmehr seine Sorglosigkeit, seine Selbstverständlichkeit, seine Abgebrühtheit. Jungen wie er brachen Mädchen das Herz, und Jen hatte keine Erfahrung mit solchen Jungen. Sie hatte überhaupt keine Erfahrung mit Jungen.
Allerdings hatte sie reichlich Erfahrung mit Leuten, die sich nicht darum scherten, was andere über sie dachten. Mit den Mädchen aus der Schule, die ihr die letzten fünf Jahre ihres Lebens zur Hölle gemacht hatten. Mit ihrer Nachbarin Sue, die gegenüber wohnte und immer laut aussprach, was ihr in den Sinn kam, auch wenn es meist nur unbedeutender Tratsch über andere Leute war, die in ihrer Straße wohnten. Mit ihrem Großvater Stan, der schreckliche, vernichtende Dinge sagte, ohne jemals darüber nachzudenken, welchen Schaden sie anrichteten. Als Jen fünf war und am Strand stolz ihren ersten Bikini vorgeführt hatte, hatte Stan gemeint, sie sähe aus wie ein kleines Mastschwein, und er hatte es auch nicht zurückgenommen, als sie zu weinen begonnen und seine Frau und seine Tochter sich ausnahmsweise einmal gegen ihn aufgelehnt hatten. Kaum jemand lehnte sich jemals gegen Stan auf. So war das Leben viel einfacher. Trotzdem fragte sich Jen seit diesem Tag jedes Mal, wenn sie in einem neuen Outfit vor dem Spiegel stand, ob sie wie ein Mastschwein aussah. Und traurigerweise lautete die Antwort meistens Ja.
Jen wusste also einiges über unbedachte Menschen und wie tief sie andere verletzen konnten, weshalb sie beschlossen hatte, Nick lieber aus dem Weg zu gehen.
„Er ist einfach niemand, mit dem ich gerne befreundet wäre“, erklärte sie entschieden.
„Ich auch nicht!“ Das Mädchen musterte Jen einen Moment lang eindringlich und runzelte kaum merklich die Stirn, als ihr Blick auf den matten, fliederfarbigen Lippenstift fiel. Dann nickte sie. „Ich bin Priya. Du kannst mit uns abhängen. Komm mit!“
Jen warf sich ihre schwarze, mit Ansteckern übersäte Baumwollumhängetasche über die Schulter, während Priya ihr die Tür aufhielt und dabei so ungeduldig und genervt wirkte, als würde normalerweise ihr die Tür aufgehalten werden.
„Wen meinst du mit uns?“, fragte Jen.
Uns – das waren Priya, Rob und George, eine etwas weniger auffällige Version von Rob mit derselben Tolle und demselben Smiths-T-Shirt, aber plumper und trotzdem schmächtiger, der sie mit einem breiten Grinsen bedachte, als sie in der Collegekantine den Stuhl neben ihm herauszog.
„Was sind deine drei liebsten Smiths-Songs?“, fragte er begierig mit Blick auf die Anstecker auf Jens Tasche.
Es begann eine Diskussion über ihre Lieblingssongs und warum das Album The Queen is Dead besser war als Meat is Murder, und es war genau so, wie Jen sich das Collegeleben immer erträumt hatte. Rob hatte Jen lediglich knapp und nicht wirklich freundlich zugelächelt, als sie sich gesetzt hatte, doch kurz darauf beteiligte er sich ebenfalls an der angeregten Unterhaltung. Nur Priya sagte kaum etwas, auch wenn Jen immer wieder versuchte, sie ins Gespräch miteinzubeziehen.
„Also, neue Freundin, wie ist dein Name?“, fragte Rob, als Jen langsam zu ihrem Französischkurs aufbrechen musste, während die anderen drei noch ein wenig Zeit in der Kantine vertrödeln konnten.
„Ich bin Jen“, erklärte sie bestimmt, als hätte es nie eine andere Version ihrer selbst gegeben.
Und einfach so hatte Jen Freunde gefunden. Was sie in fünf Jahren Unterstufe nicht zustande gebracht hatte, schaffte sie am College an einem Vormittag.
In den Freistunden gingen Priya und sie in die nahe gelegene Drogerie, um auf dem Handrücken neue Lidschattenfarben auszuprobieren, oder in den winzigen Topshop, obwohl es dort wochenlang immer nur dasselbe gab. Wenn sie nicht unterwegs waren, saßen sie in der Kantine, und Priya kommentierte alles und jeden, der ihr unter die Augen kam. Sie zählte auf, wen sie mochte – es war eine sehr kurze Liste, auf der vor allem die Leute aus ihrem Kunstkurs und ein paar ausgewählte, ebenso extrovertierte Kommilitonen aus dem Theaterkurs standen –, um schließlich zu denen überzugehen, die sie nicht mochte. Wobei diese Liste wesentlich länger ausfiel, denn auf ihr standen alle Mitstudenten, die Priyas Meinung nach zu beschränkt waren, um den Abschluss zu schaffen. Darunter etwa sämtliche Mädchen mit hellen Strähnchen und stonewashed Jeans, die Tourismuskurse belegt hatten oder sich für Styling und Kosmetik interessierten, und sämtliche Jungs, die ihr Wissen in Elektrotechnik vertieften oder Klempner werden wollten, sich aufführten wie Sau und ständig lautstark miteinander in Streit gerieten.
Am häufigsten wollte Priya aber über Rob reden. Was er an diesem Tag anhatte. Was er zu ihr gesagt hatte. Wie er ausgesehen hatte, als er es gesagt hatte. Was er damit gemeint haben könnte, was er gesagt hatte. „Nicht, dass du glaubst, dass ich auf ihn stehe. Seine Lippen sind wie Gummiwürste.“
Robs Lippen hatten keinerlei Ähnlichkeit mit Gummiwürsten. Sie waren vollkommen normal. Was Jen allerdings lieber für sich behielt, denn auch wenn sie noch nie von einem Jungen geküsst worden war, war es selbst für sie offensichtlich, dass Priya sehr wohl auf Rob abfuhr.
Wenn Jen nicht mit Priya abhing, war sie mit George unterwegs. In der High Street gab es acht oder neu Secondhand-Läden, und sie statteten jedem mindestens einmal alle zwei Tage einen Besuch ab. Sie begannen mit dem Laden an der Ecke, wo sich die Verkäufer kaum dazu herabließen, mit ihnen zu sprechen, und gingen dann weiter in den Plattenladen am anderen Ende der High Street. Hier waren die Verkäufer freundlicher, und es gab einen Karton mit alten Single-Schallplatten im Sonderangebot zu sechzig Pence.
Am Ende setzten sie sich mit einem Scone und einem Becher Kaffee in den ersten Stock des Cafés auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Colleges. Jen konnte Kaffee nicht ausstehen, aber sie war mittlerweile sechzehn, und es war unerlässlich, dass sie sich daran gewöhnte, nicht nur heiße Schokolade zu trinken.
„Du siehst bei jedem Schluck so aus, als würdest du gleich zu heulen beginnen“, erklärte George immer. Doch sie war fest entschlossen, einen erwachseneren, anspruchsvolleren Geschmack zu entwickeln, und das war die fünfundsechzig Pence für den Becher bitteres Spülwasser wert, den sie jedes Mal hinunterzwang. Außerdem lenkte es Jen von George ab, der ihre Abstecher ins Café als Vorwand nutzte, um über Priya zu sprechen. Darüber, wie schön sie war und wie schimmernd und glänzend ihre Haare waren, und ob ihre Eltern sehr streng waren – denn er war zwar kein Rassist, aber indische Eltern waren angeblich konservativ, und vielleicht erlaubten sie Priya keinen Freund. Aber falls doch, glaubte Jen dann, dass George eine Chance bei Priya hatte?
„Hat sie irgendetwas zu dir gesagt?“, fragte er jedes Mal hoffnungsvoll.
Woraufhin Jen einen weiteren Schluck Kaffee nahm, aufgrund des Geschmacks das Gesicht verzog und den Kopf schüttelte. „Wir sprechen kaum über Jungs. Außer, wenn wir über die Elektrotechnikstudenten ablästern.“
Rob erwähnte sie dabei nicht, aber irgendwie musste George doch ahnen, dass er nicht derjenige war, den Priya wollte. Das musste er.
Manchmal schloss Rob sich ihnen auf ihrer Tour durch die Platten- und Secondhand-Läden an. „Hast du das etwa noch nicht gelesen?“, fragte er jedes Mal ungläubig, wenn Jen triumphierend ein Buch aus dem Drehständer im Buchladen zog, das sie gerade entdeckt hatte, ganz egal, ob es sich um Zärtlich ist die Nacht oder Das Tal der Puppen handelte. „Wow!“
„Okay, aber mir gefielen ihre alten Sachen irgendwie besser“, erklärte er immer, wenn George das schwer verdiente Geld aus seinem Wochenendjob (er arbeitete in der Krankenhauskantine und verbrachte die meiste Zeit damit, sich von seinen älteren Kolleginnen veräppeln zu lassen) für eine Single ausgab, die er am Abend zuvor in der John Peel Show gehört hatte. „Der Song ist nicht schlecht, aber irgendwie auch … du weißt schon … langweilig.“
Die vier hatten sogar ihren eigenen Lieblingstisch in der Collegekantine, direkt an der Wand in der Nähe der Kunststudenten, aber nicht so nahe, dass es aussah, als wären sie an ihnen interessiert. Obwohl sie das in gewisser Hinsicht durchaus waren. Immerhin waren die Kunststudenten älter und cooler, und falls es uncoole Kunststudenten gab, waren sie Jen noch nicht aufgefallen. Sie sah nur die Mädchen in mit Farbflecken übersäten Overalls, die Haare mit bunten Tüchern aus dem Gesicht gebunden, und die Jungs in ihren Lederjacken und den Zigaretten zwischen den langen Fingern.
Die Kunststudenten sahen alle so aus wie Nick – weshalb es Jen nicht überraschte, dass er mit ihnen abhing. Priya hatte einige wenig diskrete Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass Nick das erste Oberstufenjahr an einer Privatschule absolviert hatte, aber haushoch an den Zwischenprüfungen gescheitert war. Nun musste er das Jahr wiederholen, und das auch noch mit jüngeren Kommilitonen, die ihm nicht einmal die kleinste Gefühlsregung auf sein teilnahmsloses Gesicht zaubern konnten.
An den meisten Tagen fuhr Jen mit dem Rad zum College und brauchte dafür genau vierundzwanzig Minuten. Sie stellte es in den Ständer neben dem Eingang zum Kunstcollege, der sich auf der Hinterseite des Campus befand. Zwischen dem Kunstgebäude und dem Hauptgebäude lag eine kleine quadratische Rasenfläche, auf der immer weniger Studenten anzutreffen waren, je weiter der Herbst fortschritt und je kälter es wurde. Nur Nick und ein paar andere Jungs saßen fast jeden Tag auf der Steinmauer am Rand des Rasens und rauchten eine letzte Zigarette, bevor die Kurse begannen. Nick hielt seine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger, als wäre er es gewöhnt, sie schnell zu verstecken, wenn ihn jemand erwischte. Selbst, wenn es hier niemanden kümmerte. Man durfte sogar in der Kantine rauchen.
Jen tat ebenfalls so, als würde es sie nicht kümmern. Als ihr klar geworden war, dass sie die nächsten zwei Jahre im selben Englischkurs verbringen würde wie Nick Levene, war sie erleichtert gewesen, dass sie bereits beschlossen hatte, dass Nick genauso wenig ihr Fall war wie Erbsen und Pastellfarben. Sie würde nie auch nur ein Wort mit ihm wechseln, sondern ihn lediglich aus der Ferne bewundern. Es machte ihr nichts aus, in jemanden verschossen zu sein, dem sie niemals nahekommen würde. Es ging ihr im Gegenteil sehr gut mit dem bittersüßen Herzschmerz unerwiderter Liebe zu Jungen, mit denen sie noch nie gesprochen hatte. Wenn sie also morgens an ihm und seinen Kunst-Kumpeln vorbeihetzte, war der Grund für ihr hochrotes Gesicht lediglich, dass sie sieben Kilometer mit dem Rad gefahren war und noch keine Zeit gehabt hatte, ihren grünen Korrekturstift aufzutragen. Mehr nicht.
2
12. Dezember 1986
U-Bahn-Station Brixton
Das Collegeleben verlief auf angenehme Weise ereignislos. Jen mochte die Fächer, die sie für die Abi-Vorbereitung ausgewählt hatte, und es gefiel ihr, dass sie Freunde hatte, mit denen sie auch nach dem Unterricht und sogar am Wochenende Zeit verbrachte, wenn sie nicht gerade beim Babysitten war. Sie mochte ihr Leben, und sie genoss, dass sie nicht mehr jeden Tag mit einer Angst im Bauch aufwachte, wie in den Jahren, als sie noch zur Schule gegangen war.
Ja, alles war super – bis The Smiths ankündigten, dass sie ein Konzert in der Brixton Academy geben würden.
Feldzüge erforderten sicherlich weniger Planung als der Abend mit The Smiths in der Brixton Academy. Nach hitzigen Diskussionen wurden George und Rob mit der Aufgabe betraut, am ersten Tag des Vorverkaufs nach Brixton zu fahren und Karten zu besorgen. Danach verbrachten Jen und Priya Ewigkeiten damit, ihre Outfits zusammenzustellen, wobei sie sich am Ende für eine etwas ausgefallenere Version dessen entschieden, was sie auch sonst trugen: ein Kleid im Blumenmuster, schwarze Strumpfhosen und Dr. Martens. Feiner ging es nicht – und feiner würde dort niemand aussehen.
Am Tag des Konzerts – dem 12. Dezember im Jahre des Herren 1986, der sich für immer in ihr Herz brennen würde – wollten Jen und George so früh wie möglich zur Brixton Academy, um in den Saal zu rauschen, sobald die Türen sich öffneten, bis vor die Bühne zu sprinten (wo sie einen Platz für Priya und Rob freihalten würden, die zu versessen auf ihren Theaterdozenten waren, um früher abzuhauen) und dort Wurzeln zu schlagen, ganz egal, was passierte. „Vielleicht schaffen wir es nach dem Gig sogar auf die Bühne“, überlegte George, als sie das College um die Mittagszeit verließen. Sie hatten noch nie einen Kurs geschwänzt, aber eine versäumte Geschichtsstunde würde ihnen kaum nennenswerte Nachteile einbringen, wenn sie in achtzehn Monaten ihre Prüfungen ablegten.
Während der U-Bahn-Fahrt unterhielten sie sich über das Konzert. Welche Songs sie spielen würden. Ob vielleicht sogar ein neuer Song vorgestellt werden würde. Ob es stimmte, dass Johnny Marr seine wundervollen, von Gott gegebenen und genialen Hände bei einem Autounfall verletzt hatte und vielleicht nicht Gitarre spielen konnte. George versuchte, das Gespräch auf Priya zu lenken, doch Jen unterbrach ihn eilig. Erst am Vortag hatte ihr Priya bei der Übergabe des Übernachtungsrucksackes (Priyas Dad würde sie nach dem Gig abholen, und Jen durfte bei ihr übernachten) in Form eines langen Monologes erklärt, dass George ihr „langsam wirklich auf die Nerven“ ging. „Er starrt mich andauernd an. Ich bin nicht eingebildet, Jen, aber er spielt auf keinen Fall in meiner Liga.“
„Ja, schon klar“, hatte Jen unverbindlich geantwortet, denn falls Priya tatsächlich so dachte, war es ihre Aufgabe, es George zu verklickern. Jen würde nicht den Boten für sie spielen. Für den Boten gingen solche Geschichten nie gut aus.
Als George also mit seiner Schwärmerei begann, boxte Jen ihn in die Seite und deutete auf das andere Ende des U-Bahn-Waggons. „Ist das nicht einer von Jesus & Mary Chain?“
Georges Kopf fuhr herum, und seine Augen begannen zu leuchten. Doch dann stieß er ein enttäuschtes Seufzen aus. „Nein. Das ist nur jemand, der Jesus & Mary Chain echt sehr, sehr gerne mag.“
Als sie kurz vor zwei Uhr mittags in Brixton ankamen, waren sie beide in höchster Alarmbereitschaft. Erstens, weil sie sich in Südlondon befanden und sich hier beinahe genauso fremd fühlten wie im Ausland, und zweitens, weil es im Vorjahr Krawalle gegeben hatte und sie Angst hatten, dass einige Leute an einem kalten Winternachmittag um zwei Uhr nichts Besseres zu tun hatten, als Molotowcocktails auf die Straße zu werfen. Doch die gab es nicht. Sie sahen nur die üblichen Passanten, die in jedem Londoner Stadtteil die High Street bevölkerten. Alte Frauen, die mit Einkaufstrolleys den Bürgersteig entlangschlurften, zwei Männer, die lautstark ihre Obst- und Gemüsestände bewarben – „Sechs Orangen für ein Pfund! Herrliche Äpfel! Holt euch eure Tomaten fürs Abendessen!“ –, und eine Schar rangelnder Jungen in Schuluniformen.
George hatte nicht nur Angst vor Krawallen gehabt, sondern auch befürchtet, dass er die Brixton Academy nicht wiederfinden würde, dabei befand sie sich direkt vor ihrer Nase. Er wollte sich schon mal in die Schlange vor dem Eingang stellen, doch Jen erklärte ihm, dass sie noch nicht wirklich lang war und die Türen sich erst in einer Ewigkeit öffnen würden, was bedeutete, dass sie viel zu lange warten mussten. Er ließ sich überreden, noch eine Kleinigkeit zu essen, wobei er Jen warnte, nichts zu trinken, damit sie nachher nicht auf die Toilette musste.
„Jungs sind da anders“, erklärte er ihr, während er mit schmalen Augen beobachtete, wie sie an ihrem Orangensaft nippte, den sie zu ihrem Hamburger (kein Ketchup, keine Gurke, kein Salat) und den Fritten bekommen hatte. „Wir sind wie Kamele. Wir können es ewig aushalten.“
Für jemanden, der rumgezickt hatte, weil Jen vor dem Konzert noch etwas essen wollte, haute George ordentlich rein, nahm sogar noch eine Nachspeise und schwemmte alles mit literweise Cola hinunter.
Als sie fertig waren, ging Jen auf die Toilette, obwohl sie nicht musste, während George ungeduldig das Gesicht verzog und auf die Uhr schaute. Offenbar hatte er keine Großmutter, die ihm die Vorteile eines vorsorglichen Toilettenbesuchs erklärt hatte.
Schließlich reihten sie sich in die Schlange ein, die sich mittlerweile um das Gebäude herum gebildet hatte. George versuchte abzuschätzen, wie viele Leute vor ihnen waren und ihre Pläne, direkt vor der Bühne zu stehen, zunichtemachen würden, und Jen zitterte, weil sie keinen Mantel dabeihatte (ihre Mutter würde sie umbringen), sondern nur ihr hübschestes Blumenkleid und eine schwarze Strickweste trug, die gegen den eisigen Dezemberwind nichts ausrichten konnte. George unterhielt sich mit zwei Jungen aus Newcastle, wobei das Gespräch hauptsächlich darin bestand, dass sie abwechselnd irgendwelche unbekannten Bandnamen brüllten und die Reaktionen des anderen abwarteten. Nachdem niemand riskieren wollte, eine uncoole Band zu mögen, kamen sie zu dem Schluss, dass mehr oder weniger alle schrecklich waren. Abgesehen von The Smiths.
„Ich wette, du bist nur hier, weil du auf Morrissey abfährst“, höhnte einer der Jungen aus Newcastle mit Blick auf Jen, die darauf wartete, dass George einsprang und sie verteidigte, doch er sagte nichts, und die Jungen setzten ihre endlose Diskussion über das Cover von What Difference Does It Make? fort. Jen konnte es kaum erwarten, dass sich die Türen öffneten und George und sie die beiden endlich loswurden. Und beinahe wünschte sie sich, sie könnte auch George loswerden.
Über eine Stunde später erklang wilder Jubel, und die Schlange setzte sich in Bewegung. Sie rückten dem Eingang näher und immer näher, zeigten hastig ihre Karten vor, wurden von einem Sicherheitsbeamten nach Aufnahmegeräten abgetastet (Bäh!), und als George schließlich nach Jens Hand griff, vergaß sie ihre Wut auf ihn. Sie rannten durch die Eingangshalle in das immer noch fast leere Auditorium, dann begann ein halsbrecherischer Fünfzig-Meter-Sprint zur Bühne. Sie standen zwar nicht direkt davor, aber zumindest in der zweiten Reihe, und Jen klatschte in die Hände und sprang auf und ab, denn sie war so nahe, dass Morrissey ihr vielleicht direkt in die Augen blicken würde, und wenn sie die Hand ausstreckte, dann griff er womöglich danach und zog sie auf die Bühne …
Innerhalb einer Stunde war das Auditorium so voll, dass sie hinter sich nur noch eine verschwommene Masse an Körpern erkennen konnte. Sie sah sich nach Priya und Rob um und erkannte, dass sich auch an der Bar im hinteren Teil und an den Türen Menschenmassen gebildet hatten, und auf dem Balkon über ihnen Leute Platz nahmen.
„Warum besucht man ein Konzert, wenn man sich dann erst hinsetzt? Da könnte man seine Karte doch jemanden überlassen, der die Musik wirklich zu schätzen weiß“, erklärte sie mürrisch.
„Die sind sicher alle uralt“, erwiderte Georg ätzend, und Jen vergaß, dass sie immer noch ein wenig wütend auf ihn war, als sie sich darüber ausließen, wie traurig es war, dass Leute über dreißig noch zu Konzerten gingen, obwohl sie offensichtlich schon zu altersschwach waren, um es zu genießen.
„Sie klammern sich verzweifelt an den letzten Rest ihrer Jugend“, schnaubte Jen, als die Musik vom Band verstummte und die Lichter ausgingen. Ihr Herz sprang beinahe aus ihrer Brust, und George drückte ihre Hand, ließ sie jedoch wieder los, als eine Band auf die Bühne trat, bei der es sich definitiv nicht um The Smiths handelte.
„Das ist Pete Shelley. Er war bei den Buzzcocks“, erklärte George Jen, als hätte sie das nicht selbst gewusst, und ihre Wut war wieder da.
Die Menge drängte nach vorne, und Jen hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Sie hatte noch nie bei einem so großen Konzert ganz vorne gestanden. Tatsächlich war sie erst bei einem anderen Konzert gewesen – sie hatte sich mit ihrer Mum von der letzten Reihe unter dem Dach Duran Duran im Wembley-Stadion angesehen, und dieses Geheimnis würde sie mit ins Grab nehmen.
Schon bald fand sie jedoch heraus, wie sie sich am besten mit der Menge bewegte, und als die Band Ever Fallen in Love spielte, sang sie aus Leibeskräften mit. Es war befreiend, ein kleiner Teil eines gigantischen Ganzen zu sein. Es gab etwas, das sie verband, einen gemeinsamen Daseinszweck, und sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, dazuzugehören. Es waren zwar noch nicht The Smiths, aber es war trotzdem fast perfekt. Bis George ihr ins Ohr brüllte: „O Gott, ich muss dringend pinkeln!“
Jen blieb ungerührt. „Da musst du jetzt durch.“
George schaffte es für den Rest des Sets, doch als Pete Shelley und seine Band die Bühne verließen und sich ein ungeduldiges Brüllen erhob, schüttelte er unglücklich den Kopf. „Ich verschwinde. Halte mir den Platz frei!“
„Wie soll denn das gehen? Und wo sind überhaupt Priya und Rob?“, schrie Jen ihm nach, doch die Menge hatte George bereits verschluckt.
Trotzdem war Jen nicht allein, denn sie waren alle zusammen ein großes Ganzes. Sie liebten alle dieselben vier Leute und deren Musik.
Die Menge wartete. Jen war zwischen den Leuten in der ersten Reihe und der Menschenwand hinter sich eingeklemmt. Sie spürte, wie die Aufregung von den Sohlen ihrer Dr. Martens auf dem klebrigen Boden langsam bis in ihren Kopf stieg, und ihre Haare waren bereits schweißnass.
Das Publikum schrie vor Vorfreude, als die Roadies Instrumente auf die Bühne trugen, die Setlists am Boden festklebten und das Mikrofon einrichteten.
Gerade, als Jen dachte, es würde nie passieren, ging das Licht erneut aus, und die ersten Töne von Take Me Back to Dear Old Mighty, dem bekannten Lied aus dem Ersten Weltkrieg, das für das Intro von The Queen Is Dead neu aufgenommen wurde, hallten durch das Auditorium. Jens Herz stockte, denn plötzlich waren sie da.
Mike Joyce ließ die Sticks auf sein Schlagzeug niederfahren, und sie begannen zu spielen. Das Rauschen in Jens Ohren und der Jubel der Menge waren so laut, dass Jen nicht einmal den Song hörte, bis Morrissey, eingewickelt in eine schwarze Strickjacke, zu singen begann.
Die Menge geriet in Bewegung und teilte sich, und Jen wurde von einem Jungen nach dem anderen beiseitegestoßen und zurückgedrängt, die sich ihren wertvollen Platz schnappten. Nein, das waren keine Jungen. Es waren Männer. Stämmige Männer, die mit den Armen ruderten und mit den Füßen stampften, auf der Stelle sprangen, von einer Seite zur anderen schwankten und den Platz vor der Bühne in einen Hexenkessel verwandelten. Ein Ellbogen knallte an Jens Kopf, und ein Mann, der doppelt so groß war wie sie, krachte gegen ihren Brustkorb. Sie wollte nichts wie weg.
Erst jetzt erkannte sie, dass in der ersten Reihe kaum Frauen zu sehen waren. Es war bloß eine pulsierende Menge Testosteron und XY-Chromosomen. Während sie hektisch versuchte, sich durch die winzigen Lücken zu schieben, die sich in der brodelnden Masse auftaten, wurde ihr mit einem Mal deutlich bewusst, dass sie ein Mädchen war. Und nicht nur deutlich, sondern auch schmerzhaft, als sich plötzlich eine Hand so fest um ihre Brust schloss, dass sie nach Luft schnappte. So fest, dass die Spuren morgen noch zu sehen sein würden, und sie sich nur befreien konnte, indem sie ihre Fingernägel in die körperlose Hand bohrte, bis diese endlich losließ.
Jen schaffte ein paar Schritte nach hinten, bevor das Chaos erneut über sie hereinbrach. Jemand schüttete ihr den Drink über die Schulter, und eine Hand fuhr zwischen ihre Beine. Als sie aufsah, blickte sie in ein anzüglich grinsendes Gesicht. Sie stieg dem Kerl mit voller Wucht auf den Fuß, damit er sie losließ, und er schubste sie von sich, sodass sie nach hinten taumelte.
Sie bemühte sich verzweifelt, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wenn sie jetzt zu Boden ging, würde sie nie wieder aufstehen. Zumindest nicht ohne erhebliche Knochenbrüche. Sie verstand nicht, wie sich die noch vor Kurzem so eingeschworene Gemeinschaft in einen brutalen Moloch verwandeln konnte. Sie rutschte auf dem glitschigen Boden aus und klammerte sich an beliebige Arme, um nicht doch noch zu fallen, als sie erneut eine Hand auf sich spürte.
„Willst du weiter nach hinten?“, schrie ihr jemand ins Ohr.
„Ja!“, brüllte sie, und der Jemand packte ihre Hand, beugte sich wie ein menschlicher Schutzschild über sie und wies ihr den Weg nach hinten, wo die Leute sich nicht wie Barbaren verhielten, sondern der Band zusahen, im Takt wippten und sangen. Sie amüsierten sich prächtig – und Jen hasste sie dafür.
„Ist alles okay?“, fragte ihr Retter. Schweiß brannte in ihren Augen, und Jen versuchte vergeblich, ihn mit der feuchten Hand abzuwischen. Und der Schweiß floss noch stärker, als sie erkannte, wer sie vor einem blutigen Tod gerettet hatte.
Es war Nick Levene.
„Ich kenne dich.“ Sie war so heiser, dass sie kaum ein Wort herausbrachte. „Vom College.“
„Oh, du bist das“, sagte er und wischte sich die Haare aus der Stirn, um ihr nasses, rotes Gesicht zu mustern. „Also, jetzt ehrlich. Ist alles okay?“
„Mir geht es gut“, versicherte Jen ihm nickend, und die feuchten Haare klatschten ihr an die Wangen. Wenigstens konnte sie nicht noch röter werden. „Danke. Es tut mir leid. Jetzt verpasst du alles.“
Genau wie Jen. Sie hatte einen ganzen Monat von den eineinhalb Stunden geträumt, wenn sie endlich im selben Raum wie ihre Idole sein und dieselbe Luft atmen würde. Es war absolut nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Sie war davon ausgegangen, dass Nick weiterziehen würde, nachdem sie sich nun nicht mehr in tödlicher Gefahr befand, doch er blieb neben Jen stehen, während die Band weiterspielte.
Der nächste Song war There Is a Light That Never Goes Out, und trotz der schrecklichen Erlebnisse wurde Jen derart von dem Gefühl des Liedes, das im Grunde eine Aufforderung zum gemeinsamen Selbstmord war, gefangen genommen, dass sie es kaum aushielt.
Sie warf einen Blick auf Nick, und er erwiderte ihn, sodass sie einen Moment lang etwas Echtes, Bedeutungsvolles und Makelloses miteinander teilten. Er nickte zustimmend, denn offenbar hatte er es ebenfalls gespürt, dann wandte er sich wieder der Bühne zu, und für den Rest des Konzerts waren sie nicht zwei Fremde, die zwei Mal die Woche im selben Englischkurs saßen. Sie waren eins.
The Smiths verließen die Bühne nach einer fulminanten Darbietung von Panic, und Nick wandte sich erneut an Jen. „Fährst du mit der U-Bahn nach Hause?“, schrie er ihr über den frenetischen Applaus hinweg zu.
Jen war so von dem Zauber gefangen, dass sie eine Weile brauchte, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es auch noch eine echte Welt mit U-Bahn-Stationen, langen Heimwegen und Freunden gab, die sie aus den Augen verloren hatte.
„Ich kann mit jemandem mitfahren“, brüllte sie zurück und sah sich um, als würde Priya jeden Moment aus der Menge treten. Das tat sie natürlich nicht, und bevor sich Jen fragen konnte, wo sie steckte, kamen The Smiths für eine Zugabe auf die Bühne. Sie spielten eine mitreißende Version von The Queen Is Dead, und die Gitarre dröhnte, während Morrissey ein Schild mit der Aufschrift „Two Light Ales Please“ in die Höhe hielt.
Nick sah Jen an, und Jen sah Nick an, während er Jen ansah. „Sollen wir?“, fragte er und streckte ihr die Hand entgegen, und obwohl sie mit blauen Flecken übersät war, ihre Knöchel pochten und sie am nächsten Morgen vermutlich mit einem Veilchen aufwachen würde, ließ sie sich von ihm zurück in die Menge ziehen, damit sie tanzen konnten. Es war wie im Fernsehen. Er wirbelt sie herum, sie ließ ihn sich drehen, und am Ende tanzten sie Wange an Wange und sangen lautstark und mit brennenden Kehlen mit, bis die Musik plötzlich endete, Morrissey sich das T-Shirt vom Leib riss und Jen in Nicks Armen erstarrte. Er ließ sie hastig los, und plötzlich war es seltsam.
„Du solltest deine Mitfahrgelegenheit suchen“, erklärte er, doch es war immer noch nicht vorbei.
Die Band kam noch einmal auf die Bühne, und Jen und Nick standen bei William It Was Really Nothing dicht beieinander, und ihre Arme berührten sich beim letzten – beim allerletzten – Song Hand In Glove.
Johnny Marr beugte sich über die Gitarre und presste die letzten Akkorde heraus, während Morrissey den Mikrofonständer hob, als wollte er ihn in die Menge schleudern. Doch er tat nichts dergleichen, und dann war er fort. The Smiths waren fort. Und dieses Mal würden sie nicht wiederkommen.
Die Lichter gingen an.
Jen blinzelte wie ein Maulwurf, der zum ersten Mal das Tageslicht erblickt. Die ersten Besucher schoben sich an ihnen vorbei in Richtung Ausgang, doch Nick und Jen standen noch eine Weile da, gefangen in der Musik und der seltsamen halben Stunde, die sie zusammengebracht hatten …
„Okay, ich muss meine Sachen aus der Garderobe holen“, erklärte Nick plötzlich und wandte sich ohne ein weiteres Wort – sogar ohne ein Nicken – ab und verschwand.
… und plötzlich war wieder jeder für sich.
Jens Füße schienen wie festgetackert, doch sie riss sich los und schob sich in Richtung Eingangshalle. Ihre Haut war von einem Schweißfilm überzogen, und ihr dünnes Kleid klebte feucht an ihr. Die Strickjacke, die sie um die Mitte gebunden hatte, war längst verschwunden, und ihr ganzer Körper schmerzte. Es war wie damals, als ihr Großvater Stan beschlossen hatte, das Mindesthaltbarkeitsdatum eines Pfirsichjoghurts zu ignorieren, das schon seit Beginn der Menschheitsgeschichte im Kühlschrank stand, und Jen aufforderte, kein Korinthenkacker zu sein. Sie hatte die nächsten vierundzwanzig Stunden kotzend über der Toilettenschüssel verbracht, und ihre Rippen hatten sich angefühlt, als hätte sie jemand mit Schleifpapier bearbeitet. In etwa so, wie sie sich auch jetzt anfühlten.
Jen humpelte in die Eingangshalle und sah sich um, doch sie konnte Priya, Rob und George nirgendwo entdecken, und auch wenn sie sämtliches Wasser in ihrem Körper ausgeschwitzt hatte, musste sie pinkeln, was bedeutete, dass sie sich in die ewig lange Schlange vor der Damentoilette einreihen musste.
Immer wieder packte eine kaum merkliche Panik ihre schmerzenden Muskeln, denn Priya war ihre Fahrkarte aus dem Chaos. Sie konnte es kaum erwarten, in ihr riesiges Haus in Winchmore Hill zu kommen, wo warme Klamotten, eine Zentralheizung und all die anderen Dinge warteten, die Jen für die Pyjamaparty zusammengepackt hatte. Bloß, dass es keine Pyjamaparty werden würde, sondern eine einfache Übernachtung. Pyjamapartys waren etwas für kleine Kinder.
Jen hatte lediglich ihre U-Bahn-Karte, eine kleine Geldbörse mit kaum nennenswertem Bargeld und ihren Haustürschlüssel dabei, alles sorgsam verstaut in der Bauchtasche ihrer alten Schuluniform, die sie unter dem Kleid trug. Ihre Mutter hatte darauf bestanden, und zu Hause hatte Jen protestiert und angemerkt, dass sie doch auch eine kleine Tasche mitnehmen konnte – die wahrscheinlich genauso verloren gegangen wäre wie ihre Strickjacke. Sie hätte ihre Mum am liebsten angerufen, um ihr zu sagen, dass sie recht gehabt hatte. Und um ihre Stimme zu hören. Woraufhin sie vermutlich zu weinen begonnen und ihr gestanden hätte, dass sie ihre Freunde verloren hatte und in Südlondon festsaß, wo es im Vorjahr sogar zu gewaltsamen Krawallen gekommen war.
Es war ein verlockender Gedanke, auch wenn es schon nach zehn war und ihre Mutter um halb zehn zu Bett ging und das Licht ausmachte. Jen sah sich in der Eingangshalle nach einem Münztelefon um, und in diesem Moment entdeckte sie ihre drei Freunde am Rand der Halle. Sie schienen wie erstarrt, und ihre Körperhaltung machte eine weitere Erklärung überflüssig. Priya hatte die Arme verschränkt und biss sich auf die Lippe, Rob hatte triumphierend und vollkommen ungeniert den Arm um ihre Hüfte gelegt, und George ließ den Kopf hängen, nahm die Brille ab und wischte sich über die Augen.
Jen machte einen Schritt auf sie zu, und die Worte „Ich habe überall nach euch gesucht!“, lagen ihr bereits auf den Lippen, doch plötzlich schlossen sich Finger um ihr Handgelenk, und sie wurde zurückgehalten.
„Ich würde mich da an deiner Stelle lieber raushalten“, erklang Nicks leise, eindringliche Stimme. Doch dieses Mal musste Jen nicht gerettet werden.
„Das sind meine Freunde.“
„Mittlerweile vielleicht nicht mehr.“ Er grinste schief. „Es geht nichts über eine verzwickte Dreiecksgeschichte, um eine alte Gang auseinanderzubringen.“
Jen wandte sich ab und stolperte auf George zu. Er brauchte sie jetzt. Er wirkte verwirrt, und beinahe drehten sich kleine Zeichentricksternchen um seinen Kopf. „Was ist los?“, fragte Jen, obwohl es ziemlich offensichtlich war.
„Du hast versprochen, es George zu sagen“, erklärte Priya, deren Rehaugen so riesig schienen wie nie zuvor. „Du hast es versprochen.“
„Ich habe überhaupt nichts versprochen“, erwiderte Jen, und Priya schnappte ungläubig nach Luft.
„Warum lügst du?“, mischte Rob sich ein, und für jemanden, der ständig seine Meinung dazu kundtat, was andere hören oder lesen sollten, schien er dieses Mal äußerst zurückhaltend. „Priya hat mir erzählt, dass du es George schonend beibringen wolltest.“
Als er seinen Namen hörte, warf George Jen einen Blick zu wie ein verwundeter Babyvogel, der gerade aus dem Nest gefallen und sich nicht sicher war, ob sie ihn hochheben oder unter dem Stiefel zermalmen würde. „Es gab Hunderte Gelegenheiten, es mir zu sagen“, murmelte er, und das stimmte, denn es hatte Hunderte Gelegenheiten gegeben, in denen er Jen mit seinen Schwärmereien genervt hatte.
„Das hier hat doch überhaupt nichts mit mir zu tun“, beharrte Jen und stemmte trotzig die Hände in die Hüften.
„Niemand hat mich gebeten, mit George zu reden, und deshalb habe ich auch nichts gesagt.“
„Aber ich habe dich offen gefragt, ob du glaubst, dass Priya Interesse an mir hat …“, erinnerte George sie. Das stimmte ebenfalls – aber es war einfach so, dass Jen in einem solchen Fall jedes Mal eilig das Thema gewechselt hatte, weil sie nicht hineingezogen werden wollte und die Angelegenheit außerdem langweilig fand.
„Du dachtest wahrscheinlich, du hättest selbst Chancen bei Rob.“ Priya schniefte, als würde sie bald in Tränen ausbrechen. „Das wäre natürlich praktisch gewesen. Ich und George, du und Rob …“
„Blöd nur, dass ich absolut nicht auf dich stehe“, erklärte Rob, und jedes Wort war eine weitere Ohrfeige für Jens Selbstwertgefühl, obwohl Rob ihr absolut nichts bedeutete. „Und mir ist nie etwas aufgefallen.“
„Dabei war es offensichtlich“, fuhr Priya fort, auch wenn das einzig Offensichtliche an der Angelegenheit war, dass sie ein Miststück war. Wie war noch gleich das Wort, das Mary für Leute benutzte, die so skrupellos, gerissen und unehrlich waren wie Iago in Othello? Machiavellistisch. Priya war ein machiavellistisches Miststück. Ein machiavellistisches Miststück, bei dem Jen allerdings leider die Nacht verbringen wollte.
„Hört mal, ich glaube, es gibt eine Menge … ich meine, wir sind alle verwirrt, und vielleicht sollten wir morgen darüber reden. Oder noch besser am Montag.“ Jen gab die Stimme der Vernunft, auch wenn sie fast an der Ungerechtigkeit erstickte. „Außerdem stehe ich nicht auf dich, Rob. Wir sind bloß Freunde. Genau wie George und ich, nicht wahr, George?“
Jen stieß George freundschaftlich in den Arm, doch er fuhr zurück, als hätte sie ihn geschlagen. „Verpiss dich, Jen!“, zischte er. George wirkte immer so tollpatschig und war stets so höflich, dass Jen ihn noch nie fluchen gehört hatte, und es war schrecklich, dass er solche Worte jetzt ausgerechnet gegen sie richtete.
George torkelte davon und schob sich schwankend durch die sich auflösende Menge. Er sah aus, als wäre er betrunken, obwohl er Jen einmal erzählt hatte, dass er schon nach einem halben Liter Bier mit Limo den restlichen Tag im Bett verbringen musste, weil er schreckliche Kopfschmerzen davon bekam.
„Ja! Verpiss dich, Jen“, zischte nun auch Priya, und endlich verstand Jen. Es war einfacher, Jen die Schurkenrolle zuzuschreiben, anstatt zuzugeben, dass sie mit Georges Gefühlen gespielt hatte und in Wahrheit immer nur hinter Rob her gewesen war.
„Ich glaube, wir sollten uns beide verpissen“, meinte eine Stimme hinter Jen, denn offensichtlich hatte Nick Levene die ganze Zeit hinter ihr gestanden und Jens Demütigung sowie die verleumderischen Anschuldigungen hautnah miterlebt. „Wenn Priya dich nicht mitnimmt …“
„Ich würde lieber sterben“, rief Priya. Rob warf ihr einen argwöhnischen Blick zu, und Jen dachte bei sich, dass er alles verdient hatte, was in dieser Beziehung noch auf ihn zukommen würde.
„Wenn wir uns nicht beeilen, verpassen wir die letzte U-Bahn“, fuhr Nick fort und winkte Jen mit sich zur Tür.
„Dann sollten wir am besten gleich los“, erwiderte Jen, als wäre es nichts Ungewöhnliches, mit der letzten U-Bahn nach Hause zu fahren, obwohl sie in Wahrheit noch nie so lange unterwegs gewesen war. Sie trat an Nick vorbei und ging zur Tür, ohne nachzusehen, ob er ihr folgte. Eine eisige Windböe schlug ihr entgegen, und sie zog die Schultern hoch. Zumindest musste sie montags nicht aufs College, wenn sie jetzt eine Lungenentzündung bekam.
„Ich beschreibe meine Bücher immer als Boys meets Girl meets Trouble. Es muss einen Konflikt geben, den das Paar überwinden muss, und beide müssen über sich hinauswachsen, um die schwierige Situation zu bewältigen. Es muss die Art von Konflikt sein, die man nicht einfach mit einem fünfminütigen Gespräch aus dem Weg räumen kann. Stattdessen muss für beide viel auf dem Spiel stehen. Ich bin auch der Meinung, dass es ebenso viele romantische wie witzige Momente geben sollte, aber auch eine echte Tiefe in der Geschichte und den Charakteren. Und meine zwei weiteren Zutaten sind ein paar heiße, prickelnde Szenen und ein zutiefst zufriedenstellendes Happy End.“ Sarra Manning
Woher ich meine Inspirationen nehme, ist eine Frage, vor der ich mich immer scheue, wenn man mich fragt. Normalerweise gibt es nämlich nie eine einfache, knappe Antwort. Oft fällt einfach eine Idee vom Himmel und vermische sie mit anderen Dingen, über die ich nachgedacht habe. Nachdem ich das ein paar Monaten verarbeitet habe, wird daraus ein Buch.
Bei Bis es für immer ist war das allerdings eine ganz andere Geschichte. Die Pandemie war gerade ausgebrochen, und ich wusste, dass ich keine Geschichte in diesen schrecklichen Monaten spielen lassen wollte. (Bis Ostern würde sie doch sicherlich ohnehin vorbei sein?) Andererseits hätte es sich auch seltsam angefühlt, sie einfach zu ignorieren. Also blieb mir nur die Möglichkeit, etwas zu schreiben, das nicht in der Gegenwart, sondern vielleicht in der jüngeren Vergangenheit spielt. Aber was?
Völlig inspirationslos habe ich aus den Tiefen meiner Festplatte den Ordner mit den Buchideen ausgegraben, die es nie geschafft hatten, und dort fand ich einen weiteren Ordner mit dem Titel "London Roman". Darin befanden sich ein Exposé, eine Zusammenfassung und viertausendfünfhundert holprige Wörter: Der unglücklichen Versuch, damals in den fernen Tagen des Jahres 2005 meinen ersten Roman für Erwachsene zu schreiben, um einen Agenten zu finden.
Es ging um einen Jungen und ein Mädchen, die sich als Teenager kennenlernen und deren Leben über die nächsten Jahrzehnte hinweg begleitet wird, wobei sich jedes Kapitel um eine U-Bahn-Station und ein Lied dreht. Klingt bis dahin bekannt? Nun, nicht wirklich: Einer von beiden wird ein Rockstar, es gibt eine Entzugs-Reha und jede Menge Melodrama. Ich habe den Agenten meiner Träume nicht bekommen, denn er war der Meinung, dass es zu jugendlich wirkte. Damals war ich empört, aber als ich nun jeden unbeholfenen Satz und jeden schwerfälligen Handlungspunkt noch einmal las, zuckte ich zusammen. Damals schrieb und veröffentlichte ich Teenagerromane (im Jahr 2005 nannte das noch niemand YA), aber das hier war wirklich unterirdisch.
Trotzdem gefiel mir der Grundgedanke, dass man mit sechzehn die Liebe seines Lebens treffen kann, ohne es zu merken, und dass die U-Bahn für Londoner der Kreislauf der Stadt ist, der sie am Leben hält. Ich wusste, dass zu bestimmten Zeiten in meinem Leben eine U-Bahn-Station eine wichtige Rolle in meinen Abenteuern spielen konnte: Da war der Sommer, in dem ich im Lager von Virgin Retail arbeitete und jeden Tag mein Fahrgeld an der U-Bahn-Station North Acton entwendete. Da war der Junge, der in Swiss Cottage wohnte und mir wöchentlich das Herz brach, meistens an den Fahrkartenautomaten der Station Swiss Cottage. Es gab Nächte, so viele glitzernde und farbenfrohe Nächte, die am Bahnhof Camden Town begannen.
Als ich anfing, diesen in der jüngeren Vergangenheit angesiedelten Roman zu schreiben, wurde mir klar, dass das U-Bahn-Netz der Schauplatz für den Beginn und das Ende so vieler Beziehungen ist. Wie oft in meinem Leben hatte ich mich mit Leuten an U-Bahnhöfen verabredet? Oder jemanden leidenschaftlich geküsste, während ich auf einen Zug der Edgware Northern Line wartete? Ich habe mich an Silvester in der U-Bahn auf dem Weg in die Stadt von einem Freund getrennt und bin in Hendon Central ausgestiegen, um weinend zu meinen Eltern zurückzukehren. Zwischen Caledonian Road und Kings Cross auf der Piccadilly Linie trennte ich mich dann von einem anderen Freund.
Außerdem – und das ist schwierig allen zu erklären, die nicht in der Zeit vor Mobiltelefonen und sozialen Medien aufgewachsen sind, wenn man in der jüngeren Vergangenheit mit jemandem Schluss gemacht hat, war es vorbei. Verschwunden. Unerreichbar. Es gab kein heimliches Stalking auf Facebook oder Instagram. Wenn man keine gemeinsamen Freunde hatte, konnte man nicht wissen, was im Leben und in der Liebe des anderen los war. Aber selbst in einer großen Stadt wie London kann sich niemand für immer verstecken. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele spontane Wiedersehen ich mit Menschen hatte, die verschwunden waren – sowohl peinliche als auch erfreuliche. Es gibt weder einen Grund noch eine Erklärung dafür. Manchmal sieht man eine Person jahrelang nicht und trifft sie dann innerhalb einer Woche dreimal wieder.
Ich kann mich sogar daran erinnern, wie ich in einem U-Bahn-Zug saß und mir nach einem Streit mit meiner damals besten Freundin die Tränen über das Gesicht liefen (in meinen frühen Zwanzigern gab es viele Dramen und Tränen, meistens in der Northern Line). Jemand von gegenüber stand auf, setzte sich neben mich und reichte mir ein Taschentuch. Es war ein alter Jugendfreund, den ich seit etwa fünf Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Und so dachte ich über diesen Roman nach, in dem es um zwei Menschen geht, die sich als Teenager kennenlernen und darüber, wie sie ihr Leben in den nächsten zwanzig Jahren gemeinsam und getrennt voneinander leben könnten. Als ich bereit war, ihn zu schreiben, befanden wir uns tief im Lockdown, und ich würde mich die nächsten achtzehn Monate ziemlich stark abschirmen (und nie auswärts essen, um verletzlichen Personen zu helfen).
Als ich mit dem Schreiben von Bis es für immer ist begann, einem Roman, in dem sich die U-Bahn-Linien wie ein roter Faden durch jedes Kapitel ziehen, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich während der gesamten Entstehungszeit nicht eine U-Bahn nehmen würde. Ich konnte nicht ahnen, dass ich mich nicht aus meinem Viertel herauswagen würde, während ich über all die Orte Londons schrieb, die ich kenne und liebe und die so viel Bedeutung in meinem Leben haben.
Während ich schrieb, sah ich mir Instagram-Stories über das geisterhafte London an: die Regent Street, völlig leer von Autos und Menschen, die Pall Mall, still und ruhig, der Leicester Square, verrammelt und verschlossen. Mir wurde klar, dass ich einen Liebesbrief an London schrieb. Nicht an das London, das durch die Pandemie für immer verändert werden würde, sondern an ein London, das schon viele Jahre vor diesem seltsamen, apokalyptischen Jetzt aufgehört hatte zu existieren.
Es ist das London, in dem ich als Teenager für 5 Pence mit dem Bus oder für 10 Pence mit der U-Bahn überall hinfahren konnte. Es ist das London des Wartens auf den Nachtbus an der Ecke Shaftesbury Avenue und Denman Street (wo Jahre zuvor das Rainbow Corner stand, von dem ich allerdings nichts wusste und mir nicht einmal vorstellen konnte, dass ich eines Tages einen Roman darüber schreiben würde!), der mich mit zusammengebissenem Kiefer und vor Kälte zitternd zum Haus meines Freundes in Clapton zurückbringt.
Bis es für immer ist weckte auch Erinnerungen, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie vergessen hatte: an all die Male, als ich die letzte U-Bahn verpasste und über eine zweispurige Straße nach Hause laufen musste – daher mein ständiger Ausruf als Teenager: "Wenn ich erwachsen bin, werde ich direkt neben einer U-Bahn-Station wohnen" (Ich bin erwachsen und wohne nun wenigstens eine Busfahrt von der nächsten U-Bahn-Station entfernt) – von Make-up-Fehlern und zu stark gezupften Augenbrauen und wirklich billigen Vintage-Kleidern.
Manchmal saßen die Erinnerungen richtig tief. Ich hatte alle Gedanken an die Bombenanschläge vom 7. Juli fast aus dem Gedächtnis verdrängt, aber plötzlich konnte ich mich mit messerscharfer Genauigkeit an meinen Weg zur Arbeit an jenem Morgen erinnern, an den Ablauf dieses schrecklichen Tages. Meine geliebte Großmutter starb, als ich acht Jahre alt war. Ich konnte mich kaum an sie erinnern, aber dank der Erfindung von Dot, Google und RightMove war ich plötzlich in ihrer Doppelhaushälfte zwischen Kilburn und Maida Vale und die Erinnerungen kamen zurück. Und ja, als mein herrschsüchtiger Großvater starb, kaufte sie tatsächlich eine Gefriertruhe und füllte sie mit Eiscreme, wann immer sie Lust auf ein mitternächtliches Festmahl hatte!
Es gibt so viele andere Teile meines Lebens, Menschen und Orte, die mich zu Bis es für immer ist inspiriert haben, aber es ist genauso ein Werk der Fiktion. Als Autorin von Liebesgeschichten liebe ich es, zwei Charaktere zu erschaffen, die ein Jahr lang mietfrei in meinem Kopf leben, und sie vom "Was wäre wenn" über das "Was zur Hölle?“ zum „Oh, du warst es von Anfang an!“ zu begleiten. Deshalb erscheinen mir Jen und Nick so real wie all die Dinge, die ich mir nicht ausdenken musste.
Im Gegensatz zu so vielen meiner anderen Figuren hat es bei Jen und Nick lange gedauert, bis sie mich wieder losgelassen haben. Ich vermisse sie immer noch fast so sehr, wie ich das London vermisse, über das ich in Bis es für immer ist geschrieben habe.
Und ich kann nur hoffen, dass Sie sie auch vermissen werden, wenn Sie Bis es für immer ist gelesen haben.









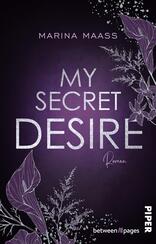
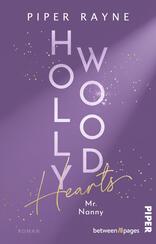


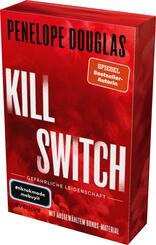






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.