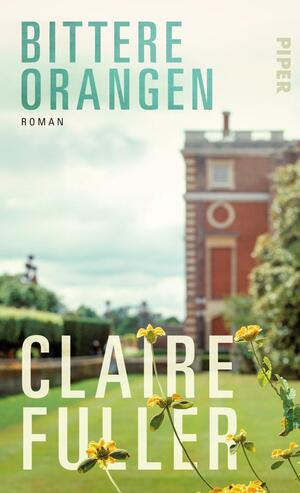
Bittere Orangen - eBook-Ausgabe
Roman
„Claire Fuller schafft in ›Bittere Orangen‹ eine besondere Atmosphäre von Verfall und Obsession.“ - Brigitte
Bittere Orangen — Inhalt
Im Sommer 1969 geschehen zwei Dinge im Leben von Frances Jellico, die sie zum ersten Mal Freiheit und Selbstbestimmung empfinden lassen: Ihre dominante Mutter stirbt, und sie erhält den Auftrag, für das Lynton Herrenhaus ein architektonisches Gutachten zu schreiben. Frances löst ihre Londoner Wohnung auf und richtet sich für einige Wochen in Lynton ein. Die einzigen Bewohner des einsamen Hauses sind Cara und Peter, das Hausmeisterpaar, zu dem sie rasch eine enge, komplizierte Beziehung entwickelt. Denn Cara macht sie zu ihrer Vertrauten, während Frances sich zunehmend zu dem undurchschaubaren Peter hingezogen fühlt. Das Ende dieses Sommers besiegelt ein Ereignis, das für Frances den Rest ihres Lebens auf tragische Weise beeinflussen wird.
Leseprobe zu „Bittere Orangen“
1
Die anderen müssen denken, mit mir geht es nicht mehr lange, denn heute haben sie den Pastor zu mir gelassen. Vielleicht haben sie recht, obwohl der Tag heute sich nicht von dem gestern unterscheidet, und vermutlich wird es morgen dasselbe sein. Der Pastor – nein, nicht Pastor, er hat einen anderen Titel, aber den habe ich vergessen – ist ein paar Jahre älter als ich, sein Haar ist grau, und seine Haut ist rot und schuppig und sieht entzündet aus. Ich habe nicht darum gebeten, dass er kommt; mein Glaube, mein sogenannter, wurde in Lyntons auf die Probe [...]
1
Die anderen müssen denken, mit mir geht es nicht mehr lange, denn heute haben sie den Pastor zu mir gelassen. Vielleicht haben sie recht, obwohl der Tag heute sich nicht von dem gestern unterscheidet, und vermutlich wird es morgen dasselbe sein. Der Pastor – nein, nicht Pastor, er hat einen anderen Titel, aber den habe ich vergessen – ist ein paar Jahre älter als ich, sein Haar ist grau, und seine Haut ist rot und schuppig und sieht entzündet aus. Ich habe nicht darum gebeten, dass er kommt; mein Glaube, mein sogenannter, wurde in Lyntons auf die Probe gestellt, die er nicht bestanden hat. Vorher war mein Kirchgang reine Gewohnheit, eine Routinesache, um die herum Mutter und ich die Woche gestalteten. Mit Routine und Gewohnheit kenne ich mich aus. Danach leben und sterben wir.
Der Pastor, oder was immer sein Titel sein mag, sitzt neben meinem Bett mit einem Buch auf dem Schoß; so schnell, wie er die Seiten umblättert, kann er es nicht lesen. Als er sieht, dass ich wach bin, nimmt er meine Hand, und ich stelle überrascht fest, dass es ein Trost ist: eine Hand in meiner. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal berührt worden bin – ich meine nicht die flüchtige Reinigungsprozedur mit einem warmen Lappen oder einem Kamm in meinem Haar, das zählt nicht. Ich meine, richtig berührt, von jemandem gehalten. Peter, wahrscheinlich. Ja, es muss Peter gewesen sein. Das ist im August zwanzig Jahre her. Zwanzig Jahre. Was kann man hier schon tun außer der Zeit nachspüren und sich erinnern?
„Wie geht es Ihnen, Miss Jellico?“, fragt der Pastor. Ich glaube nicht, dass ich ihm meinen Namen gesagt habe. Ich lasse das Miss auf mich wirken, Miss Jellico, rolle es in meinem Kopf herum wie eine Silberkugel, die beim Tivoli-Spiel von einem Stift zum nächsten kullert, bis sie in der Kuhle in der Mitte verschwindet und das Glöckchen zum Klingen bringt. Ich weiß genau, wer der Mann ist, aber seinen Titel, den kriege ich nicht zu fassen.
„Wohin komme ich, meinen Sie? Danach?“ Ich stelle die Frage unvermittelt. Ich bin eine querköpfige Alte. Vielleicht gar nicht so alt.
Er rutscht ein bisschen auf dem Stuhl herum, als juckte es ihn in der Hose. Vielleicht ist die Haut unter seinen Sachen auch schuppig und entzündet. Das will ich mir lieber nicht vorstellen.
„Nun“, fängt er an und beugt sich über sein Buch. „Das kommt ganz darauf an … das kommt drauf an, ob Sie …“
„Ob ich was?“
„Ob Sie …“
Wo ich hinkomme, hängt davon ab, was ich zu beichten habe – das ist es, was er meint. Himmel oder Hölle. Aber ich glaube nicht, dass er das wirklich glaubt. Nicht mehr. Und davon abgesehen reden wir aneinander vorbei. Ich könnte das Gespräch in die Länge ziehen, ihn an der Nase herumführen, aber ich beschließe, dass ich kein Spiel mit ihm treiben möchte.
„Ich meine“, sagte ich, „wo ich beerdigt werde. Wohin kommen wir, wenn wir diesen Ort endlich verlassen?“
Er sackt enttäuscht in sich zusammen, dann fragt er: „Denken Sie an einen bestimmten Ort? Ich kann dafür sorgen, dass Ihren Wünschen entsprochen wird. Gibt es jemanden, den ich unterrichten sollte? Jemanden, der bei der Trauerfeier dabei sein sollte?“
Ich bin eine Weile still, als würde ich mir das durch den Kopf gehen lassen. „Publikum ist nicht nötig“, sage ich. „Sie, ich und der Totengräber, das sollte reichen.“
Er verzieht das Gesicht – Verlegenheit? Unbehagen? –, denn er weiß, dass ich weiß, dass er kein richtiger Pastor ist. Er hat sich bloß so ausstaffiert, mit seinem Beffchen, damit sie ihn zu mir lassen. Er hatte schon einmal gefragt, ob er mich besuchen dürfe, und ich hatte abgelehnt. Aber jetzt, da sich unser Gespräch ums Beerdigen dreht, denke ich an menschliche Körper: an die Toten, die unter der Erde sind, und die Lebendigen, die auf ihr gehen. Cara und ich, wie wir uns auf dem Anleger am See von Lyntons sonnen. Sie im Bikini – noch nie hatte ich so viel von der Haut eines Menschen auf einmal gesehen – und ich im Wollrock, den ich mir wagemutig über die Knie hochgezogen hatte. Sie streckte ihre Hand aus, bis ihre Finger mein Gesicht berührten, und sagte, ich sei schön. Ich war neununddreißig Jahre alt, als ich da auf dem Anleger saß, und in meinem ganzen Leben hatte noch nie jemand zu mir gesagt, ich sei schön. Später, als Cara die Tischdecke zusammenfaltete und die Zigaretten einsteckte, beugte ich mich über das grüne Wasser des Sees und stellte enttäuscht fest, dass mein Spiegelbild unverändert war. Ich war dieselbe Frau, aber für eine Weile in dem Sommer damals vor zwanzig Jahren glaubte ich ihr.
Mehr Bilder tauchen auf, legen sich übereinander. Ich verzichte auf die Chronologie und überlasse mich den Erinnerungswellen, die einander überlappen und ineinander verfließen. Mein letzter Blick durch den Spion: Ich knie auf den blanken Bohlen meines Badezimmers im Dachgeschoss von Lyntons und presse ein Auge auf die Linse, die in der Lücke steckt, mit einer Hand drücke ich das andere Auge zu. Unter mir liegt jemand im Badewasser, das sich rosa verfärbt, die offenen Augen starren zu lange zu mir hoch, auf dem Fußboden sind Pfützen, und die glänzend nassen Fußspuren, die von der Badewanne fortführen, trocknen bereits. Ich bin ein Voyeur, die Person, die an der Polizeiabsperrung steht und zusieht, wie das Leben eines Menschen auseinanderfällt; ich fahre im Auto langsam am Unfallort vorbei, halte aber nicht an; ich bin der Täter, der zum Tatort zurückkehrt. Ich bin der einzige Trauergast.
Spion. Das Wort für das Ding habe ich erst hier gelernt, in diesem Haus.
Wie lange ist das her?
„Wie lange?“ Ich muss die Frage wohl laut gestellt haben, denn eine Antwort kommt von einer der Helferinnen. Nein, nicht Helferin; wie heißen sie? Pflegerinnen? Assistentinnen? Hilfsschwestern? Meine Krankheit frisst mehr als nur mein Fleisch, sie frisst auch meine Erinnerung an die vergangene Woche, an sämtliche Namen und Titel, die ich vor einer Stunde gehört habe. Aber immerhin ist sie so gnädig, mir den Sommer des Jahres 1969 zu lassen.
„Es ist zwanzig vor zwölf“, sagt die Stimme. Ich mag diese Frau, ihre Haut ist braun wie eine Kastanie, die ich Ende September vom Boden aufhebe und Anfang Mai in meiner Jackentasche entdecke. Sie sagt: „Nur noch zwanzig Minuten bis zum Mittagessen, Mrs. Jellico.“ Sie spricht meinen Namen Jelli-co aus, als wäre ich mit der Herstellung von Desserts berühmt geworden: Mrs. Wagners Pies, Mr. Kiplings Kuchen, Mrs. Jelli-cos irgendwas. Ich bin gar nicht Mrs. Jellico, ich habe nie geheiratet, ich habe keine Kinder. Nur hier, in diesem Haus, nennen sie mich so. Der Pastor nennt mich Miss, vom ersten Mal an. Der Pastor! Mir fällt auf, dass niemand mehr meine Hand hält, er ist weg. Hat er sich verabschiedet?
„Zwanzig Jahre“, flüstere ich.
Die Erinnerung an den ersten Anblick von Cara rührt sich in mir: ein blasser, langbeiniger Kobold. Ich höre sie draußen auf dem Wendeplatz von Lyntons herumschreien. Ich war dabei, den Badezimmerteppich zu zerschneiden, und ging über den schmalen Flur in eins der leeren Zimmer gegenüber meinem. Unterhalb der Dachfenster und oberhalb der Brüstung verlief die mit Blei ausgelegte Regenrinne, die voll mit welkem Laub, Zweigen und Federn von alten Taubennestern war. Unten vor dem Haus stand Cara in dem trockenen Springbrunnen auf dem Wendeplatz. Ihr lockiges Haar war das Erste, was mir an ihr auffiel, die Masse dichter Locken mit dem Mittelscheitel, die das Gesicht bis auf einen milchweißen Streifen verdeckten. Sie rief etwas auf Italienisch. Ich kannte die Wörter nicht; Italienisch verstehe ich nur als Abwandlung lateinischer Pflanzennamen, und selbst die verblassen jetzt. Kleiner Test: Cedrus … Cedrus … Cedrus libani. Libanon-Zeder.
Cara balancierte mit bloßen Füßen auf den pummeligen Schenkeln Cupidos, während sie mit einer Hand das Gewand der Steinfrau packte, als wollte sie es ihr vom Leib zerren, und in der anderen ein Paar Ballerinas hielt. Ich erschauderte bei dem Gedanken, welchen Schaden sie dem Marmor antat, der ohnehin schon splitterig und brüchig war. Halb hoffte ich, dass der Springbrunnen von Canova oder einem seiner Schüler war, allerdings hatte ich ihn mir noch nicht genau angesehen. Cara trug ein langes, gehäkeltes Kleid und – das glaubte ich auch aus der Ferne sehen zu können – keinen Büstenhalter. Die Sonne war hinter dem Haus beinah untergegangen, und Cara stand im Schatten, aber ihr Kopf, den sie in den Nacken geworfen hatte, um nach oben zu gucken, war im Licht. Ich hatte sie schon erkannt: heißblütig, stachelig, bezaubernd; ein blühender Kaktus.
Ich dachte, sie riefe zu mir ins Dachgeschoss hinauf. Laute Geräusche und heftige Worte hatte ich nie gemocht; mir war immer die Stille einer Bibliothek lieber, außerdem gab es damals niemanden, der mir gegenüber die Stimme erhoben hätte, auch Mutter nicht, aber natürlich ist jetzt alles anders. Bevor ich antworten konnte – obwohl ich nicht weiß, was ich gesagt hätte –, wurde in einem der großen Zimmer im Stockwerk unter mir das Fenster hochgeschoben, und ein Mann streckte Kopf und Schultern heraus.
„Cara“, rief er zu dem Mädchen auf dem Springbrunnen und verriet mir damit ihren Namen. „Mach nicht solchen Unsinn. Warte.“ Er klang erschöpft.
Sie schrie abermals etwas, schwenkte die Arme, machte den Mund auf und wieder zu, presste die Finger zusammen, warf sich die Haare über die Schultern zurück, wo sie nicht blieben, dann sprang sie vom Springbrunnen in das hohe Gras hinunter. Sie war immer leichtfüßig, Cara. Sie ging zum Haus und verschwand aus dem Sichtfeld. Der Mann zog sich vom Fenster zurück, und ich hörte ihn durch die leeren, hallenden Räume von Lyntons laufen und stellte mir vor, wie dort, wo er vorbeikam, der Staub aufstob und sich wieder legte. Von meinem Fenster aus sah ich ihn aus dem Haus zum Wendeplatz rennen, während Cara im Laufen ein Fahrrad über den Kies schob und sich dabei die Schuhe anzog. Als sie bei der Allee ankam, raffte sie ihr Kleid und sprang aufs Fahrrad, wie ein Zirkusakrobat auf ein rennendes Pferd – etwas, das ich damals nicht hätte bewerkstelligen können, und jetzt schon gar nicht.
„Cara!“, rief Peter. „Fahr bitte nicht.“
Wir sahen ihr nach, wie sie in Schlangenlinien um die Schlaglöcher der Lindenallee fuhr. Sie fuhr von uns weg, nahm eine Hand von der Lenkstange und streckte als Antwort zwei Finger in die Luft. Die genaue Erinnerung an die Gefühle, die ich damals bei Caras Anblick empfand, fällt mir schwer, angesichts all dessen, was danach geschah. Wahrscheinlich war ich von der Geste schockiert, aber ich glaube auch sagen zu können, dass ich erregt war von der Aussicht, ich könnte eine alternative Version von mir selbst erfinden, erregt von den Möglichkeiten des Sommers.
Der Mann ging zum Tor, das zwei Meter hoch, rostig und unverschlossen war, und schlug mit der flachen Hand auf den schmiedeeisernen Schriftzug Lyntons 1806. Mich verwunderte seine Frustration: War ich Zeuge vom Ende ihrer Beziehung geworden, oder hatte ich eine Verstimmung zwischen Verliebten miterlebt?
Ich vermutete, dass der Mann ungefähr in meinem Alter war, vielleicht zehn Jahre älter als Cara, sein helles Haar fiel ihm in die Stirn, und seine Haltung schien auszudrücken, dass die Schwerkraft, oder die Welt, auf ihm lastete. Attraktiv, dachte ich, aber zermürbt. Er steckte die Hände in die Jeanstaschen, und als er wieder zum Haus ging, sah er zu meinem Fenster hinauf. Ich weiß nicht, warum, ich hatte ja jedes Recht, dort zu stehen, aber ich wich rasch zurück und duckte mich unter die Fensterbank.
Lyntons. Allein wenn ich an das Wort denke, stellen sich mir die Härchen auf den Armen auf, als wäre ich eine Katze, die einen Geist gesehen hat. Aber die Hilfsschwester … nicht die vorherige … eine neue Weiße, die ich nicht erkenne und die eine Plastikschürze über ihrer Uniform trägt, sieht meinen offen stehenden Mund und nutzt die Gelegenheit, mir einen Löffel mit verkochtem Broccoli hineinzuschieben. Ich presse die Lippen aufeinander, drehe den Kopf zur Seite und lasse andere Erinnerungen aufsteigen.
Mr. Liebermanns handgeschriebene Wegbeschreibung: krakelige Ortsnamen, Pfeile und Nebenstraßen. Eine englische Kleinstadt, eine Kirche, ein Viehgitter. Ich stieg an der Haltestelle außerhalb der Stadt aus dem Bus und lief gegen die Fahrtrichtung zurück zu dem schmalen Weg, auf dem zwischen den Radspuren Gras wuchs. Auf dem Zettel hatte Mr. Liebermann neben einem verfallenen Gärtnerhaus vermerkt: Hier stehen bleiben wegen des Blicks. Später erfuhr ich, dass er selbst nie in Lyntons gewesen war. Vermutlich dachte er, ich würde mit dem Auto kommen, aber ich habe keinen Führerschein, hatte auch nie Fahrstunden. Ich bin niemals Auto gefahren. Ich stellte meine beiden Koffer ab und überlegte, dass ich sie unter der Hecke stehen lassen und später holen würde. Mir war warm in meinem Regenmantel – ich wollte ihn nicht auch noch im Gepäck tragen müssen –, und ich ruhte mich bei dem verbogenen Geländer einen Moment aus.
Gut eine Meile vor mir, jenseits des Parks mit seinen prachtvollen Bäumen, balancierte das Haus – Lyntons – auf einer grünen Erhebung. Es erstreckte sich nach hinten in den Schatten, aber von da, wo ich stand, konnte ich eine breite Treppe sehen, die zu einem prächtigen Portikus hinaufführte; die Nachmittagssonne beschien acht massige Säulen, auf denen ein Giebeldreieck ruhte. Es war, als würde ich den englischen Cousin des Parthenon vor mir sehen. Links brachen sich die Sonnenstrahlen auf den Scheiben des Gewächshauses, von dem Mr. Liebermann geschrieben hatte, während hinter dem großen Haus das Land zu einem bewaldeten Hügelzug steil anstieg – eine geografische Eigenart in diesem Teil des Landes: alte Waldungen an steilen Abbrüchen, die sich mit Schluchten und Windungen über mehrere Meilen erstrecken. Vor mir schlängelte sich ein Rinnsal durch die Wiese, überall waren tiefe Hufabdrücke von Kühen, dann verlor sich der Bach allmählich im dichten Unterholz. Ich erspähte das Wasserglitzern eines Sees, und obwohl ich ihn auf diese Entfernung nicht erkennen konnte, sah ich doch vor meinem geistigen Auge die Stelle, an der eine Brücke das Wasser überspannte. Ich hatte eine Vorstellung, das erregende Beben einer Ahnung, was für eine Brücke das sein konnte, wenn man das Alter und den Stil des Haupthauses in Betracht zog und das, was ich darüber gelesen hatte. Ich hatte zu niemandem etwas gesagt. Es hätte mir auch niemand zugehört, wenigstens damals nicht.
In meinem Bett, in diesem Haus, denke ich an Brücken und an das Überqueren von Wasser, ich denke an den Fährmann und überlege, ob dies eine Vorahnung meines Todes ist. Soweit ich weiß, hat jeder solche Ahnungen – ein Vogel, der durchs Zimmer fliegt, ein angeketteter Fuchs, ein wachsamer Hase, eine Kuh, die Zwillingskälber bekommt –, aber nur wer Pech hat, erkennt die Zeichen auch.
Eine andere Hilfsschwester, das freundliche Mädchen mit der Akne – Sarah? Rebecca? –, kämmt mir das Haar. Sie ist jünger als die anderen, sicherlich wird sie nicht lange bleiben, aber sie ist sanft, und sie redet nicht so viel dummes Zeug wie die anderen. Als sie fertig ist, nur wenige Bürstenstriche sind nötig, hält sie mir den Spiegel vor, und ich bin aufs Neue entsetzt von der Frau, die mich da ansieht: die eingefallenen Wangen, die verfärbte Haut, wie Teeflecken auf Pergament, der faltige Hals. Die Frau im Spiegel macht den Mund auf, und ich sehe gelbe Pferdezähne mit langen Hälsen im Kiefer, und als ich erschüttert zurückweiche, zuckt mein Arm, und der Spiegel verschwindet. Das Mädchen packt nicht fest zu, vielleicht erwartet sie von mir keine Kraft, und in ihrer Überraschung lässt sie den Spiegel los. Er schlägt am Bettende auf, und obwohl er nicht zerbricht, schliddert er quer durchs Zimmer. Das Mädchen sagt, ich solle still sein, solle mich beruhigen, mich wieder hinlegen, also tue ich das, aber jetzt ist sie nicht mehr so sanft. Unter mir breitet sich warme Nässe aus, das Mädchen drückt auf den Summer, und ich höre das Quietschen von Gummisohlen auf dem Linoleum im Flur. Dann ein scharfer Einstich in meinem Arm, und ich bin wieder im Dachgeschoss von Lyntons.
Ich bin in meinem Dachzimmer, und als klar ist, dass der Mann wieder ins Haus gegangen ist, schneide ich mit meinem Botanikmesser weiter an dem Badezimmerteppich herum. Es war ein schönes Messer, der Griff geschwungen, sodass er gut in der Hand lag, und die Klinge breit und kurz. Ich mochte, dass es scharf war. Wo das Messer jetzt ist, weiß ich nicht.
Neben der Fußleiste in der Ecke beim Fenster schob ich zwei Finger unter den Teppich und riss ihn in kräftigen Bewegungen ab; der Teppich löste sich ruckartig, Staub stieg auf, und ich fiel aus meiner Hockstellung rückwärts auf den Po. Eine Wolke von alter Haut und Schuppen und vertrockneten Insekten und Gipsbröckchen von der Decke ging auf meinem Gesicht und meinem Haar nieder.
Der Teppich war gemustert, hellbraune Vierecke und rötliche Kreise. An den Rändern war er grau von Staub, und um die Toilette herum hatte er giftig gelbe Flecken. Ich zog und zerrte und rollte die beiden Teppichhälften in der Mitte des Badezimmers zusammen, und der Holzfußboden darunter kam zum Vorschein. Das Badezimmer war groß – drei Schritte von der Badewanne zum Waschbecken und noch einmal drei vom Fenster zur Toilette – und musste früher einmal eine Dienstmädchenkammer gewesen sein. Von der Deckenmitte hing ein staubiger Lampenschirm an einem Kabel. Mir war es gleichgültig, in welch verkommenem Zustand alles war, das Badezimmer und das Schlafzimmer daneben waren meins, wenigstens den Sommer über.
Von der Dachbodentür am Ende des Flurs klang ein Klopfen herüber; ich hielt mit meiner Arbeit inne, blieb auf Händen und Knien hocken und hoffte, wenn ich mich nicht rührte, würde die Person wieder gehen. Früher hatte ich mir manchmal Gesellschaft gewünscht, aber jetzt, als jemand buchstäblich an die Tür klopfte, purzelten meine Gedanken durcheinander, und bei der Vorstellung, mit einem Fremden sprechen zu müssen, schlug mir das Herz bis zum Halse. Es klopfte wieder, und als ich mich aufrichtete und auf den Badewannenrand setzte, hörte ich, wie die Tür aufging, und im nächsten Moment stand der Mann, der hinter Cara hergerannt war, in der Tür zum Badezimmer, ein bisschen atemlos, weil er über die Wendeltreppe nach oben gekommen war.
Er starrte mich an, und mir wurde klar, dass ich das Botanikmesser in der Hand hielt und Mutters Seidenschal über Mund und Kinn geknotet hatte, als Schutz vor dem Staub.
„Hallo?“, sagte er und machte einen Schritt zurück. Aus der Nähe fand ich, dass er trauriger aussah, attraktiver, die Falten in seinem Gesicht geglättet.
Ich zog meinen Mundschutz ab und wechselte das Messer von der einen Hand in die andere, weil ich nicht wusste, was ich damit tun sollte.
„Entschuldigung“, sagte ich – mir war klar, dass das Wort von mir erwartet würde.
„Sie müssen Frances sein?“, sagte er und streckte die Hand aus. Vielleicht wirkte ich verwirrt und linkisch, denn er fügte hinzu, als hätte ich selbst es vielleicht vergessen: „Sie sind hier, um sich für Liebermann einen Überblick über die Gartenarchitektur zu verschaffen?“ Ein Moment verging, bevor ich seine Hand nahm, die trocken war und so groß wie meine. Ich ließ sie schnell wieder los. „Peter“, sagte er, um sich vorzustellen. „Es tut mir leid, ich war nicht hier, als Sie angekommen sind, aber es sieht so aus, als würden Sie sich häuslich einrichten?“ Er lächelte, fast war es ein Lachen, beim Anblick des Messers in meiner Hand. Ich sah ihm in die Augen, wandte dann den Blick ab und richtete ihn auf seinen Mund, auf die Lippen, die voll für einen Mann waren. Angesichts seiner Attraktivität kam ich mir noch tölpelhafter vor.
In einem seiner Briefe hatte Liebermann erklärt, er habe jemanden beauftragt, einen Bericht über den Zustand des Hauses und seine Einrichtungen zu erstellen. Ich hatte mit Peter gerechnet, aber nicht weiter darüber nachgedacht, und wenn doch, dann hatte ich ihn mir als älteren Mann und allein vorgestellt. „Entschuldigung“, sagte ich wieder und versteckte das Messer hinter meinen Shorts – breite Männershorts aus dem Army-and-Navy-Laden. „Ich war dabei, den Teppich zu zerschneiden.“ Nicht nur war es gut, sich zu entschuldigen, ich hatte auch gelernt, dass es hilfreich war, offensichtliche Tatsachen zu erwähnen, wenn mir sonst nichts zu sagen einfiel.
„Ich habe Ihr Auto gar nicht gesehen.“ Beim Sprechen bewegten sich Peters Hände, drehten sich umeinander, zeigten, veranschaulichten.
„Ich bin mit dem Zug gekommen, und dann mit dem Bus“, sagte ich. „Mit dem Neununddreißiger. Er hatte achtundzwanzig Minuten Verspätung.“ Sein Ausdruck schien anzudeuten, dass ich zu viel gesagt hatte, vielleicht sogar unhöflich gewesen war. Es war nicht leicht, es richtig zu machen – wie Menschen ein Gespräch führen, das mühelose Hin und Her. Ich fragte mich, nicht zum ersten Mal, wie man das anstellte.
„Sie hätten ein Telegramm schicken sollen“, sagte Peter. „Ich hätte Sie am Bahnhof abgeholt.“ Er sah an mir vorbei ins Badezimmer und sprach weiter. „Und Entschuldigung, dass Sie das alles mithören mussten vorhin. Wenn Cara in einer ihrer Stimmungen ist, kriegen das alle mit. Aber machen Sie sich keine Sorgen.“ Ich hatte mir keine Sorgen gemacht und fragte mich, ob ich mir vielleicht welche hätte machen sollen. „Sie wird in die Stadt gefahren sein. Sie kommt immer zurück.“ Er lachte wieder. Es klang, als müsste er sich selbst versichern. „Was haben Sie da vor?“ Er zeigte auf den Teppich. „Die Dachkammern sind ziemlich mickrig. Wahrscheinlich hat eine alte Hausangestellte hier gewohnt, eine Kinderfrau oder so. Alles ist völlig verwahrlost. Wenn Sie sehen könnten, in welchem Zustand die Soldaten das Haus zurückgelassen haben, die Graffiti, unvorstellbar.“
Er ging an mir vorbei ins Badezimmer und sah sich ohne jede Verlegenheit um.
„Soldaten?“, fragte ich. Wie man erreichte, dass der andere weitersprach, wusste ich genau.
„Lyntons ist requiriert worden. 47. Infanterieregiment. Amerikaner. Anscheinend haben Churchill und Eisenhower die D-Day-Invasion im Blauen Salon besprochen. Weiß der Himmel, was sie mit den Gartenanlagen angestellt haben. Die Soldaten, meine ich, nicht Churchill und Eisenhower, obwohl, wissen kann man es nicht. Jedenfalls, machen Sie sich gefasst. Liebermann hat vorgeschlagen, dass Sie die Zimmer unten bekommen. Sie sind eleganter, und ich hatte mir vorgestellt, dass Cara und ich in der Stadt Quartier beziehen würden, aber … na ja … die Umstände sind jetzt andere …“ Er lächelte. Mir gefiel, dass er redete und ich nicht reden musste. „Nur dieses Bad und das unten sind voll benutzbar. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, unterm Dach zu wohnen.“
Ich sah, wie sein Blick zu den zwei Bahnen aufgerollten Teppichs ging.
„Es hat gerochen“, sagte ich.
In seinem letzten Brief hatte Mr. Liebermann einen Schlüssel für die Seitentür geschickt, mit seinen Anweisungen, und dazugeschrieben, dass ich die Zimmer im Dachgeschoss nehmen solle. Als ich zum ersten Mal die Tür oben an der Wendeltreppe öffnete, schlug mir ein unglaublicher Gestank entgegen, wie in den letzten Tagen mit meiner Mutter. Eine Mischung aus gekochtem Gemüse, Urin und Angst. „Ich glaube, Mr. Liebermann hätte nichts dagegen, dass ich den Teppich rausreiße.“
„Nein, das hat er bestimmt nicht.“ Peter winkte mit der Hand ab und ging zum Fenster, während er weitersprach. „Liebermann weiß überhaupt nicht, was alles im Haus ist. Er hat mir eine Bestandsaufnahme geschickt, aber sie entspricht nicht dem, was da ist. Im Blauen Salon soll angeblich eine Rokoko-Figur von Wyatt stehen, eine Kaminfigur, aber da ist nur ein großes Loch. Das Treppenhaus, angeblich aus Marmor mit Intarsien, ist eindeutig aus Stuckmarmor, und nachdem sich Feuchtigkeit und Schimmel darin festgesetzt haben, lohnt es sich nicht, es zu retten, andererseits ist da die herrliche Kuppel, und im Keller habe ich große Vorräte von Wein gefunden, die nicht auf der Liste stehen.“ Er zwinkerte, dann beugte er sich vor, stützte die Hände auf die Knie und sah aus dem niedrigen Fenster. „Wahrscheinlich hat der Wein Kork. Die Bestandsaufnahme könnte genauso gut die von einem anderen Haus sein. Ich hatte angenommen, Liebermann habe Lyntons besichtigt, bevor er es gekauft hat, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Haben Sie das Bettzeug gefunden, das wir für Sie rausgelegt haben?“ Er wartete nicht auf eine Antwort. „Was für ein Blick!“
Meine beiden Zimmer lagen auf der Westseite des Hauses, unter dem Dach und bei den Schornsteinen. Alle Zimmer, ungefähr zwölf Stück, gingen von einem langen Flur ab, der von Nord nach Süd verlief. Von jedem Fenster aus hatte man einen überwältigenden Blick auf die zerstörten Gartenanlagen von Lyntons, auf die von Buchsbaum und Eiben überwucherten Pfade und den verwilderten Rosengarten, auf umgestürzte Statuen und zugewachsene Blumenbeete, auf den Park und das Mausoleum dahinter, und in der Ferne die steil ansteigenden Hügel mit den dunklen Bäumen.
„Haben Sie schon einen Gang über das Gelände gemacht?“, fragte ich. „Waren Sie schon bei der Brücke?“ Ich wollte, dass er sagte, er sei noch nicht dort gewesen, damit ich diejenige sein könnte, die das entdeckte, was es da zu entdecken gab, und andererseits hoffte ich, er würde sagen, dass er schon da gewesen sei und dass es eine Brücke im Stil Palladios sei, die den See überspannte, damit ich nicht enttäuscht wäre, wenn ich selbst dorthin kam.
Eine Brücke im Stil Palladios: eine zurückgenommene Konstruktion, die zwei Ufer miteinander verband. Meistens war der Konstruktion ein kleiner Tempel aufgesetzt: steinerne Balustraden, Säulen, Giebeldreiecke, ein Säulengang unter dem Bleidach, eine Kassettendecke und Skulpturen. Ein vom Wasser gekühltes Sommerhaus, das an beiden Enden offen war, von den Reichen erbaut, damit sie sich darauf ergehen oder mit ihren Kutschen darüberfahren konnten. Die Brücke, die ich mir vorstellte, überspannte den See mit fünf eleganten Bögen und hatte eine Balustrade, auf der ein aufsehenerregender, seitlich offener Tempel saß. Das Ganze wäre von einer beglückenden Symmetrie und hätte Schlusssteine mit feinen, komplexen Ziselierungen. Es wäre nicht einfach eine Brücke, eine Methode, um von einem Ufer zum anderen zu gelangen, es wäre ein Ort, der für die Liebe gebaut war, für geheime Treffen, für die Schönheit.
Peter richtete sich auf. „Es gibt eine Brücke? Ich wollte schon längst zum See gegangen sein, zum Schwimmen, aber ich war so sehr mit dem Haus beschäftigt, mit Cara und dem Weinkeller.“
Er trat mit dem Fuß gegen eine der Teppichrollen und lachte. „Sie wollen wohl ein paar Leichen aus dem Weg schaffen, wie?“
2
Als ich aufwache, bin ich allein. Mein Magen knurrt, und ich habe das Gefühl, das Frühstück oder das Mittagessen versäumt zu haben, oder gar beides. Am meisten jedoch brauche ich einen Schluck Wasser. Sie haben mir einen Becher auf den Nachttisch gestellt, aber ich kann mich nur mit den Augen dorthin bewegen. Meine Gliedmaßen gehorchen meinen Befehlen nicht mehr. Die Leute hier haben die Bettwäsche und mein Nachthemd gewechselt, und der Gedanke, dass sie meinen kranken Körper mit all den hellbraunen und dunkelbraunen Flecken und den verkümmerten Muskeln angefasst haben, beschämt mich. Früher habe ich jemanden sagen hören, je älter man würde, desto wohler fühlte man sich in seiner Haut und würde ihr Erschlaffen und die Falten gnädig hinnehmen, aber das stimmt nicht. Früher war ich eine stattliche Frau, „üppig“ hat Peter mich genannt. Jetzt ist das Fleisch vergangen, nur die Haut bleibt, und ich liege wie in einer Pfütze meiner selbst. Ich schließe die Augen und wende den Kopf zum Fenster, und die Farbe meiner Augenlider ist Färberröte. Ich kehre zurück.
Der Tag ist neu, das Licht golden und grün, ich bin wieder in meinem Badezimmer unterm Dach. In meiner Erinnerung scheint in Lyntons immer die Sonne; die paar Regentropfen, die wir hatten, mit dem bisschen Donnergrollen haben keinen Wetterumschwung gebracht. Es ist mein erster Morgen, und ich will zum See gehen. Aber zunächst habe ich die Badewanne, das Waschbecken und die Toilette geschrubbt und die Haare zusammengekehrt, die von dem Teppich geblieben sind; die Teppichteile habe ich die Treppe hinunter und nach draußen gebracht zu einem Abfallhaufen, den ich hinter den Ställen ausfindig gemacht habe.
Ich steckte mir Mutters Ohrclips an, Modeschmuck von Hattie Carnegie, und vergewisserte mich, dass Mutters Medaillon um meinen Hals hing. Vielleicht seltsam, sich für einen Spaziergang hübsch zu machen, aber ich trug ihren Schmuck gern als Erinnerung an sie, und wenn ich die Hand zum Ohr oder an den Hals hob, hörte ich wieder ihre Stimme und erinnerte mich daran, wie sie mich oft liebevoll angesehen hatte, bevor mein Vater uns verließ.
Während ich mir die Schnürsenkel zuband, fiel einer von Mutters Hattie-Carnegie-Ohrclips ab, als wüssten wir drei – ich, Mutter und der Ohrclip –, dass mir der Schmuck nicht stand. Eine runde Fassung aus Strass, in der Mitte ein Stück Cameoglas, offenbar für jemanden mit Ohrläppchen gemacht, die zierlicher waren als meine. Der Ohrclip hüpfte über den Fußboden, und ich eilte ihm nach, so gut das ging, eine glitzernde Maus, die in einer Ritze verschwand. Ich zog den anderen Clip ab, legte ihn auf das Bord neben dem Talkumpuder und steckte meinen Finger in die Ritze, so tief, bis meine Fingerknöchel am Holz schrammten. Ich spürte nur warme Luft. Aber eins der Dielenbretter war lose und verschob sich zwischen den anderen. Ich zwängte meine Finger unter das Brett und war überrascht, als es sich anheben ließ und die Querbalken darunter sichtbar wurden. In den breiten Zwischenräumen hatte sich ein reicher Schlick von verlorenen Dingen angesammelt, der Inhalt eines kleinen Wracks, der an einem dunklen, steinigen Strand angespült worden war: Nadeln, eine rostige Rasierklinge, ein Knopf, zwei Haarspangen, ein paar schmutzige Perlen von einer Kette, und der Ohrclip. Er lag vor einem Metallröhrchen, das den Umfang einer dicken Zigarre hatte und im Staub steckte. Ich versuchte es herauszuziehen, aber es saß fest; es ließ sich drehen und ausziehen, sodass es über den Fußboden ragte – ein kurzes Teleskop. Ich leckte mir den Finger und rieb damit die kleine Glasscheibe oben auf dem Röhrchen sauber, dann senkte ich mein Gesicht zu dem Röhrchen hinunter und blickte hindurch.
Was ich sah, war ein anderes Badezimmer aus der Vogelperspektive, größer als meins und imposanter: eine Badewanne mit Löwentatzenfüßen und ein Waschbecken mit gerolltem Rand, beide erschienen verzerrt, durch die Linse gekrümmt. Die Tür stand offen, und ein gelber Streifen Morgensonne aus dem Nebenzimmer schob sich über den Fußboden. Auf der Ablage hinter dem Waschbecken lag ein neues Stück Seife in einer Seifenablage aus Porzellan, und auf dem kleinen Tisch daneben war ein kleines Durcheinander von Tiegeln und Parfumflaschen und Zahnputzzeug. Ich sah zu, wie sich die Tür weiter öffnete und ein Mann hereinkam. Erst als er vor der Toilette stehen blieb und sich den Hosenschlitz aufmachte, erkannte ich, dass es Peter war. Ich schreckte zurück, legte die Hand über das Röhrchen und verhielt mich ganz still, als könnte er jeden Moment aufsehen und mich entdecken. Mir fiel ein, dass er gesagt hatte, die Zimmer unten seien für mich gedacht gewesen, und ich war dankbar, dass ich die zwei Dienstmädchenkammern bezogen hatte mit dem alten Armeebett und der dünnen Matratze darauf.
Ich rührte mich erst, als die Spülung der Toilette unten zu hören war, dann schob ich das Röhrchen wieder zusammen und legte das Dielenbrett darüber.
Mir hatte Mr. Liebermann auch eine Bestandsliste geschickt, zusammen mit der Wegbeschreibung und dem Schlüssel. Das Blatt war aus der Beschreibung der Immobilienagentur herausgerissen:
Ein neo-klassisches Herrenhaus mit Eingangshalle, Musikzimmer, Salon, Gewehrraum, Wohnzimmer, Speisesaal, Herrenzimmer, Billardzimmer, Gesellschaftsraum, zehn Schlafzimmer und Ankleidezimmer, fünf Badezimmer, diverse Kammern für Personal. Gelegen in einem prachtvollen Park mit Waldbestand, künstlichem See, Springbrunnen, Blumengarten, ummauertem Obst- und Gemüsegarten, klassischer Brücke, Orangerie von bemerkenswerter Architektur, Stallgebäuden, Meierei, Kühlhaus, Grotte, Mausoleum, verschiedenen künstlichen Ruinen einschl. Obelisk etc., und verschiedenen Außengebäuden. Alles in reparaturbedürftigem Zustand.
Mr. Liebermann hatte mit Bleistift einen Kreis um „Springbrunnen“ gemacht und „Klassische Brücke“ dreimal unterstrichen.
Seinen ersten Brief, der mit einer US-Briefmarke und einem US-Stempel kam, hatte ich einen Monat nach Mutters Beerdigung erhalten. Ein Zufall, aber ein glücklicher. Nach ihrem Tod blieb der Unterhalt aus, den mein Vater ihr gezahlt hatte, und obwohl Mutter alles, was sie besaß, mir hinterließ, war erstaunlich wenig Geld übrig, nachdem ich die Kosten für die Beerdigung beglichen und einige Rechnungen bezahlt hatte. Der Teil des Hauses in London, in dem wir wohnten, war gemietet.
Anfangs glaubte ich, ich würde es aufregend finden, zum ersten Mal in neununddreißig Jahren nicht zu wissen, wo ich wohnen und was ich tun würde. Wir hatten einen geregelten, stets gleichen Tagesablauf gehabt, Mutter und ich, und ich hatte mir vorgestellt, dass ich mich frei fühlen würde, wenn ich essen und schlafen gehen konnte, wann ich wollte. Ich hatte geglaubt, ich würde wie ausgewechselt sein. Ich hatte mich zehn Jahre lang auf Mutters Tod vorbereitet – jedes Mal, wenn ich vom Einkaufen oder aus der Bibliothek nach Hause kam, hatte ich die Tür mit einem Gefühl der Ungewissheit aufgeschlossen, und nachdem sie gestorben war, wollte ich mich von unserem alten Leben trennen. Ich wollte die Erinnerungen an all die Jahre, deren Spuren überall waren, endlich hinter mir lassen: der Stuhl, von dem aus sie die Straße überblickt und darauf gewartet hatte, dass ich zurückkehrte; der Schreibtisch, an dem sie regelmäßig Briefe an meinen Vater geschrieben und um mehr Geld gebeten hatte; das Bett, in dem ich sie gepflegt hatte und sie gestorben war – und das, als ich es abzog, noch ihren Geruch verströmte und mich zum Weinen brachte.
Ich war erbarmungslos. Ich lud den Antiquitätenhändler aus der Nachbarschaft ein und sagte ihm, er könne alles kaufen, was er haben wolle. Er summte und murmelte vor sich hin und schüttelte den Kopf, als ich ihm die Zimmer zeigte. Die Möbel seien zu dunkel und zu schwer, sagte er, der Markt für altmodische viktorianische Möbel wie diese sei so gut wie zum Erliegen gekommen. Aber er nahm trotzdem alles mit, einschließlich ihrer Haute-Couture-Kleider, die er in Kartons stopfte. Für alle Kleider zusammen gab er mir weniger als das, was eins neu gekostet hatte. Ich wollte trotzdem alles loswerden. Er ließ ihre Wäsche da, ein paar Stücke billigen Schmucks und ein Abendkleid, das ich behalten wollte. Ich dachte nicht an die Zukunft, nicht in diesem Moment. Ich hatte keinen Zweifel, dass sich etwas ergeben würde, und ich hatte recht, es ergab sich etwas.
Ein paar Monate zuvor war ein Artikel, den ich über die palladianischen Brücken in Stowe und in Prior Park geschrieben hatte, in der Zeitschrift The Society Garden Antiquities veröffentlicht worden. Im Laufe der Jahre waren mehrere Artikel von mir gedruckt worden, ohne dass ich ein Honorar dafür bekam, weil The Society Garden Antiquities eine unbekannte Zeitschrift war, die, so stellte ich mir vor, nur von einem halben Dutzend Akademiker gelesen wurde.
Aber sie musste doch ein größeres Publikum erreicht haben, denn eines Tages erhielt ich einen von der Zeitschrift an mich weitergeleiteten Brief von einem gewissen Mr. Liebermann, der schrieb, er habe ein englisches Landhaus mit Park erworben.
Dear Mrs. Jellico,
Vielleicht wären Sie als Expertin für Brücken und Gartenarchitektur bereit, Lyntons einen Besuch abzustatten und mir Ihre professionelle Einschätzung zu geben …
So hatte sein Brief angefangen. Ich hätte mich nicht als Expertin bezeichnet. Alles, was ich wusste, hatte ich mir selbst beigebracht, von meinem Jahr in Oxford einmal abgesehen. Jahrelang hatte ich meine Freizeit in der Bibliothek der British Library verbracht, wo ich immer auf demselben Platz saß und las, mir Notizen machte und zum Vergnügen kleine historische Artikel schrieb. Ich hatte keine historischen Stätten außerhalb Londons besucht, wenigstens nicht, seit mein Vater uns verlassen hatte.
Ich antwortete Mr. Liebermann noch am selben Tag und nahm sein Angebot an – ein Auftrag, eine Gelegenheit, aus der Stadt zu kommen, und, was ich besonders aufregend fand, eine Möglichkeit, eine klassische Brücke in natura zu sehen. Die ganze Zeit, in der ich auf seine Antwort wartete, schlief ich schlecht. Wir einigten uns auf ein Honorar und vereinbarten, dass ich im Haus wohnen könnte. Ich erklärte mich bereit, bis Ende August über die Objekte in seinem Garten, die von historischem Interesse waren, einen Bericht zu schreiben.
Für meine letzte Woche in London mietete ich mir ein Zimmer in einem Logierhaus bei Kings Cross. In einen Koffer hatte ich meine Bekleidung gepackt, in einen zweiten meine Bücher und das, was ich von Mutters Sachen behalten hatte. In den Nächten lag ich wach und hörte das Kommen und Gehen der Mädchen auf der Straße, die Tage verbrachte ich auf meinem üblichen Platz im British Museum und las alles, was ich über Lyntons finden konnte. Im Pevsner wurde das Haus auf anderthalb Seiten abgehandelt, die Pracht des Hauptportikus wurde erwähnt, und von dem Treppenhaus hieß es in dem abfälligen Ton, der mir inzwischen so gut gefiel, es sei „ohne Reiz“. Auch die Follys im Park und die Orangerie wurden kurz erwähnt, nicht jedoch eine Brücke. Die Kirche auf dem Gelände wurde aufgeführt, über deren Innenraum es hieß, er sei „enttäuschend“, und die Monumente seien „sentimental“. Aber ich erfuhr immerhin, dass das Haus Anfang des neunzehnten Jahrhunderts im neoklassischen Stil um ein älteres Backsteinhaus errichtet worden war. Ich bestellte mir die entsprechenden Ausgaben von Country Life in den Lesesaal, fand darin aber nichts Aufregendes, nur ein paar langweilige Fotos von Kaminbrüstungen, dem Säuleneingang und dem See. In einem Artikel wurde ein Buch mit Zeichnungen erwähnt, und das führte mich zu dem Tagebuch einer Frau, die sich 1755 in Lyntons aufgehalten hatte. Sie schrieb ausführlich über den zähen Fasan, der zum Abendessen serviert worden war, wie kalt und schäbig ihr Schlafzimmer war und dass auf ihr Zeichen kein Dienstbote gekommen sei, um Feuer im Kamin zu machen. Sie erwähnte auch die klassische Brücke, die den See überspannte, und ihre „feinen Bögen“.
Am ersten Morgen verließ ich das Haus, trat zwischen den riesigen Säulen des Portikus hervor, stieg die breite Treppe hinunter und ging unverzüglich zum See. Der ehemals förmliche Garten war verwildert und hatte sich zum Haus hin ausgebreitet, wo er die untersten Stufen überwucherte; die Brombeerranken brachen durch die Steine und wuchsen in den Spalten. Baldrian und Purpurweide hatten sich ausgesät, die Fliederbüsche waren lange nicht beschnitten worden und hatten lange dünne Äste, ihre Blütenköpfe waren braun. Verwildertes Geißblatt, Lonicera, kletterte über Ackerwinde, Convolvulus, hinweg. Früher einmal, vermutete ich, waren der See und die Brücke vom Haus aus zu sehen gewesen, aber jetzt musste ich einen Stock abschneiden und mir einen Weg durch das Dickicht schlagen, wobei ich mich an einen Pfad hielt, der von Brennnesseln flankiert war und zu einer Reihe von Nissenhütten führte, über deren halbrunde Dächer dichtes Efeu kletterte. Ich blickte durch die ausgestanzten Fenster und erkannte an dem Geruch und dem Schmutz, dass die Hütten zuletzt als Hühnerhäuser benutzt worden waren.
Als ich an mehreren gewaltigen Rhododendronbüschen vorbeikam, die beiderseits einer Reihe ausgetretener Stufen standen und deren abgefallene Blüten den Stein rosa färbten, machte ich mir unwillkürlich Vorstellungen von dem, was ich finden würde: eine palladianische Brücke, die vielleicht noch eleganter war als die in Wilton oder in Prior Park und breiter als die in Stowe, und meine hätte, anders als die in Stourhead, einen Tempel obenauf. Ja! Schon jetzt gehörte die Brücke mir. Ich würde sie entdecken – an Mr. Liebermann verschwendete ich keinen Gedanken, nicht in diesem Moment –, und ich würde einen Artikel schreiben, der nicht nur in einer Hochglanzzeitschrift erschien, nein, er würde in der Times veröffentlicht.
Ich folgte dem Bach, dessen Bett künstlich verbreitert worden war, wodurch das Wasser langsamer floss und der Betrachter den Eindruck gewinnen konnte, er stünde an einem See und nicht an einem gestauten und künstlich geleiteten Bach. Rechts von mir schlängelte sich das Wasser um eine Biegung und verschwand, und als ich ans Ufer vortrat, flog eine Schar Enten unter lautem Flügelschlagen und Quaken aus dem grünen Wasser auf. Ich wandte mich nach links und bahnte mir einen Weg durch wild wachsende Schösslinge; Reifenspuren von militärischen Manövern durchzogen hier den Boden, auf dem sich inzwischen wieder Gräser und Farne breitgemacht hatten.
Wenige Meter weiter hatte ich zum ersten Mal einen ungehinderten Blick auf die Brücke am Kopf des Sees. Sie entsprach nicht meinen Hoffnungen. Es gab keinen Tempel, nur ein Dickicht von Büschen und Pflanzen, die von beiden Ufern über die Brücke wuchsen. Es gab Bögen, aber sie waren nicht fein. Ich ging auf einem schmalen Rehpfad weiter, während ich die Brombeerranken und Beeren, die nach meinen Kleidern griffen, mit meinem Stock aus dem Weg schlug. Auf der Ostseite der Brücke floss der Bach träge, weil er von Unrat behindert wurde, der sich hinter den Steinen angesammelt hatte – Äste, Laub –, und weißer Schaum trudelte auf der Oberfläche. Es war ein trauriger, dumpfiger Ort, aber als ich den Blick über den See schweifen ließ, sah ich, dass das Wasser bis zu den Gräsern am Boden klar war, und in der Mitte fing die stille Oberfläche die Sonne und den Himmel ein und warf beides zu mir zurück.
Ich ging über die Brücke und am gegenüberliegenden Ufer entlang, wobei ich mich unter den Ästen herduckte und meinen Stock schwenkte, bis ich zum anderen Ende des Sees kam, der sich dort wieder zum Bach verengte, dann überquerte ich oberhalb eines kleinen künstlichen Wasserfalls ein Wehr. Dort saß ich eine Weile, während die Sonne höher stieg, und versuchte in meinem Skizzenbuch eine Zeichnung von der Brücke und dem See anzufertigen. Ich war sehr daran gewöhnt, allein zu sein und Zufriedenheit in meiner Einsamkeit zu finden, selbst inmitten der Menschenmengen von London, aber hier, während ich allein am Seeufer von Lyntons saß, war ich mir der zwei Menschen im Haus sehr bewusst und fing an mir auszudenken, was für Menschen es waren.
Später durchstreifte ich den Rest des Parkgeländes und sah mir die Follys und einige der Gebäude an: den Obelisken, das Mausoleum, die Grotte, den Küchengarten und die Meierei. Ich steckte den Kopf in muffige Vorratsräume, in das Kühlhaus und die Ställe, wo ich zwar keine Tiere sah, aber vor dem Licht und meinen Schritten welche weglaufen hörte. Den Rest des Vormittags saß ich auf dem schmalen Bett mit meinen Papieren auf dem Schoß und meinen Büchern vor mir auf dem Fußboden – es gab weder Tisch noch Stuhl –, formulierte meine Notizen aus, übertrug meine Skizzen und stellte einen Lageplan des Parks her, in dem die Standorte der Follys in Beziehung zum Haus markiert waren.
Ich wusch meine Unterwäsche und meine Strümpfe im Waschbecken, wozu ich die Seife auf dem Beckenrand benutzte, ihr Duft verflogen und die Oberfläche rissig, und hängte die Sachen über eine Leine, die über der Badewanne gespannt war. Später am Nachmittag machte ich mir eine halbe Dose Sardinen in Tomatensoße warm; die Kochplatte dafür, nebst Besteck und Geschirr, hatte ich in meinem Zimmer gefunden. Ich legte meine Koffer übereinander, breitete einen unbenutzten Kissenbezug darüber aus, deckte Messer, Gabel und Teller hin. Mit seitlich untergeschlagenen Beinen saß ich vor dem Esstisch, den ich mir gebastelt hatte, und aß meine Mahlzeit.
Nachdem ich abgewaschen und alles weggestellt hatte, nahm ich meine Arbeit wieder auf. Als ich das nächste Mal aufsah, hatte sich das Licht im Zimmer in der tieferstehenden Sonne zu Apricot gewandelt. Ich stand auf und streckte meinen Rücken, ich reckte und drehte den Hals, dann hockte ich mich vor das offene Fenster, sah über das Gelände und versuchte mir vorzustellen, wie es ausgesehen haben mochte, als es noch gepflegt wurde – die Felder in der Ferne, grün und ungepflügt, die Eichen und Zedern unversehrt, ihre Stämme nicht von Brennnesseln umwachsen. Eine Zeit, in der jeder Blick vom Haus so gestaltet war, dass er dem idealisierten Bild der englischen Landschaft entsprach, mit Blickfängern und offenem Land, gerahmt von den dunkel bewaldeten Hängen in der Ferne.
Kochgeruch zog von unten herauf, Knoblauch in Butter gedünstet, dazu Fleisch, und mein Magen zog sich zusammen – die halbe Dose Sardinen war nicht genug. Ich lehnte mich aus dem Fenster und sah auf der Fensterbank im Stockwerk unter mir einen Fuß mit schmutzigen Zehen und Nägeln, die mit grüner Farbe frisch lackiert waren, dann zog ich schnell den Kopf zurück. Ich überlegte, wie man es anstellte, dass man die Nachbarn kennenlernte.
Zum Abendessen aß ich den Brotkanten, den ich mitgebracht hatte, und den Rest der Sardinen. Ich würde am nächsten Tag in die Stadt gehen müssen, wenn ich essen wollte.
Die Luft unterm Dach war drückend, selbst bei offenem Fenster, und ich lag im Nachthemd unter einem Laken und dachte darüber nach, wer früher in meinem Zimmer gelebt haben mochte, und wer in dem nebenan, bevor es zum Badezimmer umgebaut worden war. Hatte ein männlicher Bediensteter, ein neugieriger Späher, der seine Herrin beobachten wollte, das Röhrchen im Fußboden angebracht, oder vielleicht ein missratener Sohn, der es lustig fand, die Gäste der Familie auszuspähen? Gerade stellte ich mir die verrückte alte Hausdame vor, die über das kleine Teleskop am Leben unterhalb ihres Zimmer teilnahm, als ich einen Schrei hörte, eine Frauenstimme, Caras, die von unten kam. Ein Licht ging an, und als ich meinen Kopf wieder aus dem Fenster steckte, war es im Badezimmer von Cara und Peter hell. Sie rief etwas auf Italienisch, sie spuckte die Wörter geradezu aus. Peters Antwort war laut, aber maßvoll.
„Bitte, Cara. Es ist spät, lass uns nicht wieder damit anfangen.“
Sie schrie ihn an, ihre fremd klingenden Wörter schallten durch die Nacht.
„Bitte auf Englisch“, sagte Peter.
Cara kreischte, ein Tier in der Falle. Es faszinierte mich, mir diese Frau vorzustellen, feurig und aufgeregt, anders als alle, die ich kannte. Dann Lärm von zerberstendem Glas oder von Porzellan, das zerschlagen wurde, und ich zog schnell den Kopf ein, als hätte sie es auf mich abgesehen. Eine Tür wurde so heftig zugedonnert, dass oben bei mir der Fensterrahmen bebte, unter mir fing Cara an zu weinen, und während sie zwischen zwei Schluchzern weiter unverständliches Zeug schrie, versuchte sie zu Atem zu kommen.
Ich wusste natürlich, was richtig und was falsch war. Das hatte mir mein Vater beigebracht, bevor er wegging, und danach hatte Mutter damit weitergemacht: Für ein Vergehen ist immer eine Strafe fällig, du darfst weder lügen noch stehlen, sprich nicht mit fremden Männern, sprich nur, wenn du angesprochen wirst, sieh deiner Mutter nicht in die Augen, trinke nicht, rauche nicht, erwarte nichts vom Leben. Ich wusste, dass es Regeln dafür gab, wie ich mein Leben zu leben hatte, aber das Wissen war intellektueller Art, eine Liste, auf der ich bei jeder neuen Tat deren Rechtmäßigkeit oder Verwerflichkeit prüfen musste, während für andere Menschen diese Dinge offenbar intuitiv zu klären waren. Das Spionieren kam auf dieser Liste nicht vor. Ich ging ins Badezimmer und hob das Dielenbrett ohne jeden Gewissensbiss an. Ich kniete mich auf den Boden und blickte durch das Röhrchen.
Cara lag zusammengerollt auf dem Badezimmerboden, sie trug ein Nachthemd, und die Lockenfülle ihres Haars bedeckte ihr Gesicht. Sie hatte die Knie bis zur Brust hochgezogen, ihr Kopf lag in Peters Schoß, und hin und wieder drang ein Schluchzer aus ihrer Brust. Peter war im Schlafanzug und saß mit dem Rücken an der Wand, die Beine hatte er gerade vor sich ausgestreckt. Er streichelte Cara über das Haar und beugte seinen Kopf über sie, und ich war verzaubert von der Liebe, die ich in dieser Geste zu sehen glaubte, ein wechselseitiges Geben und Nehmen, das ich nie kennengelernt hatte. Nach einer Weile richtete Cara sich auf und bedeckte Peters Hals und Gesicht mit kleinen Küssen, während er steif und aufrecht sitzen blieb, als wollte er abwarten, ob sie plötzlich umschwenken und ihm mit einer Kralle das Gesicht zerkratzen würde. Sie küsste ihn auf den Mund und drückte ihre Lippen auf seine, und dabei strich sie ihm mit der Hand, an der ein Ehering steckte, über den Oberschenkel und fuhr in seinen Hosenschlitz. Ich wandte den Blick nicht ab, ich war neugierig. Bevor ihre Finger im Schlitz verschwinden konnten, nahm Peter sanft ihr Handgelenk und zog es heraus. Cara ließ den Kopf hängen, und ihr Körper wurde von Schluchzern geschüttelt. Peter stand auf, hob sie in seine Arme, als wäre sie ein Kind oder eine Kranke, und trug sie aus dem Badezimmer.
„Ein psychologisch kluges Buch, spannend erzählt.“
„Claire Fuller schafft in ›Bittere Orangen‹ eine besondere Atmosphäre von Verfall und Obsession.“
„Sprachlich brillant und psychologisch vielschichtig.“
„Mit diesem Roman erschreibt sich die Britin Fuller in meinen Augen ihren Platz irgendwo zwischen Ian McEwan und J.L. Carr. Eine wirklich interessante Erzählerstimme von der Insel, deren Schaffen ich weiterhin aufmerksam im Blick habe (…).“
„Fuller ist eine begnadete Erzählerin. Sie nimmt ihren Leser mit (…) (und) entlässt ihn auf der letzten Seite mit dem Gefühl, Unglaubliches erlebt und erfahren zu haben.“
„Atmosphärisch dicht.“
„Wie eine Schlingpflanze wickelt einen diese Geschichte ein, unbemerkt, bis man sich nicht mehr lösen kann.“












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.