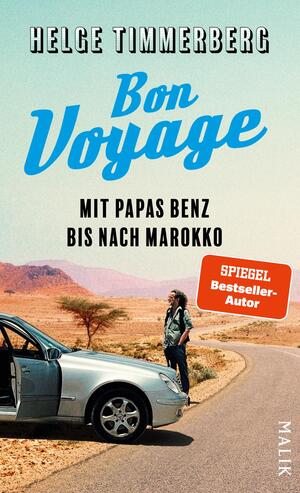
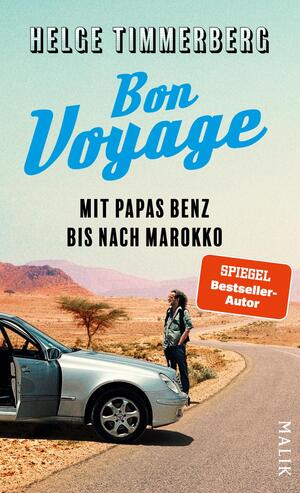
Bon Voyage - eBook-Ausgabe Bon Voyage
Mit Papas Benz bis nach Marokko
— Der Rockstar unter den Reiseschriftstellern in einem ungewöhnlichen Roadtrip: am Steuer einer eleganten Mercedes-Limousine„Helge Timmerberg zu lesen ist immer ein Vergnügen. Er hat den Blick für die Geschichte und die sympathische Selbstironie eines Märchenonkels.“ - Märkische Allgemeine Zeitung
Bon Voyage — Inhalt
Mit Papas Benz bis nach Marokko: Helge Timmerberg träumt von der großen Reise über Land, seit ihm sein Vater vor zehn Jahren seinen Wagen vermacht hat, verbunden mit den letzten Worten „Bon Voyage“. Was macht schließlich spontaner und unabhängiger als der eigene fahrbare Untersatz? Was könnte robuster und stilvoller sein als eine alte Mercedes-Limousine? Womit kommt man entspannter ans Ziel? Helge Timmerberg startet zu einer lässigen Tour durch die Schweiz über Italien, Frankreich und Spanien bis nach Nordafrika. Doch schon auf der ersten Etappe bricht er zwei seiner Regeln: „Fahre nie länger als vier Stunden pro Tag!“, „Meide die Dunkelheit!“. Und so wird, was als Genusstour gedacht war, zum Roadtrip mit Hindernissen, auf dem der Autor sich gründlich neu kennenlernt. Er wird ausgebremst und ausgeraubt, sein alter Benz wird zum Rückzugsort und die Reise mit sich allein zur Isolationshaft auf vier Rädern ...
„Timmerberg macht selbst aus dem Banalen steile Prosa.“ Süddeutsche Zeitung
Ein ehrliches Buch über zerstochene Reifen und Gespräche mit dem Navi, über Reisemüdigkeit und Glückshormone, die Freiheit des Automobilisten und das ewige Versprechen, unterwegs zu sein.
„Keiner schreibt so herrlich schnoddrig.“ Neue Westfälische
„Helge Timmerberg zu lesen ist immer ein Vergnügen. Er hat den Blick für die Geschichte und die sympathische Selbstironie eines Märchenonkels.“
„Am Ende sind gute Reisen gute Geschichten, die Lesern zu erzählen sind, die dann selbst auf gute Reisen gehen.“
„Wer mit Helge Timmerberg auf Reisen geht, sollte sich besser gut anschnallen.“
„Die Geschichte der Marokkoreise lässt sich aber vor allem deshalb so genüsslich lesen, weil Helge Timmerberg so formuliert, wie er formuliert. Zumindest mich holt das schnell in die Geschichte hinein, bringt mich immer wieder zum Grinsen oder erinnert mich an eigene Reisebegebenheiten, positiven und negativen.“
„Dieses Buch ist fantastisch, nicht nur wegen der Reiseeindrücke.“
„Ein ehrliches Buch über zerstochene Reifen und Gespräche mit dem Navi, über Reisemüdigkeit, die Freiheit des Automobilisten und das ewige Versprechen, unterwegs zu sein“
„Timmerberg beobachtet genau, erzählt äußerst bildhaft, aber ohne Kitsch, und schafft es, große Themen wie Vergänglichkeit, Familie und Freiheit ganz nebenbei einzubauen.“


















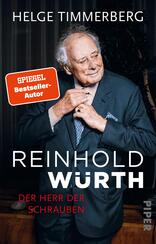










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.