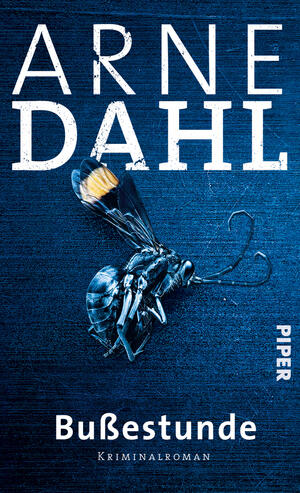
Bußestunde (A-Team 10) - eBook-Ausgabe
Kriminalroman
„Dahl schafft es, die Verbrechen auf eine individualpsychologische Ebene herunterzubrechen - trotz allgemeingültiger Aussagen über Gewalt an und Gewalt von Frauen.“ - Spiegel online
Bußestunde (A-Team 10) — Inhalt
Es ist Spätsommer in Stockholm, Sonntagnachmittag zwischen drei und vier: In dieser scheinbar friedvollen Zeit geschieht ein buchstäblich unsichtbares Verbrechen. Der schiere Zufall macht Lena Lindberg, ein Mitglied der A-Gruppe, zur ahnungslosen Zeugin des Mordes an einer jungen Frau. Und während ihr Vorgesetzter Paul Hjelm den undankbaren Auftrag erhält, den verschwundenen Geheimdienstchef zu finden, stoßen seine Ermittler auf eine Serie sadistischer, überaus heimtückischer Mordfälle. Doch nicht allein die Tatsache, dass auch Hjelms Tochter Tova ins Visier des Täters gerät, ist der Grund für die außergewöhnlichen Mittel, zu denen die A-Gruppe greift ...
Leseprobe zu „Bußestunde (A-Team 10)“
1
Wenn es eine Tagesentsprechung zur Geisterstunde gibt, der Stunde nach Mitternacht, in der die Geister ihr Unwesen treiben, oder zur Stunde des Wolfes, der Stunde vor der Morgendämmerung, in der die meisten Menschen sterben, dann muss diese Stunde auf einen Sonntag fallen. Wahrscheinlich einen Sonntagnachmittag. Es ist eine Stunde, in der alles stillsteht. Vielleicht die, in der eine Woche stirbt und eine neue geboren wird.
Die Zeit häutet sich ganz einfach.
Es ist eine sensible Stunde, eine Stunde der Nachdenklichkeit. Es ist eine Stunde tiefen [...]
1
Wenn es eine Tagesentsprechung zur Geisterstunde gibt, der Stunde nach Mitternacht, in der die Geister ihr Unwesen treiben, oder zur Stunde des Wolfes, der Stunde vor der Morgendämmerung, in der die meisten Menschen sterben, dann muss diese Stunde auf einen Sonntag fallen. Wahrscheinlich einen Sonntagnachmittag. Es ist eine Stunde, in der alles stillsteht. Vielleicht die, in der eine Woche stirbt und eine neue geboren wird.
Die Zeit häutet sich ganz einfach.
Es ist eine sensible Stunde, eine Stunde der Nachdenklichkeit. Es ist eine Stunde tiefen Friedens, zugleich aber auch eine Stunde, in der es der Angst leichtfällt, sich einzuschleichen und Fuß zu fassen. Dinge, die in dieser Stunde geschehen, erscheinen in einem besonderen Licht. Nennen wir sie die Stunde des Umbruchs.
Wenn außerdem der Herbst vor der Tür steht und der Sommer sich anschickt zu sterben, dann kommt es einem so vor, als ob ein ganzes kleines Land hoch oben im Norden jenes Erdballs, der vollkommen führungslos am Rande des unendlichen Universums umhertaumelt, gleichsam erzitterte. Wenn man etwas näher herantritt, sieht man tatsächlich, dass das Land zittert, man kann den Frieden erkennen und die Angst.
Das kleine Land ist – wie alle anderen Länder – keinem anderen gleich. Das Besondere an gerade diesem kleinen Land ist jedoch, dass es bald dazu bestimmt ist, das demokratischste Land des kleinen Erdballs zu sein. Aber nur sehr wenige in dem kleinen Land werden das merken. Oder sich etwas daraus machen.
Wenn man dann der größten Stadt des kleinen, kleinen Landes auf dem kleinen, kleinen Erdball richtig nahe kommt, sieht man eine Anzahl Menschen über die Stadt verstreut. Sie sind natürlich nicht allein, auch wenn – verglichen mit dem Rest des kleinen Erdballs – nicht besonders viele Menschen in der Stadt leben. Aber beeindruckend viele von ihnen halten sich gerade im Freien auf. Vermutlich glauben sie, die letzten Strahlen der Sommersonne zu genießen. Eigentlich geht die Stunde des Umbruchs geradewegs durch sie hindurch, gibt ihnen das Gefühl, auf eine besondere Weise teilzuhaben an dieser Mischung aus Frieden und Angst, die vielleicht das bekannteste Merkmal des Landes ist.
Denn jetzt wird es Herbst in Schweden.
Es ist kurz nach drei Uhr nachmittags an diesem Sonntag, dem 27. August, und das, was unsere kleine Gruppe auszeichnet, sieht man nicht von außen, es liegt in ihren Taschen.
Sie sind Mitglieder der Sondereinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter bei der Reichskriminalpolizei. Und abgesehen davon, dass keiner von ihnen im Moment im Geringsten an Gewaltverbrechen von internationalem Charakter denkt, ist auch nichts Besonderes an ihnen. Dennoch richten wir unseren Blick auf sie.
Wir sehen ein Paar, dem das Kunststück gelungen ist, seinen Kinderwagen in den Schatten zu schieben, während die beiden selbst sich in der Sonne rekeln, deren Wirkung sich durch die Spiegelung im Wasser des Riddarfjärden fast zu verdoppeln scheint. Der Wagen steht allerdings viel zu nah am Nachbartisch, halb unter einem der Segeltücher, und ist eigentlich zu klein für die inzwischen vierjährige Tochter, die schläft, wobei ihre Füße auf eine für den Unerfahrenen beunruhigende Weise aus ihm hervorragen.
Wer hätte ahnen können, dass sie so groß werden würde? Jedenfalls nicht der Vater, der selbst gezwungen gewesen war, sich wegen seiner geringen Körpergröße in die Polizeihochschule hineinzuschummeln. Möglicherweise die Mutter, die zwar nur zehn Zentimeter größer ist als ihr Mann, aber immerhin einige Großgewachsene in der Familie vorweisen kann. Sie weiß besser als er, dass die Gene unberechenbar sind – und eventuelle Zweifel, was seine Vaterschaft angeht, werden zum Glück durch das auffallend südamerikanische Aussehen der Tochter entkräftet. Und, denkt die Mutter, während sie sich von Neuem über die mangelnde Durchsetzungsfähigkeit ihrer eigenen Gene wundert, wahrscheinlich auch durch dieses.
Und damit lässt sie die Finger über die seit sechs Monaten wachsende Rundung ihres Bauches streichen. Jedes Mal, wenn sie das tut, gehen ihr so viele Gedanken, so viele Gefühle durch den Kopf. All die Risiken, die die Elternschaft mit sich bringt, all die Möglichkeiten, all die – Arbeit. All die Zeit. All die Kraft.
Isabel ist vier Jahre alt, und diese vier Jahre, die ihre Kinder voneinander trennen werden, sind wahrlich kein Zuckerschlecken gewesen. Obwohl es so schlimm nun auch wieder nicht war – eher haben Sara Svenhagen und Jorge Chavez wohl die üblichen Spannungen und Konflikte durchlebt, die mit der Elternschaft einhergehen, und möglicherweise sind sie manchmal etwas zu weit gegangen, doch im Nachhinein war alles halb so schlimm. Es gibt immer noch Phasen des Schweigens zwischen ihnen, aber jetzt sitzen sie wirklich dort am Mälarpavillon bei Norr Mälarstrand, die Füße nur ein paar Meter vom immer kälteren Wasser des Mälarsees entfernt, und fühlen das Gleiche.
So sieht das Leben normalerweise nicht aus. Wir wissen eigentlich nie, was der andere fühlt, und wir können nur vermuten, dass das, was wir beispielsweise Zufriedenheit nennen, für den, der uns am nächsten steht, die gleiche Empfindung ist. Aber gerade in diesem Moment, da die brisanteste Stunde des Umbruchs in diesem Jahr ihren Anfang nimmt, empfinden tatsächlich beide, Mann und Frau, die gleiche Zufriedenheit. Und außerdem sehen sie diese in den Augen des anderen, ohne ein einziges Wort miteinander zu wechseln. Und genau in diesem Moment, da ihre Blicke sich treffen und Jorge sich ausstreckt, um mit der Hand über die deutliche Rundung von Saras Bauch zu streichen, genau da wissen sie auf eine banale, romantische und vollkommen selbstverständliche Weise, dass sie zusammengehören. Trotz allem.
Wir verlassen sie hier. So viel zuckersüße Sentimentalität hält man auf Dauer nicht aus. Wir schwenken ein Stück und verlassen das Unmögliche – nicht nur die unmögliche Romantik, sondern auch die Unmöglichkeit, in die Seele der Menschen zu blicken.
Aber es ist klar, dass das Unmögliche noch weitere Chancen bekommt.
Wir gleiten in westlicher Richtung am Strand von Kungsholmen entlang, an allen Brücken vorbei. Als Erstes die Västerbro, die sich nach Långholmen und Södermalm hinüberbeugt, danach Essingeleden, der über Lilla und Stora Essingen und von dort weiter hinaus nach Europa führt, und zuletzt die Tranebergsbro, die sich nach Alvik und Bromma hinüberspannt. Aber da halten wir inne, an dem Punkt, wo der Mälarsee sich zur katzenförmigen Bucht des Ulvsundasees hinaufzieht. Und dort, im Schatten der Tranebergsbro, sitzt ein anderes Paar vor einer roten Hütte, und wenn man die beiden dort eng umschlungen sitzen sieht, ist die Gefahr ziemlich groß, auch hier sentimental zu werden.
Ziemlich groß ist auch der Mann, die Frau verschwindet gleichsam in seiner Umarmung, und in wenigen Wochen werden sich die beiden in viel zu engen Flugzeugsitzen niederlassen und wieder ihr Paradies auf Erden besuchen. Das sich ganz unerwartet auch noch als ein gutes Geschäft erwiesen hat. Das kleine Häuschen an den Hängen der Nordostküste von Chios in der griechischen Inselwelt war den ganzen Sommer über vermietet, hauptsächlich an Schweden, aber auch an den einen oder anderen reichen Norweger, und die Mieteinnahmen haben nicht nur die jährlichen Kosten für das Häuschen gedeckt, sie reichen auch noch, um den Aufenthalt von Gunnar Nyberg und Ludmila Lundkvist dort im kommenden Monat zu finanzieren.
Vor einem Jahr wurde Gunnar Nyberg in den Arm geschossen, als es der Sondereinheit der Reichskriminalpolizei für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter, gelegentlich auch als A-Gruppe bezeichnet, gelang, das Einschmuggeln von Mörderpillen, sogenannten „kill pills“, nach Schweden zu verhindern. Er verbrachte den Monat seiner Krankschreibung in dem Häuschen auf Chios – Ludmila konnte sich nur die Hälfte der Zeit von ihrem neuen Posten als Professorin am Slawistischen Institut der Universität Stockholm freinehmen –, und die Zeit in Einsamkeit und Isolation auf Chios, vor der er sich gefürchtet hatte, wurde phantastisch. Seit er erwachsen war, hatte er im Großen und Ganzen allein gelebt, aber vor einigen Jahren hatte er dieses Leben nicht mehr gewollt. Er konnte nicht mehr so gut allein sein. Also war er ein wenig unsicher gewesen, wie er nun zurechtkommen würde. Doch als Ludmila auf dem unansehnlichen Flugplatz landete, mit einer noch unansehnlicheren Inlandmaschine, wurde sie von einem heiteren, sonnengebräunten, völlig entspannten Grizzlybären abgeholt. Womit er sich eigentlich in den zwei Wochen beschäftigt hatte, fand sie nie ganz heraus, aber eine der Schubladen des kleinen Sekretärs gleich neben der Verandatür war auf einmal verschlossen. Es war nicht Misstrauen, das sie antrieb – möglicherweise sagte sie sich das ein paarmal zu oft –, sondern Neugier, die Grundvoraussetzung der menschlichen Entwicklung. Neugier also und nichts anderes veranlasste sie dazu, in einer pechschwarzen griechischen Herbstnacht mit verdächtiger Fingerfertigkeit und einem Küchenmesser als einzigem Werkzeug das Schloss der Schublade aufzufummeln. Aber als sie sah, dass in der Schublade nichts anderes lag als ein dicker Stapel Papier, vollgekritzelt mit einer unverkennbar kantigen Handschrift, setzte sie ihrer Neugier eine Grenze und sagte sich, dass die menschliche Entwicklung auch zu weit führen kann. Ohne die Blätter anzurühren, schob sie die Schublade zurück, ließ den Schließmechanismus lautlos in seine richtige Position gleiten, betrachtete ihr Werk und landete zu ihrer Verwunderung in einer Reflexion über die atemberaubende Entwicklung der Menschheit seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Eine Entwicklung, die uns wahrscheinlich den Planeten kostet.
Als Ludmila am darauffolgenden Morgen an den Frühstückstisch auf der Veranda mit der märchenhaften Aussicht trat, saß Gunnar schon mit einem Bleistift in der Hand und dem dicken Papierstapel auf dem Schoß da und sagte: „Ich habe angefangen, ein bisschen zu schreiben.“
Und während sie sich selbst versprach, dass sie ihrem Partner gegenüber zum allerletzten Mal misstrauisch gewesen war, setzte sie ihre treuherzigste erstaunte Miene auf und sagte: „Ach, wirklich? Das ist gut.“
„Wir müssen im nächsten Herbst wieder herkommen“, sagte Gunnar, legte den Papierstapel fort und streckte den Arm nach ihr aus.
Gemeinsam blickten sie zur Türkei hinüber, über den schmalen Sund, der genauso glitzerte, wie der Mälarsee jetzt glitzert, wenn man vom Solstugan in Fredhäll auf ihn herabblickt. Der Unterschied ist, dass auf der anderen Seite Alvik liegt und nicht die Türkei. Aber der dunkle Schatten, den Ludmila über Gunnars Gesicht gleiten sieht, ist genau der gleiche wie damals, und auch wenn sie nie wieder über sein Schreiben gesprochen haben, versteht sie, dass es um dasselbe geht, um dasselbe Schweigen in ihrem Leben. Die Sache einst in Venedig, an die nie ernsthaft gerührt werden darf.
Und Gunnar drückt seine Ludmila noch ein wenig enger an seinen großen Körper und sieht, dass sie sieht. Sieht, dass sie ahnt, dass er einen Menschen getötet hat. Und dass dies immer ein Teil von ihm sein wird, da mag er schreiben, so viel er will. Er hat einen schrecklichen Mörder mit Namen Wayne Jennings getötet, und wenn er hundert identische Chancen bekommen hätte, hätte er jedes Mal wieder genau das Gleiche getan.
Aber es sitzt in ihm drin.
Dann verzieht sich das Dunkle wieder, wie es das trotz allem doch immer tut, und beide denken genau gleichzeitig: Es ist fast ein Glück, dass es dieses Dunkle gibt. Sonst ginge es uns zu gut. Reines Glück wird auf die Dauer stickig.
Und da verlassen wir sie, eng umschlungen, und folgen dem Ufer um Kungsholmen herum, wo der Katzenkopf des Ulvsundasees sich unter der nördlichen Brücke des Essingeleden verengt und eine unerwartete Chamäleonzunge herausstreckt, die sich auf Höhe der kleinen Ekelundsbro in den Karlbergssee zwischen Kungsholms Strand und Klara Strand verwandelt. Das Wasser des Mälarsees ist jetzt richtig in Fahrt gekommen, als es auf seinem Weg zum Meer unter der St. Eriksbro, der Barnhusbro und der Kungsbro hindurchströmt, bevor es via Klarabergsviadukt und unter der Stadshusbro in die Bucht Riddarfjärden hinaussprudelt, die sich um Riddarholmen und Gamla Stan teilt.
In Gamla Stan sitzt auf einem schmalen Bürgersteig in der Österlånggatan nicht weit vom Schloss ein großer Mann und fühlt sich einsam. Er denkt darüber nach, wie leicht es ist, sich inmitten von Menschenmassen einsam zu fühlen. Er denkt daran, wie oft es ihm so ergangen ist. Und dies hier kann durchaus als Menschenmasse bezeichnet werden – die Tische stehen dicht beieinander auf dem Bürgersteig, und das Restaurant ist brechend voll, die Gäste sind fast ausschließlich Männer. In einem anderen Zustand – der beinahe sein ganzes Leben über vorherrschend war – hätte er das Gefühl gehabt, die Hausfassaden von Gamla Stan rückten näher und näher, schlössen sich um ihn, so wie auch alle diese fidelen Schwulen in Mandus Bar & Kök sich viel zu nah an ihn herandrängten. Aber diese Art von Einsamkeit ist es diesmal nicht. Es ist eine andere, und Jon Anderson ist inzwischen fähig, diese andere Einsamkeit zu studieren, sie zu drehen und zu wenden, sich von ihr faszinieren zu lassen, ja mit ihr zu spielen. Es ist dieses sonderbare Alleinsein, das man fühlt, wenn der Partner vorübergehend verschwindet, um zur Toilette zu gehen. Es ist eine milde Form des Verlassenseins, von der man weiß, dass sie vorübergehen wird. Die temporäre Angst in guter Zweisamkeit, gleichsam auf Probe. Nicht das Gefühl von Einsamkeit in der Zweisamkeit einer schlechten Beziehung, sondern das Zeichen dafür, dass die Zweisamkeit funktioniert. Es ist seine erste Zweisamkeit, und er ist verblüfft darüber, wie gut es ihm dabei geht.
Jon Anderson dreht an seinem Verlobungsring und versinkt im zufälligen, vorübergehenden Verlassensein. Er genießt es wie eine kleine Selbstkasteiung, einen vorübergehenden Besuch aus einem vorigen Leben, das man endlich in einem nachsichtigen, sogar versöhnlichen Licht betrachten kann. Er blickt sich um und versetzt sich zurück in die Zeit, die all diese kleinen Gassen schuf, die die Österlånggatan mit der Skeppsbro verbinden. Es ist das 15. Jahrhundert und unerhört lebhaft. Der Gestank ist nahezu unerträglich. Nur die Windstöße vom Meer, die dann und wann durch die engen Gassen ziehen, lassen es einen aushalten, und er sieht die Fischverkäufer, die Pelzhändler, die Pökelfleischimporteure, die Huren, die Seebären unten auf der Skeppsbro. Und mitten in alldem, vielleicht vor einer versteckten Kneipe am Anfang der Österlånggatan, sitzt ein ungewöhnlich schlanker und großer junger Mann und schüttet einen Schoppen essigsauren Wein in sich hinein. Wer wäre er damals gewesen? Mit seiner schändlichen Begierde? Ein Mönch? Ein Franziskaner, ein hagerer Bruder in grauer Kutte aus dem nahe gelegenen Kloster, ein Zisterzienser, der in den makaber einsamen Nächten in der eisigen Klosterzelle seinen sündigen Körper geißelt? Oder ein Schiffsjunge auf einem der Handelsschiffe, das im Pendelverkehr nach Deutschland hinunterführt, zu den Deutschen, die diese Stadt errichtet haben, ins Lübeck der Hanse oder noch weiter? Vielleicht wäre er – der Meisterschütze, der vor einem Jahr dem uneingeschränkten Herrscher über ein Verbrechersyndikat eine Pistole aus der Hand schoss – Söldner gewesen. Vielleicht wäre er ganz einfach vom Magistrat der Stadt angeheuert worden, um diese lärmenden, wilden, verrückten Bürger zu überwachen, die tagtäglich ums bloße Überleben kämpfen. Vielleicht hätte er seinen täglichen Broterwerb damit bestritten, Menschen zu foltern.
Mit einem schnellen Schwenk verschwindet die gesamte Szene, das ganze Stockholm des 15. Jahrhunderts, in Jon Andersons kreisendem Verlobungsring. Eine Hand legt sich auf die seine, und jede Einsamkeit verfliegt. Der Verlobungsring dreht sich nicht mehr. Jon Anderson blickt auf in ein Paar klarblaue Augen und versinkt in ihnen.
Marcus ist von der Toilette zurück. Er setzt sich neben Jon, und alles ist gut. Aber die Einsamkeit war schön, ruhig, befreiend – weil sie kurz war. Sie lächeln sich an und wenden sich wieder den eigenartig gestalteten Speisekarten zu.
Und wir machen uns wieder auf den Weg. Wir verlassen den Mälarsee und seine vielfältigen Ausläufer in das, was wir Stockholmer allzu leichtfertig das Meer nennen. Göteborger lachen uns aus, wenn wir vom Meer sprechen. Die Ostsee, dieses alberne kleine Binnengewässer, das außerdem im Großen und Ganzen biologisch tot ist, kann man doch kaum als Meer bezeichnen und schon gar nicht die Teile, die auf unergründlichen Wegen durch die Stadt landeinwärts sickern und mit Müh und Not kleine Buchten wie Brunnsviken bilden, die durch die extrem schmale Ålkista, genau auf der Grenze zwischen Stockholm und Solna, mit der Salzsee verbunden sind. Am linken Ufer von Brunnsviken liegt der Hagapark, einer der schönsten englischen Gärten der Welt, der jetzt ein Teil von Ekoparken ist, dem Nationalstadtpark. Gustav III. schaffte sich bei seiner Thronbesteigung 1771 ein Landhaus in Haga an, um der ein wenig blasierten Atmosphäre des Hoflebens entfliehen zu können. Außerdem begann er den Bau eines ganz neuen Schlosses, doch die Arbeit stagnierte, als er zwei Jahrzehnte später in der Oper erschossen wurde. Nur die Ställe und die Marketenderei für die Leibgarde des Königs wurden fertig gebaut. Diese eigenartigen Gebäude werden heute die Kupferzelte genannt und bieten einer Familie mit Kindern, die dem Sommer Lebewohl sagen will, eine außerordentliche Gelegenheit dazu. Das gilt auch für eine sehr große Familie – deren vielleicht nicht ganz uneingeschränktes Oberhaupt mittlerweile nicht mehr weiß, ob er es noch wagen darf, von einer Familie mit Kindern zu sprechen. Denn die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt zweiundzwanzig, zwanzig, siebzehn, fünfzehn und zwölf, und sie tragen in dieser Reihenfolge die Namen Mikaela, Linda, Peter, Stefan und Lina. Und das Allererstaunlichste ist, dass alle fünf versammelt sind, genau hier, auf den Wiesen vor den Kupferzelten, an jener Stelle, wo sie langsam schräg abfallen zu dem enormen Grashang des Hagaparks.
Lina ist auf jeden Fall immer noch ein Kind, denkt das Oberhaupt und betrachtet seine Jüngste mit besonderer Zärtlichkeit. Dass sie überhaupt noch lebt, ist nichts Geringeres als ein Wunder – es ist erst ein Jahr her, dass sie um ein Haar Opfer des polizeilichen Übermuts ihres Vaters wurde.
Arto Söderstedt denkt an den Tod, er denkt an dessen Anwesenheit in seinem Leben – nicht zuletzt im vergangenen Jahr. Seine Gedanken gehen von dem Erlebnis der Todesgefahr für seine Tochter zum Tod von Kollegen und Nahestehenden. Es ist ein schweres Jahr gewesen. Der Tod ist nicht mehr abstrakt, gerade im vergangenen Jahr kam er so nah, wurde er so konkret, so wirklich.
Er streicht seiner Frau Anja über den Oberarm, während er von dem Impuls überwältigt wird, etwas zu sagen – vielleicht sogar eine kleine Ansprache zu halten. Er betrachtet seine große Familie, alle diese weißblonden Köpfe, deren Größenunterschiede sich inzwischen anzugleichen beginnen, und er fühlt, dass er jetzt, wo sie endlich versammelt sind, ganz einfach dem Leben huldigen will. Dem ach so zerbrechlichen Leben.
Wieder kommt ihm ein Bild kürzlich verstorbener Nahestehender in den Sinn.
Er schaudert und betrachtet seine Kinder, eines nach dem anderen.
Das Leben anstelle des Todes. Und gleichzeitig so furchtbar viel potenzieller Tod.
Mikaela, wie groß sie geworden ist, eine vitale und ziemlich ernsthafte zweiundzwanzigjährige Handelshochschulstudentin mit finnischen Wangenknochen und einem Lächeln, dem niemand widerstehen kann, am wenigsten Männer. Er hat es aufgegeben, alle Freunde zu zählen, die an ihm vorbeizogen seit jenem magischen und tragischen Sommer in der Toskana vor Gott weiß wie vielen Jahren, als sie ihre Unschuld verlor. Sie hat kürzlich eine eigene Wohnung bekommen, endlich, nach zwei Jahren im Studentenheim, und hat plötzlich aufgehört, die Armut ihres Vaters zu verfluchen, und begonnen, sich in ihrer Mietskaserne in Hägersten wohlzufühlen. Dann Linda, immer die kleine Schwester, obwohl sie ja für wesentlich mehr Geschwister die große Schwester ist. Mit zwanzig sollte man zumindest den Hauch einer Ahnung haben, womit man seine Zukunft verbringen will. Stattdessen all diese Reisen in die entlegensten Winkel des Erdballs, dieses lässige Herumjobben, zu Hause bei den Eltern wohnend, bis genügend Geld da ist, um das wirkliche Leben zu beginnen, dieses Reisen mit diversen durchgeknallten Studenten, deren Beziehung zu der nicht minder durchgeknallten Linda äußerst diffus ist. Das Erstaunlichste am gesamten Lebenswandel seiner Töchter besteht für Arto Söderstedt darin, dass er nicht schon mehrfacher Großvater ist. Doch auch was der sonderbar athletische Wikinger Peter in seinem Internat an den Abenden treibt, ist, gelinde gesagt, unklar. Er besucht ein Handballgymnasium in Skövde und ist schon mit fünfzehn von zu Hause ausgezogen. Sosehr Arto auch die gesamten Genbanken der Familie durchforstet, es bleibt ihm unbegreiflich, wie der jetzt siebzehnjährige Sohn es geschafft hat, fast zwei Meter groß zu werden und gut neunzig Kilo zu wiegen. Vor Kurzem hat Peter in der A-Mannschaft des IFK Skövde sein Debüt gegeben, und Arto hatte zugesehen. Noch immer wundert er sich über die gesammelte Energie, die während eines Handballspiels in der Eliteklasse verbraucht wird. Und im Innersten ist er – der nie an etwas anderem als Leichtathletik Gefallen gefunden hat – sehr, sehr stolz. Ob er auch auf Stefan stolz sein soll, ist dagegen eine ganz andere Frage. Stefan Söderstedt ist eine Kopie seines Vaters, weißblond und hager und dazu noch Brillenträger. Er macht seine Hausaufgaben mit links und widmet sich in seiner Freizeit äußerst diffusen Wissensgebieten, die häufig diverse Verschwörungstheorien beinhalten. Er steht mit Massen von Communitys im Internet in Verbindung, die über Petitessen wie den eigentlichen Ursprung des Menschengeschlechts und politische Lösungen für die unausweichliche Klimakrise des Erdballs diskutieren. Doch, denkt Arto, doch, ich bin stolz auf sie alle, jeder ist anders, nicht zuletzt Klein Lina, die eine viel zu frühe Pubertät durchlebt, mit einem heftigen Strom ständiger Wechsel von Stil und Einstellung. Im Moment ist sie „goth“ und redet mindestens fünfmal täglich davon, das „eklige weißblonde Strohhaar“ rabenschwarz zu färben. Mit knallrosa Strähnen. Klein Lina, allein dass sie überhaupt lebt, ist ein Wunder, er kann es nicht lassen, es sich selbst immer wieder zu sagen. Vor einem Jahr bekam sie einen Wespenstich in der Schule, als sie die Hand in einen Busch steckte. Es gab eine Beule unmittelbar oberhalb des Handgelenks. Eine Schwellung. Ein klassischer Wespenstich. War es aber nicht. Ein Mörder saß in den Büschen auf dem Schulhof versteckt und injizierte dem Kind – bizarr genug – eine Giftampulle mit Fernauslöser in den Arm. Sie holten das Objekt später heraus, aber ihr Leben hatte am seidenen Faden gehangen. Selbst weiß sie nichts davon, Klein Lina, und dafür ist er unendlich dankbar.
In diesem Augenblick, als Arto darüber nachdenkt, wie grundverschieden von seiner eigenen Jugend das Heranwachsen heutiger Jugendlicher ist, wie das gesamte heranwachsende Menschengeschlecht ein völlig anderes werden wird als das gegenwärtige, wirft Lina dem eigensinnigen Vater, der ihrem rabenschwarzen Glück im Weg steht, erneut einen bösen Blick zu, und gerade dieser Blick, den er wie eine Ehrenbezeigung aufnimmt, weckt aufs Neue die Lust in ihm, eine Ansprache zu halten.
Wer weiß, wann wir alle sieben wieder zusammenkommen? Denkt er und hebt den Löffel an das Latte-macchiato-Glas, das vor ihm steht.
Vielleicht werden wir es nie mehr.
Einige von ihnen sehen die Geste, und das missvergnügte Stöhnen wandert von einem weißen Kopf zum nächsten, und am Ende hören sie sich an wie eine ungestimmte alte Orgel.
Wirklich wie Orgelpfeifen.
Als Arto Söderstedt aufsteht und das ganze Leben vor sich betrachtet, fährt der Tod wieder durch ihn hindurch, und als der Klang vom Glas aufsteigt und das Stöhnen von einer Art paradoxer Erwartungshaltung abgelöst wird, bleibt er einen Moment mit geschlossenen Augen stehen.
Er denkt: Viggo.
Und das ist alles.
Hier verlassen wir die Familie Söderstedt. Von hoch oben sehen sie aus wie sieben verirrte Schneebälle auf dem Rasen des Hagaparks, gerade als der Herbst von ihm Besitz ergreift; eigentlich setzt sich der Park auf der anderen Seite von Schwedens am stärksten befahrener Straße fort, der E 4, dem Uppsalavägen zwischen Norrtull und Haga Norra. Der Norra-Friedhof dort erstreckt sich über ein mindestens ebenso großes Areal wie der Hagapark, mit einem viel komplizierteren, fast künstlerisch ausgeformten, spinnennetzartigen Wegesystem und zahlreichen speziell gestalteten kleinen Sektionen, die seit der Einweihung im Jahr 1827 entstanden sind. Der Friedhof ist mehrfach erweitert worden, da es sich die Stockholmer nicht nehmen ließen zu sterben, und es gibt große Abteilungen mit Mausoleen und verschiedenen großartigen Grabanlagen, nicht zuletzt auf dem Hügel, der Lindhagens Kulle genannt wird, wo die imposantesten Monumente einander in postumer Größe zu übertreffen versuchen. Genau dort wandert gerade ein Mensch entlang, eine kleine dunkelhaarige Frau mit gesenktem Kopf und gebeugtem Nacken. Sie blickt sich nicht um und betrachtet die großartigen Grabmonumente, die Außenwelt scheint sie nicht zu erreichen, sie ist in sich selbst versunken. Auf ihrem Weg ist sie an Alfred Nobels Grab vorübergegangen, in einem der älteste Teile, die der Autobahn am nächsten liegen, sie hat August Strindbergs Grab unter der schicken Doppelbirke passiert, Ingrid Bergmans anspruchslosen kleinen Stein und Gösta Ekmans umso anspruchsvolleren in die Saiten greifenden Engel von Carl Milles. Und jetzt geht sie an dem geschmackvollen Hain des Gedenkens vorbei, ohne das Geringste davon wahrzunehmen. Sie denkt nämlich an den Tod. Das ist hier wohl auch angebracht. In Anbetracht des Todes an das Leben zu denken vielleicht auch.
Kerstin Holm hat ein Grab besucht und ist auf dem Weg zu einem anderen. Sie wandert zwischen Gräbern. Sie ist die operative Chefin der Sondereinheit für Gewaltverbrechen von internationalem Charakter bei der Reichskriminalpolizei, und sie mag den Tod nicht. Tatsache ist, dass sie ihn bekämpft, das ist der eigentliche Beweggrund für ihre Arbeit. Und das Grab dieses Kollegen zu besuchen schmerzt am meisten. Er ist erst vor so kurzer Zeit gestorben.
Während sie den Hain des Gedenkens verlässt und in abgelegenere Teile des Norra-Friedhofs gelangt, sagt sie sich selbst, dass sie trotz allem den falschen Beruf ergriffen hat. Der Tod darf kein Feind sein, wenn man ständig von ihm umgeben ist. Man muss einfach lernen, mit ihm zu leben.
Das Grab, zu dem sie unterwegs ist, ist für sie zu einem besonderen Platz geworden, einem Platz, wo sie sie selbst sein und den verdrängten Schmerz des Lebens hochkommen lassen kann, wo die Trauer über den toten Kollegen sich mit der Trauer über ihr eigenes Leben vereinen kann. Der Trauer über die Einsamkeit und die Schuld. Der Trauer über alle falschen Entscheidungen im Leben. Kurz und gut, der Trauer über das Leben.
Sie führt kein schlechtes Leben, mitnichten. Es ist besser als das der meisten. Ihre Karriere läuft ganz gut – auch wenn sie in der letzten Zeit nicht gerade mit Fällen überhäuft war –, und sie hat ihren Sohn Anders, der inzwischen richtig groß zu werden beginnt. Und für einen Augenblick hatte sie geglaubt, sie hätte …
Ja, das Leben läuft nicht immer so, wie man es sich gedacht hat.
Es kommt ihr so vor, als läge das Grab tief im Wald, völlig abseits, auf einer Lichtung, und als sie aufblickt, werden die Baumwipfel weniger, bis der klarblaue Himmel an der Grenze zwischen Sommer und Herbst wieder sichtbar ist. Da ist sie am Ziel.
Sie ist immer allein hier. Es liegen viele Gräber rundherum, aber außer ihr ist sonst nie jemand da. Das ist schön. Sie will für sich sein in ihrer Trauer.
Der Trauer um ihren toten Polizisten.
Sie kommt von ihrem toten Pastor und geht zu ihrem toten Polizisten.
Sie denkt an Krebs. Sie denkt an dieses wahnsinnige innere Gift des Körpers. Sie fragt sich, warum es existiert.
Dann kniet sie nieder. Sie kniet immer nieder. Das Gras ist Gott sei Dank noch trocken genug, sodass sie die Spuren ihrer Trauer nicht wie Stigmata durch die sonntägliche Stadt tragen muss. Denn natürlich wird sie weitergehen. Hinterher. Nach dem Gefühlsausbruch.
Sie blickt auf den Grabstein. Er sieht so neu aus. Er sieht so unnötig aus.
Du hättest nicht sterben müssen.
Sie wendet den Blick zum Himmel und denkt an Viggo Norlander. Sie denkt an seinen Krebs. Und sie sieht wieder auf den Grabstein, dann senkt sie den Blick auf das Gras, auf die Erde, die Erde, in der er vergeht.
Auf dem Grabstein steht Bengt Åkesson.
Bengt Åkesson steht da, darunter ein Geburtsdatum Anfang der Sechzigerjahre und ein Todesdatum Anfang September des vergangenen Jahres. So unerwartet.
So unnötig.
Einen Monat nachdem er aus einem einjährigen Koma erwacht war, setzte sich plötzlich ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn fest. Das war offenbar nicht ungewöhnlich nach einer so lange im Liegen verbrachten Zeit – angeschossen von einem Wahnsinnigen, der dann sich selbst und seine Geliebte erschoss und zwei Jahre nach seinem eigenen Tod auch zu Bengt Åkessons Mörder wurde.
Sie fragt sich, ob er danach in der Hölle in einen niedrigeren Kreis befördert wurde. Aber eigentlich war es ihr egal. Der Mörder war ihr egal. Nicht Bengt.
Wie mühsam es gewesen war. Gegen alle Wahrscheinlichkeit war er doch aufgewacht, anfänglich hatte er sich nur durch Blinzeln verständlich machen können, hatte aber zur Sprache zurückgefunden, wenn auch wortkarg und langsam. Und die Prognose lautete, dass er bald in einem Rollstuhl sitzen und das Haus werde verlassen können. Er starb um die Ecke, nur hundert Meter entfernt, im Karolinska.
Für eine kurze Zeit war er ihr Liebhaber gewesen. Eine viel, viel zu kurze Zeit. Und als er aufwachte, war sie gerade einem anderen Kollegen wieder nähergekommen, mit dem sie einmal vor sehr langer Zeit ein sehr kurzes Verhältnis gehabt hatte. Paul Hjelm. Sie waren gemeinsam wegen eines Geheimauftrags in Berlin gewesen. Es war alles über Erwarten gut verlaufen, und während der dritte Mann vor Ort, Jorge Chavez, die Stadt verlassen hatte, um sich mit seiner Sara Svenhagen auf Chios zu vereinigen, waren sie in Berlin geblieben. Beide. Jeder in seinem Zimmer im selben Hotel. Sie hatten gemeinsam während einiger Tage die Stadt erkundet. Aber jedes Mal, wenn sie einander richtig nahekamen, hatte sich ihr der Gedanke an Bengt Åkesson aufgedrängt, der in einem Krankenhausbett in Stockholm um sein Leben kämpfte, und sosehr sie auch wollte, sie konnte den Schritt nicht tun. Und Paul Hjelm akzeptierte das. Sie hatten eine schöne gemeinsame Zeit in Berlin verbracht, als Freunde.
Und dann starb Bengt Åkesson. Ganz plötzlich. Völlig unerwartet. Und ihr gesamtes Dasein wurde in Stücke gerissen. Sie konnte nicht mit Paul sprechen. Sie entglitten einander wieder. Sie konnte eigentlich mit niemandem darüber sprechen, über das seltsame Vakuum, das nach Bengts Tod entstand. Als habe eine höhere Macht sie ganz bewusst zum Schweigen bringen wollen – oder ihr etwas sagen wollen.
Aber sie redet mit seinem Grab darüber. Hier, einen Meter davon entfernt, auf den Knien und den Blick zum Himmel gerichtet. Sie spricht mit ihren Tränen darüber. Und sie glaubt, dass das Grab ihr antwortet.
Sie trauert um ihr Leben.
Und da verlassen wir Kerstin Holm, deren Gesicht auf der Lichtung zwischen den Bäumen zum Himmel gerichtet ist, und fahren auf der E 4 nach Süden, bis sie zum Essingeleden wird, der in einer kurzen Brücke über den Mälarsee endet, wo wir an eine Ausfahrt nach Hornsplan und Lindhagensplan gelangen und die E 4 verlassen. Wir folgen der Straße in Richtung Marieberg und auf die Västerbro und über Långholmen und schauen hinunter auf eine merkwürdige Oase inmitten des Verkehrslärms auf der Södermalm-Seite der Västerbro. Da steht ein Tisch, eine große Anzahl von Tischen wird sichtbar, gerahmt von Grün. Und dort sitzt ein Mann, ein dunkelblonder Mann in einem T-Shirt und in den besten Jahren, einem Mann gegenüber, der ihm ziemlich ähnlich, aber rund zwanzig Jahre jünger ist.
Paul Hjelm sitzt im Restaurant Lasse i Parken im Freien und unterhält sich mit seinem Sohn Danne. Danne will Polizist werden, und sie haben sich gerade ausgesprochen. So kommt es ihnen auf jeden Fall vor. Es gibt nichts mehr zu sagen. Paul hat nicht ausdrücklich gesagt, dass er das für eine saublöde Berufswahl hält – denn das findet er eigentlich gar nicht –, aber er hat ein wenig zu deutlich seine Skepsis zum Ausdruck gebracht.
Sie sehen sich nicht mehr häufig, und ihr Verhältnis ist ein wenig angespannt. Paul ist der Meinung, dass er in Dannes Argumenten zu viele feste Überzeugungen all der jüngeren Polizeiaspiranten wiedererkennt, die ihm über die Jahre hinweg begegnet sind und die noch keine gebrannten Kinder und deshalb von der Realität noch nicht verbittert waren. Diejenigen, die es geschafft haben, aus ihren Erfahrungen zu lernen und sogar mit den Jahren klügere und besonnenere Menschen zu werden, sind in der Minderzahl.
Hat er selbst das geschafft? Weil der Anblick Dannes zwangsläufig dazu führt, dass er an sich selbst im gleichen Alter denken muss, stellt sich diese Frage mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Vielleicht hat er das trotz allem. Vielleicht hat Paul Hjelm es geschafft, den drohenden Untiefen der Bitterkeit und der Lebensenttäuschung auszuweichen. In seinen besten Stunden glaubt er das – auch wenn ihm die Einsamkeit jetzt richtig schwer zusetzt. Natürlich gibt es Augenblicke, in denen er sich ausgebrannt fühlt, natürlich kommt manchmal die Bitterkeit in ihm hoch. Aber sie frisst ihn nicht auf. Oder hat sie vielleicht im letzten halben Jahr damit angefangen?
Es hatte wirklich den Anschein gehabt, als sei er auf dem Weg, einen wesentlichen Wandel in seinem Leben zu vollziehen. Er war Kerstin Holm wieder nahegekommen, nach so langer Zeit, und sie waren gemeinsam unterwegs gewesen, wohin auch immer. Nur Freundschaft zwar, aber es hatte sich gut angefühlt.
Und dann starb Bengt Åkesson und nahm alle Hoffnungen mit ins Grab.
Paul und Kerstin wohnen jetzt beide am Hornstull, im alten Knivsöder. Nur ein paar Hundert Meter liegen zwischen Kerstins neuer Dreizimmerwohnung in der Heleneborgsgatan und Pauls verspeckter alter Junggesellen-Einzimmerwohnung in der Slipgatan. Aber sie sehen sich nicht mehr. Sie haben sogar aufgehört, sich zufällig im Vivo-Supermarkt an der U-Bahn-Station Hornstull über den Weg zu laufen. Es ist, als mieden sie einander.
Jetzt wieder.
Er spürt, dass er nicht in ihre Trauerhölle eindringen darf – oder was es auch ist: Schuldgefühle, Depression, Angst, Lähmung der Handlungskraft.
Bis vor einem Jahr hatte ihm die vollständige Freiheit des Junggesellendaseins zugesagt. Nicht zuletzt übers Internet traf er eine Reihe von Frauen, die sich ebenso wenig binden wollten wie er. Aber das letzte halbe Jahr ist nicht gut gewesen, das ganze Sommerhalbjahr – wenn man es noch so nennen kann – ist eine rastlose Zeit gewesen, als habe er plötzlich angefangen, auf etwas zu warten. Er kann es selbst nicht richtig formulieren. Es ist zu schwierig.
Er sieht wieder zu Danne auf. Der Sohn seinerseits blickt ungeduldig auf die Uhr, und Paul spürt eine widerwillige Irritation darüber. Über diese Miene moralischer Überlegenheit. Über eine gewisse Streberhaftigkeit, von der er hofft, dass die konkrete Polizeipraxis, die im nächsten halben Jahr ansteht, sie abschleifen wird.
Sie haben miteinander geredet, Vater und Sohn, nicht ganz ungezwungen, aber sie haben auf jeden Fall über Dannes seltsame WG mit drei anderen Polizeischülern in Frösunda geredet und über die neue Wohnung von Mama Cilla auf Gärdet, in die sie gezogen ist, nachdem auch die Tochter Tova das Reihenhaus in Norsborg verlassen hatte. Offenbar hat Cilla auch einen Freund – aber da die Kinder zum Zeitpunkt der Scheidung im Großen und Ganzen mündig gewesen waren, gab es keine konkreten Gründe, auf dergleichen zu achten. Er hoffte, dass sie glücklich war, und mehr interessierte ihn nicht.
Tova, ja. Danne und er warten auf sie. Die alte Unart, überall zu spät zu kommen, hat seine Tochter anscheinend nicht abgelegt. Die Zwanzigjährige macht sich überhaupt ziemlich rar, und sie haben sich den ganzen Sommer über nicht gesehen. Paul überschlägt rasch und kommt zu dem Ergebnis, dass sie sich vier ganze Monate nicht getroffen haben. Das Letzte, was er von ihr gehört hat, war, dass sie Theaterwissenschaft studierte. Doch er weiß nicht, ob sie dabei geblieben ist. Ihm fällt auf, dass er viel zu wenig über sie weiß.
Wie lange muss man wegen seiner Kinder ein schlechtes Gewissen haben?
Ist es eine lebenslängliche Strafe?
Paul Hjelms Handy klingelt. Er nimmt es und sieht auf das Display. Eine SMS von einer unbekannten Nummer: „Wir müssen uns akut unterhalten. Montag, 9.00 Uhr. BK.“
Er betrachtet das Handy. Er braucht lange, um sich klarzumachen, dass BK die Initialen des Säpo-Chefs sind. Des Generaldirektors und Sicherheitspolizeichefs BK.
Akut?, denkt er und hat das Handy noch nicht eingesteckt, bevor ein Schatten darauf fällt. Ein sehr schmaler Schatten.
Plötzlich steht ein Wesen neben dem Tisch im Gartenrestaurant Lasse i Parken, ohne einen Ton von sich zu geben. Als sähe man ein Gespenst. Oder eher ein Skelett. Das Wesen ist so dünn, dass es aussieht, als könne es jeden Augenblick in der Mitte durchbrechen. Nur das schwache Lächeln in dem ausgezehrten Gesicht lässt Paul begreifen, dass es tatsächlich seine Tochter Tova ist, die hier neben ihm steht.
Die Woge der Gefühle, die Paul Hjelm in diesem Augenblick überkommt, vereint all seine Angst, all seinen Schmerz, all seine Unzulänglichkeit und konzentriert sie in einem einzigen diamantharten Augenblick der Schwärze.
Danne auf der anderen Seite des Tischs steht auf, und gerade als er etwas schreien will, verlassen wir sie und begeben uns stattdessen durch den Pålsundpark hinunter zum Pålsund, der Södermalm von Långholmen trennt. Noch liegen alle Boote im Wasser und säumen den Sund bis raus zum Mälarsee, aber wir biegen ab, fahren über die Brücke nach Reimersholme hinaus, und wo die Liljeholmsbucht schmaler wird, zunächst Bergsunds Strand und auf der Höhe des kleinen Pontonbadehauses von 1929 dann Hornstulls Strand heißt, folgen wir dem Wasser des Mälarsees bis zur hohen Liljeholmsbro, die gerade offen steht und zum Verdruss der Verkehrsteilnehmer ein langsames Frachtschiff durchlässt. Auf der anderen Seite der Brücke erheben sich die markanten Höhen von Tanto, mit ihrer Bebauung von pittoresken kleinen Gartenhäuschen bis zu mafiosen Millionenkolossen, in deren Schatten ein unverkennbarer Riesenbau seine grau melierten Fassaden ausbreitet. Das ist das Söder-Krankenhaus, und in dessen Garten, auf einer Parkbank zwischen schattigen Laubbäumen und mit Aussicht auf Årstaviken, sitzt ein völlig kahler Mann in einem hässlichen grünen Morgenrock. Er streichelt mit der einen Hand sanft sein heimliches kleines weiches Amulett in der Tasche des Morgenrocks und knetet mit der anderen seinen Bauch. Sein Blick wandert über die funkelnde Wasserfläche, vorbei an der parallelen Konstruktion der Årstabro – die alte und die neue Eisenbahnbrücke Seite an Seite – und weiter zu dem Spalt, der sich in weiter Ferne genau dort auftut, wo sich die Liljeholmsbro öffnet. Er sieht die schwarze Silhouette des Frachters durch eine Fläche von schierem Gold gleiten und glaubt, diesen Anblick schon einmal gesehen zu haben. In seinen Träumen. In den Träumen in der unmittelbaren Nähe des Todes. Das schwarze Schiff, das lautlos unter einer geöffneten Brücke durch flüssiges Gold gleitet. Es ist das Bild des Todes. Das Bild des Todes mitten im Leben.
Denn noch lebt er, Viggo Norlander. Im Lauf eines Jahres ist an seinem Körper auf eine Weise geschnitten und geschnibbelt worden, die er nicht für möglich gehalten hätte. Dazu ist seine zerschnittene Bauchhöhle auch in ziemlich rücksichtsloser Art und Weise mit allerlei Gammastrahlen bestrahlt worden, sodass sein Bauch, das alte Waschbrett, auf das er so stolz gewesen war, jetzt ganz andere Muster aufweist als gerade muskuläre Linien. Er gleicht eher einem chaotischen Spinnennetz von Narben und Brandwunden, einer Art brodelnder Eruption von Sedimenten, bei der verschiedene Zeitalter ihre Spuren hinterlassen haben, die ein erfahrener Schönheitschirurg vermutlich unterscheiden könnte wie ein Geologe. Der erste große Schnitt vor ziemlich genau einem Jahr. Die Brandwunden von der anschließenden Strahlenbehandlung. Die Entdeckung zurückgebliebener Krebszellen, die vielleicht, vielleicht nicht gestreut hatten. Neue Operationen, neue Strahlentherapie, dann Zytostatika, diese schrecklichen Medikamente, die das Dasein im Takt mit Büscheln fallenden, einst so schick transplantierten Haars ins Wanken brachten.
Er fühlt sich wie der Greis, der er nie hat werden wollen. Außerdem sieht er inzwischen auch aus wie ein Greis, ohne Haare, mit pergamentartiger Greisenhaut. Als habe ihn das Altern vor den Augen seiner Töchter ganz einfach eingeholt.
Seine Lebensgefährtin Astrid und die Töchter Charlotte und Klein Sandra haben das Ganze verfolgt. Er hat sie so nah wie möglich bei sich haben wollen. Die ganze Zeit über hat er geglaubt, er würde sterben. Und gleichzeitig hat er das Unausweichliche mit seiner ganzen nicht gerade geringen Dickköpfigkeit bekämpft.
Aber jetzt sind sie nicht da. Schule und Kindertagesstätte haben wieder angefangen – nach einem Sommer, in dem sie nicht gerade viel zu lachen hatten, die Ärmsten.
Wie groß sie geworden sind.
Und wie viel Unnötiges sie zu sehen bekommen. Sollte er es ihnen lieber ersparen? Sich still zurückziehen? Einfach in den Wald gehen und verschwinden wie ein alter Indianer?
Nein, verdammt, er hat nicht vor zu sterben. Noch nicht.
Bald wird er in seinen albernen Pantoffeln und seinem noch alberneren Krankenhausmorgenrock hinaufschlurfen in die Pflegeabteilung 36 im sechsten Stock, wo Patienten mit Krebs im Bauch und andere Herumtreiber ihre unsicheren Tage verbringen. Aber jetzt noch nicht. Eine kleine Weile will er noch sitzen bleiben. Als wollte er die letzten Sonnenstrahlen in sich aufsaugen, die vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr Blattgold über der Wasserfläche des Mälarsees auszubreiten vermögen.
Eine Stunde hat er dort gesessen. Es ist eine sonderbare, still stehende Stunde gewesen. Er ist der Zeit entrückt gewesen, doch nicht wie im Tod. Eher auf eine intensivere Art des Lebens. Leben ohne Zeit.
Eine merkwürdige Stunde.
Die Prognosen kann man nicht hoffnungsvoll nennen, das weiß er, aber er hat beschlossen, nicht aufzugeben. Nicht einmal im Augenblick des Todes wird Viggo Norlander aufhören, gegen den Tod zu kämpfen. So viel weiß er.
Sehr viel mehr weiß er nicht über die Zukunft.
Aber ein bisschen mehr erfährt er in dem Augenblick, als ihn auf unergründlichen Wegen eine SMS erreicht. Er holt das Handy aus der Tasche des Morgenrocks, zusammen mit einem Knäuel grüner Fäden, die ihn davor warnen sollen, das Handy in der Tasche zu haben. Ganz ohne die Irritation, die vor nur einem Jahr diese Geste begleitet hätte, zupft er nacheinander die Fäden ab und denkt, dass dies vielleicht Lebensweisheit ist.
Ganz einfach Sinn für Proportionen.
Angesichts des Todes wird das Wichtige plötzlich wichtig und das Unwichtige unwichtig.
Zeit also, denkt er und liest die Nachricht auf dem Handy. Da steht: „Es ist gerade vier Uhr geworden. Die Stunde des Umbruchs ist vorüber. Habe gerade eine Rede gehalten, die drei Familienmitglieder dazu brachte zu kotzen. Ich sage nicht, welche. Hast du in der Besuchsstunde heute Abend Zeit für einen Weißfinnen?“
Und da, im selben Moment, in dem sich weit in der Ferne die Brücke wieder senkt und das schwarze Schiff im Goldglanz verschwindet, fängt Viggo Norlander an zu lachen. Er lacht so, dass er weint, und er weint so, dass er lacht. Ein Glück, dass niemand ihn hört.
Als ob das noch eine Rolle spielte, denkt er und schreibt ein nachdrückliches „Ja!“ als Antwort. Er schickt die knappe SMS ab, während er sich erhebt, streicht sanft über sein weiches Amulett in der anderen Tasche und denkt, während er sich auf seinen stolpernden, schmerzerfüllten Spaziergang zurück zum Söder-Krankenhaus macht: Die Stunde des Umbruchs?
Dann denkt er: Ja, Arto, natürlich ist es so. Natürlich gibt es eine Stunde des Umbruchs.
Und damit verlassen wir ihn. Ein weiterer Mensch weckt noch unsere beharrliche Aufmerksamkeit, und das ist in einem ganz anderen Teil der Stadt. Wir heben von der deutlich sichtbaren Hubschrauberplattform des Söder-Krankenhauses ab, bewegen uns von dort in nördlicher Richtung über ganz Södermalm, über Slussen und quer über Gamla Stan, vom Binnensee zum Meer und weiter von Strömmen bis zur Meerenge Nybroviken über die Landzunge Blasieholmen. Und von da geht es durch Östermalm, bis zu einer noch vor Kurzem landesweit bekannten, inzwischen stillgelegten norwegischen Ölbank in der Nähe des Karlaplan, die vor einigen Jahren eine merkwürdige Geiselnahme erlebte, inklusive Evakuierung und Stürmung. Jetzt steht dort ein Obst- und Gemüseladen, und die Zeit vergeht so schnell, dass sich niemand mehr an die dramatischen Tage zu erinnern scheint, niemand außer einer blonden Frau, die allein in einem Straßencafé gegenüber des Östra-Reals-Gymnasiums sitzt. Tatsache ist, dass ihr Blick fest auf die ehemalige Bank gerichtet ist, quer durch das Grün des Mittelgangs in dem ursprünglichen Esplanadensystem. Vielleicht sollte er ganz woandershin gerichtet sein, wie es auch ihre Absicht gewesen war, als sie sich hier niederließ, in dem Café mit Schwedens allerhöchster Promidichte. Vielleicht ist sie auch nur, wie sie sich einredet, einfach vorbeigekommen und hat völlig unerwartet im Café Foam auf den angesagtesten paar Hundert Metern von Karlavägen einen unbesetzten Tisch im Freien entdeckt.
Sie hat auch schon ein paar Promis gesehen, vielleicht nicht gerade die heißesten, aber immerhin Leute, die sie aus dem Fernsehen kennt. Natürlich ist sie nicht hergekommen, um Promis anzugaffen. So tief ist sie nicht gesunken. Aber sie muss zugeben, dass sie sich wohl doch hier befindet, weil die Klientel stimmt. Die richtigen Männer eben. Die richtigen Männer für sie.
Das ist Lena Lindbergs Erkenntnis nach einem gut dreißigjährigen Singledasein – mit einer einjährigen Ausnahme, auf die sie nicht so begeistert zurückblickt. Das Jahr mit Geir, der einmal Sicherheitschef der Bank dort drüben auf der anderen Seite von Karlavägen war. Das war ein dunkles Jahr, und sie suchte das Dunkle, zusammen mit Geir. Aber es war nicht das Richtige, so fühlte es sich nicht an. Sie ist nicht die, die sie geglaubt hatte, die sie gefürchtet hatte zu sein. Ihre Aggressionen waren nicht dieser Art. Sie konnte sie nicht in einer sadomasochistischen Klubwelt ausleben, wo sie sich zwar austobte, sich aber nie wirklich zu Hause fühlte. Die Erkenntnis, zu der sie gelangte, war, dass weibliche Aggression genauso normal ist wie männliche und dass Gewalt für Frauen wie für Männer ein paradoxer Ausweg sein kann. Weibliche Gewalt richtet sich keineswegs nur nach innen, wie das Klischee behauptet, sie kann sich ebenso gut nach außen richten. Mädchengangs, die in der Stadt ihr Unwesen treiben, und Frauen, die Männer misshandeln – oder einander –, werden immer häufiger. Vielleicht kann man es Entwicklung nennen.
Aber Lena Lindberg selbst sieht es nicht so. Sie hat ihren Anteil an Gewalt gehabt – auch, wie sie zu ihrer Schande gestehen muss, im Dienst –, und jetzt reicht es ihr. Sie sucht einen normalen, aber eleganten – und, ja, nach Möglichkeit gut betuchten – Mann. Im letzten Jahr war hier Ebbe, wenn auch nicht gänzlich Flaute herrschte. Sie hat es immer noch drauf, Männer aufzureißen.
Es ist klar, dass man an einem so sonderbar stillstehenden Sonntagnachmittag in einem Café, so trendy es auch sein mag, nicht einfach so jemanden aufreißen kann, aber vielleicht lässt sich der eine oder andere Kontakt herstellen, der sich als nützlich erweisen könnte.
Keiner in ihrem Bekanntenkreis ist mehr Single. Sie ist sozusagen übrig geblieben. Und das macht keinen Spaß. Aber hat es das Alleinsein je gemacht? War es nicht einfach nur – bequem? Vielleicht. Aber warum nicht? Doch auch das hat seine Zeit, und die ist jetzt abgelaufen. Sie will einfach nicht ganz allein den Herbst durchfrieren. Sie will sich irgendwo ankuscheln.
Und warum sollte sie es nicht an einem arbeitsfreien Sonntag versuchen? Auch wenn die letzte Stunde wirklich sonderbar stillstand. Anderseits hatte sie über ihr Leben nachdenken können. Der Beschluss war zwar lange vorher gefasst gewesen, aber erst während der letzten Stunde hat sie ihn ernsthaft formuliert.
Ich brauche einen Mann.
Das Café Foam ist hip und angesagt, und der Bereich auf dem Bürgersteig erstreckt sich fast bis zur Ecke Jungfrugatan.
Lena Lindberg fixiert das Straßenschild. Jungfrugatan. Hier auf Östermalm klingen alle Namen so fein. Sie hat selbst ein Jahr lang am Götgatsbacken mitten in Södermalm gewohnt, das hat gereicht, um die spezifische Södermalm-Stimmung, die gerade dort herrscht, ein wenig sattzubekommen. Jeden Abend dieses ewige postpubertäre Gegröle. Wie so oft im Leben sucht sie jetzt wieder etwas anderes. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner.
Sie weiß nicht, dass die Jungfrugatan, die sich heute so friedlich und anonym von der Hedwig-Eleonora-Kirche unten am Östermalmstorg zum Valhallavägen hinaufzieht und dort in einer eigentümlichen Biegung endet, in der Vergangenheit einen sehr schlechten Ruf hatte. Schon Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie als ein „stinkender Sammelplatz“ bezeichnet, und hundert Jahre später lag an ihrem oberen Ende ein grässlicher Tümpel ohne Ablauf, in den zwanzig Haushalte und eine Wäscherei ihr Abwasser entließen.
Lenas Blick ist noch auf das Straßenschild gerichtet, als sie in der Ferne Sirenen hört. Jungfrau, denkt sie. Ja, das ist lange her. Die Sirenen nehmen an Lautstärke zu. Ihr ist es egal. Man hört heute so viele Sirenen in der Stadt. Sie versucht sich zu erinnern, wie sie als Jungfrau war, aber es gelingt ihr nicht recht. Die Sirenen werden immer lauter. Erst als sie im Augenwinkel unten beim Humlegården das Blaulicht sieht, wendet sie den Blick zum Karlavägen. Da sieht sie, dass es ein Polizeiwagen ist, der die Straße heraufkommt. Und als er mit kraftvollem Quietschen genau an der Kreuzung zur Jungfrugatan abbremst, quer über die Allee des Karlavägen schwenkt und am Café Foam vorbeirauscht, ist sie bereits aufgestanden und hat einen viel zu großen Schein auf den Tisch fallen lassen. Und schon spurtet sie los. Sie läuft um die Ecke in die Jungfrugatan und sieht den Polizeiwagen fünfzig Meter weiter mit quietschenden Reifen anhalten, sieht drei Polizisten herausspringen und in einen Laden unmittelbar hinter der nächsten Kreuzung stürmen, der ein Videoverleih sein muss, und sie läuft hinterher. Es ist ein Instinkt, den Lena Lindberg nicht kontrollieren kann, er ist immer wach. Und sie rennt die Jungfrugatan hinauf, quert die kleine Tyskbagargatan und erreicht den Laden. Es ist tatsächlich ein ziemlich unansehnlicher Videoverleih, der dort mitten in Östermalm liegt, und als sie auf Höhe des Polizeiwagens ist, blickt sie durch ein Schaufenster, an dem eine DVD-Hitliste leicht antiquierten Datums hängt, und sieht zwei Polizisten, die sich über jemanden beugen, der am Boden liegt, den Schuhen nach zu urteilen eine Frau. Ein Mann steht mit hoch erhobenen Händen hinter der Theke, und der dritte Polizist hat zwei Kunden gepackt und drückt sie gegen ein Spielfilmregal.
Sie tritt ein. Die Polizisten brüllen sie an, doch sie hält ihren Polizeiausweis hoch und schneidet ihnen das Wort ab. Es ist genau wie erwartet – das dem Anschein nach zarte Geschlecht muss seine Autorität immer extra behaupten. Sie befiehlt: „Gebt mir einen kurzen Lagebericht.“
Als einer der Polizisten aufsteht, wird die Liegende sichtbar. Es ist eine Frau von knapp zwanzig Jahren, sie ist bewusstlos, und ihr Gesicht blutet. Der Streifenpolizist sagt: „Raubüberfall anscheinend. Maskierter Mann, hat sich ein paar Hunderter geschnappt, diese Frau hier hat er auf dem Weg hinaus umgenietet. Drei Zeugen, einschließlich des Ladeninhabers.“
„Ist ein Krankenwagen unterwegs?“, fragt Lena Lindberg.
„Ja“, sagt der Streifenbeamte. „Der scheint nötig zu sein.“
Sie geht zu dem Ladeninhaber hinter der Theke, einem Mann von knapp vierzig Jahren mit ausländischem Aussehen. Er hält immer noch die Hände hoch.
„Die können Sie jetzt runternehmen“, sagt sie, und er tut es, steif, vorsichtig, als wisse er nicht, wem er eigentlich vertrauen kann.
„Drogensüchtiger“, sagt er schließlich. „Ganz klar Drogensüchtiger. Er hatte das Gesicht maskiert, aber er zitterte so, wie man es von ihnen kennt.“
„Wie sah er aus?“
„Schwarze Gesichtsmaske, tief hängende Jeans, Turnschuhe.“
„Jacke?“
„Grün, glaube ich.“
„Und was sagen Sie?“, ruft Lena Lindberg in den Laden. „Trug er eine grüne Jacke?“
„Ich glaube, ja“, antwortet der Zeuge, der mit dem Rücken an das Regal mit den Komödien gedrückt dasteht.
„Ja“, sagt die Zeugin neben ihm. „Militärgrün mit Kapuze.“
„Schuhe?“, fragt Lena unbeirrt weiter.
„Sie waren weiß“, sagt der Mann, und der Inhaber des Ladens nickt schwach. Die Frau schüttelt unsicher den Kopf.
„Wann ging der Alarm ein?“, fragt Lena schnell.
Es dauert eine Weile, bis die Polizisten begreifen, dass sie mit ihnen spricht. Sie muss die Frage ein zweites Mal stellen, bedeutend lauter, bevor der Polizist, der vorher schon gesprochen hat, antwortet: „Vor ein paar Minuten, wir waren im Humlegården.“
„Raus!“, ruft sie. „Raus und jagt ihn! Auf dem Karlavägen ist er nicht herausgekommen, also ist er entweder die Tyskbagargatan hinunter oder zum Valhallavägen hochgelaufen. Valhallavägen ist am wahrscheinlichsten. Ich kümmere mich hier.“
Die drei Streifenpolizisten betrachten einander skeptisch, bevor sie reagieren. Sie sind es offenbar nicht gewohnt, zur rechten Zeit zu kommen. Dass sie noch eine Chance haben, den Täter zu schnappen.
Als sie sich endlich nach draußen bewegen, ruft Lena Lindberg ihnen nach: „Militärgrüne Jacke mit Kapuze, hängende Jeans, weiße Turnschuhe, möglicherweise eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Macht Tempo jetzt!“
Als die Tür im Begriff ist, sich hinter ihnen zu schließen, macht die Zeugin ein paar Schritte in die Richtung, greift zum Türgriff und will auch hinaus.
„Aber hallo!“, ruft Lena. „Sie bleiben alle hier.“
„Ich dachte …“, sagt die Frau vage und stellt sich wieder vor das Regal mit den Komödien.
„Kommen Sie her, Sie beide“, befiehlt Lena und dirigiert mit einem gewissen handfesten Nachdruck den Zeugen und die Zeugin fluchtsicher in ihr Blickfeld hinter die am Boden liegende Frau. Sie beugt sich über sie und fühlt ihr den Puls. Er wirkt stabil. Aber die Frau scheint schwer mitgenommen zu sein. Und sie ist noch immer bewusstlos. Lena prüft, ob sie gleichmäßig atmet, und bringt sie in die stabile Seitenlage. Dann ruft sie mit dem Handy in der Zentrale an und fragt nach, ob der Krankenwagen wirklich unterwegs sei. Er ist es.
Sie hebt einen warnenden Zeigefinger in Richtung der beiden Zeugen und wendet sich dem Ladeninhaber zu: „Was ist passiert?“
Der Ladeninhaber, der sich inzwischen an das forcierte Tempo gewöhnt zu haben scheint, sagt forsch: „Die drei hier waren im Laden, als er hereingestürmt kam, die Frau, die er niedergeschlagen hat, wollte gerade bezahlen, die anderen standen an den Regalen. Er stürmte herein und rief: ›Alles Geld her, aber fix!‹“
„Hatte er eine Waffe?“
„Er fuchtelte mit etwas herum, das wie eine Pistole aussah. Ich hab ihm meine ganze Tageskasse gegeben, mindestens fünftausend Kronen. Nicht ›ein paar Hunderter‹, wie der andere Polizist gesagt hat.“
„Und Sie haben ihm das Geld einfach gegeben, ohne Umstände?“
„Ja. Das Beste ist, sie so schnell wie möglich loszuwerden. Sie kommen vom Humlegården herauf, da sammeln sie sich. Alle behaupten, im Humlegården gäbe es keine Drogensüchtigen, aber es gibt sie, das kann ich Ihnen sagen.“
„Alle?“
„Die Polizei. Die Gesellschaft. Stockholms Kommune. Sie.“
„Und warum hat er dann diese Frau niedergeschlagen?“
„Das weiß ich nicht“, sagt der Ladeninhaber. „Es war völlig unnötig. Sie hat gar nichts gemacht.“
„Sie stand wahrscheinlich zu dicht dabei“, sagt der Zeuge, ein stilechter Östermalm-Herr in gehobenem Alter.
„Hat er sie mit dem, was eventuell eine Pistole war, geschlagen?“, fragt Lena Lindberg mit einem schrägen Blick auf den Mann, der offenbar ein unerträglicher Besserwisser ist.
„Ich glaube schon“, antwortet der Ladeninhaber. „So habe ich es wahrgenommen.“
„Ich hatte das Gefühl, dass es irgendeinen Kontakt zwischen ihnen gab“, erklärt der Zeuge. „Als ob er sie erkannt hätte oder sie ihn.“
„Oder er hasst Frauen“, sagt die Zeugin, und erst jetzt sieht Lena Lindberg, wie unglaublich schmal sie ist. Sie ist in ihrem Alter, um die dreißig, aber auffällig schlank wie ein Model.
„Wie sah der Ablauf genau aus, Ihrer Ansicht nach?“, fragt Lena und nickt dem Zeugen zu.
Der kratzt sich einen Moment am Kopf und sagt schließlich: „Er bekam das Geld anstandslos, das stimmt. Uns Kunden hat er erst beachtet, als er das Geld hatte und sich umdrehte. Er stutzte einen Augenblick, als er diese junge Frau sah, die Ärmste. Und dann schlug er zu.“
„Und er hat nichts gesagt?“
„Nichts außer: ›Alles Geld her, aber fix.‹“
„Haben Sie gesehen, ob die Frau irgendwie reagiert hat?“
„Ich kann nicht behaupten, dass ich ihr etwas anderes angesehen hätte als puren Schock.“
„Gibt es noch etwas, was Sie so spontan sagen können?“
Das können sie nicht. Alle drei schütteln den Kopf, und Lena fragt: „Eines nur noch: Hatte er Handschuhe an?“
Die drei sehen sich an, schließlich antwortet der Ladeninhaber: „Ich glaube nicht …“
„Was wollten Sie beide hier?“
„Ich wollte natürlich einen Film ausleihen“, erklärt der seriöse Zeuge beinahe gekränkt.
„Ich auch“, sagt die bindfadendünne Zeugin. „Eine Komödie.“
„Wir müssen Sie noch einmal in Ruhe auf dem Revier vernehmen. Ich möchte Ihre Ausweise sehen und brauche Ihre Handynummern und Anschriften.“
Sie nimmt die Führerscheine der beiden entgegen, schreibt Namen und Personennummern auf, und die übrigen Angaben müssen sie selbst hinzufügen.
Da hört man entfernte Sirenen. Sie kommen rasch näher. Als die Krankenwagenbesatzung in den Laden stürzt und sich über die liegende Frau beugt, sagt Lena Lindberg zu den Kunden und dem Ladenbesitzer: „Sie sind nicht nur Zeugen. Sie sind auch Opfer eines Verbrechens. Braucht jemand von Ihnen Hilfe, um das Erlebte zu verarbeiten?“
Die Reaktionen der drei gleichen sich. Der Zeuge lächelt überlegen, die Zeugin schüttelt kurz den Kopf, und der Inhaber des Verleihs fragt: „Wer kümmert sich dann um meinen Laden?“
„Niemand“, entgegnet Lena Lindberg, „denn wir müssen hier eine kriminaltechnische Untersuchung vornehmen. Der Täter kann Fingerabdrücke und DNA-Spuren hinterlassen haben.“
Der Ladeninhaber sackt mit einem Seufzen in sich zusammen. Lena ruft bei der Einsatzzentrale an, um die Spurensicherung anzufordern, und erhält die Auskunft, dass jemand von höherer Stelle sie zurückrufen werde. Sobald der Krankenwagen mit der verletzten Frau abgefahren ist, entlässt sie die beiden Zeugen mit der Aufforderung, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag darauf zum Verhör im Polizeipräsidium einzufinden.
Schon jetzt hofft Lena Lindberg, dass sie diesen Fall selbst übernehmen darf. Es müsste, müsste, müsste Zeit dafür sein.
Denn so überlastet ist die A-Gruppe gegenwärtig nicht.
Dann fällt es ihr wieder ein. Sie sieht sich in dem Videoladen um, der offenbar auch als Wettagentur für Trabrennenthusiasten dient. Sie erinnert sich, dass sie etwas gesehen hat, genau in dem Moment, als sie hereinkam, doch da war anderes wichtiger gewesen.
Sie kehrt zu dem Augenblick zurück, in dem sie den Laden betritt. Sie sieht die Regale mit Videokassetten und DVDs. Sie denkt: Gibt es immer noch Leute, die Videorekorder haben, klassische VHS? Und unmittelbar bevor ihr Blick sich auf das konzentriert, worauf er sich konzentrieren soll – die drei Streifenpolizisten, die drei Kunden, den Ladeninhaber mit noch immer erhobenen Händen –, streift er ein Regal mit Videofilmen an der Wand hinter der Theke. Ganz oben auf dem Regal sieht sie, zwischen sehr verstaubten Videokassetten, etwas hervorschauen, das einem kleinen Auge ähnelt.
Sie blickt genauer hin. Und tatsächlich sieht das dort oben wie ein kleines Auge aus. Sie zeigt darauf. Der Blick des Ladeninhabers folgt ihrem Zeigefinger.
„Ist das dort oben das, was ich vermute?“
Der Ladeninhaber hebt die Hände in einer resignierten Geste und erklärt: „Das funktioniert schon seit Jahren nicht mehr.“
Sie blickt in das seltsame Auge, tritt näher und steigt auf einen Stuhl. Sie sieht die Kabel in der Wand verschwinden. Sie geht in den Raum dahinter und folgt den Kabeln, die an einer sehr schäbigen Wand abwärtslaufen und direkt zu einem Computer führen, dessen Monitor schwarz ist. Sie bewegt die Maus ein wenig über das Mousepad, und der Bildschirm leuchtet auf. Der Ladeninhaber ist darauf zu sehen, er steht da und schaut ihr misstrauisch hinterher.
Sie geht zurück in den Laden und fixiert ihn. Sein Blick will sich nicht fixieren lassen. Er sträubt sich und weicht aus, flackert.
„Was haben Sie sich dabei gedacht?“, fragt sie ruhig. „Wollten Sie sich ihn selbst vornehmen? Ein paar Verwandte zusammentrommeln und ihm eine Tracht Prügel verpassen?“
„Es ist das vierte Mal in drei Monaten, dass diese Junkies mich ausrauben“, antwortet er unwirsch. „Die Polizei tut ja nichts dagegen. Wenn man in diesem Land Gerechtigkeit will, muss man sie in die eigene Hand nehmen.“
Lena Lindberg denkt über die ausgefallene sprachliche Konstruktion nach und sagt dann langsam: „Diesmal wird sie etwas tun. Das verspreche ich Ihnen.“
Sie sehen sich in die Augen. Der Blick des Ladeninhabers flackert nicht mehr. Dann nickt der Mann langsam.
„Okay“, sagt er. „Ich mache Ihnen eine Kopie von der Videodatei.“
„Gut“, entgegnet sie. „Aber rühren Sie nichts an, bevor die Spurensicherung dagewesen ist. Kommen Sie mit nach draußen.“
Sie treten hinaus auf die Jungfrugatan. Der Streifenwagen kommt gerade zurück. Einer der Streifenpolizisten streckt den Kopf aus dem heruntergelassenen Fenster auf der Beifahrerseite und sagt: „Keine Spur von ihm. Sorry. Er muss es zur U-Bahn hinunter geschafft haben.“
In dem Moment, als ihr Handy klingelt, begegnet ihr Blick dem des Ladeninhabers. Er ist sehr dunkel. Am Telefon teilt der Leiter der Kriminaltechniker ihr mit, dass ein Team auf dem Weg sei und in ein paar Minuten eintreffen dürfte.
„Rührt jetzt nichts an, zum Teufel“, ist das Letzte, was sie von ihm hört, ehe sie ihn wegklickt.
Lena Lindberg sieht sich um und denkt, dass der Sonntag eine ganz andere Wendung genommen hat, als sie es sich vorgestellt hatte. Aber nicht notwendigerweise zum Schlechteren. Dies hier nahm sich nachgerade wie ein Fall aus. Beinahe ein richtig echter Fall.
Die Stunde des Umbruchs ist vorüber. Die Zeit hat sich gehäutet.
Als sie das Gesicht zum klarblauen Himmel hebt und ein paar tiefe Atemzüge macht, spürt sie, dass es ernstlich Herbst geworden ist in Stockholm.
„Ein Muss für alle Kenner skandinavischer Kriminalliteratur, international, spannend, auf der Höhe der Zeit.“
„›Bußestunde‹ ist düster und fesselnd, die Konflikte alt und doch immer wieder neu in ihren wechselnden Konstellationen; Paul Hjelm und das A-Team werden uns fehlen.“
„Jetzt ist das Finale endlich auch bei uns erhältlich. Und es ist furios!“
„Ein Kracher, dieser Arne Dahl!“
„Grandios, wie Dahl hautnah an den Figuren erzählt und doch das große Ganze einfängt.“
„Hochspannung pur!“
„Sollte es Dahl ernst sein mit seiner - ganz grandiosen - Abschiedsvorstellung, wäre es ein großer Verlust für Europas Krimilandschaft.“
„Großartiges Finale der Thrillerserie.“
„Dahl schafft es, die Verbrechen auf eine individualpsychologische Ebene herunterzubrechen - trotz allgemeingültiger Aussagen über Gewalt an und Gewalt von Frauen.“
„Mit ›Bußestunde‹ legt Arne Dahl einen fulminanten Abschluss seiner großartigen Serie um die Stockholmer A-Gruppe vor.“
„Ein würdiges Ende für eine der besten Krimi-Reihen, die es je gab.“
„Ein hochspannendes Finale (...) ein würdiger Abschied von einer der besten schwedischen Krimi-Serien.“
„Der letzte Fall der legendären A-Gruppe ist ein Glücksfall, der das Ende der Privatheit im Zeitalter des universellen Abfotografiertwerdens verhandelt.“
„Der Krimi ist ein liebevoll gestalteter Abschied vom alten Einsatzbereich der A-Leute. Wie immer spannend konstruiert und geschrieben.“
„Furchtbar real, furchtbar fesselnd, ein fulminanter Abschluss!“
„Alter Schwede! Was für ein furioser und spannender Abschluss der zehnteiligen Krimi-Reihe. (...) Arne Dahl zeigt noch einmal, was seine Romane so einzigartig macht: sein souveränes, unaufgeregtes Erzählen, die glaubwürdigen Protagonisten und die anspruchsvollen Plots vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Probleme.“
„Mit dem letzten Band seiner Krimiserie um Paul Hjelm und Kerstin Holm krönt der Arne Dahl seine Arbeit.“
„Ein wirklich gelungener Abschluss für die Reihe um die A-Gruppe.“
„Bestsellerautor Arne Dahl ist ein geschickter Erzähler.“
„Bravouröser Schlussakkord“
„›Bußestunde‹ ist, wie alle Romane von Arne Dahl, ein bis zur letzten Seite überzeugender und hochspannender Krimi.“
„›Bußestunde‹ ist ein intelligent gemachter Polizei-Thriller, verfrickelt, temporeich, spannend und in einem etwas leichteren Ton erzählt als viele Bücher zuvor.“
„Es ist ein fesselnder Thriller, ein krönender Abschluss.“
„Arne Dahl fordert die volle Aufmerksamkeit des Lesers. Und dieser wird mit prächtiger Unterhaltung, basierend auf hoher Spannung, belohnt.“
„Grandioses Finale der Krimiserie.“
„Es ist ein fesselnder Thriller, ein krönender Abschluss.“
„Ein großartiges Buch“












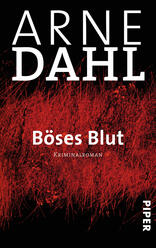



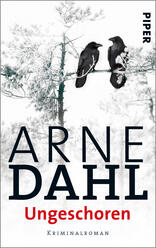
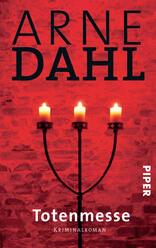


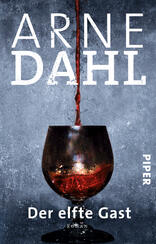



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.