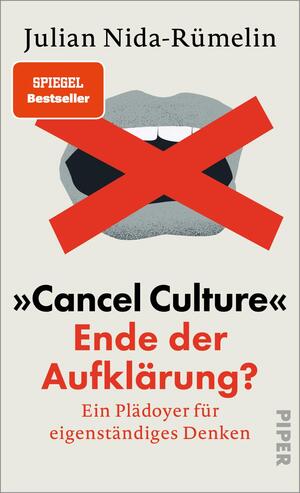
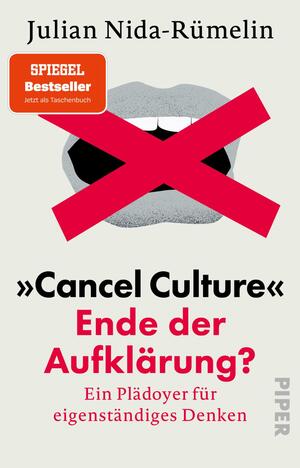
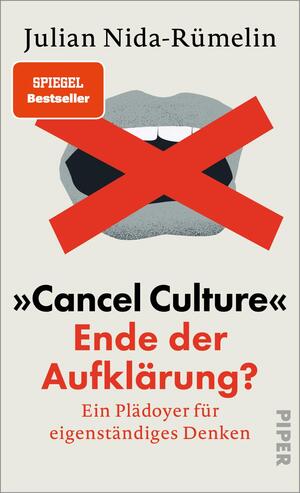
„Cancel Culture“ – Ende der Aufklärung? „Cancel Culture“ – Ende der Aufklärung? „Cancel Culture“ – Ende der Aufklärung? - eBook-Ausgabe
Ein Plädoyer für eigenständiges Denken
— Julian Nida-Rümelin analysiert die neue Kultur der Zensur, Absagen und Löschungen und ihre Auswirkungen auf Meinungsfreiheit und Demokratie. Für offene Debatten auf Augenhöhe!„Ein Plädoyer für die Toleranz.“ - Kleine Zeitung
„Cancel Culture“ – Ende der Aufklärung? — Inhalt
Wo endet Toleranz, wo beginnt Cancel Culture?
„Cancel Culture“ ist ein Reizwort, an dem sich die Geister scheiden: Die einen praktizieren Cancel Culture und weisen entrüstet zurück, dass es sich dabei um eine Form der Zensur handelt – schließlich könnten nur Staaten Zensur ausüben. Die anderen – meist politisch eher konservativ oder auch rechtslibertär – sehen in der Cancel Culture eine große Gefahr für die Demokratie und verteidigen das freie Wort gegen die „Sprachpolizei“ des linksliberalen Mainstreams.
Julian Nida-Rümelin nimmt das Phänomen Cancel Culture zum Ausgangspunkt einer tiefer gehenden Analyse. Tatsächlich ist die Praxis, unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen, uralt. Sie prägt in unterschiedlichen Formen das politische und gesellschaftliche Leben in den meisten Kulturen zu fast allen Zeiten. Wenn man sich gegen diese Praxis der Verfolgung Andersdenkender wendet, verteidigt man die Demokratie als ein Projekt der Aufklärung. Aber was genau ist mit diesem Projekt gemeint? Welche Rolle spielen dabei Pluralität und politische Urteilskraft? Und was ist politische Urteilskraft?
Die Verteidigung von Humanismus und Aufklärung gegen Intoleranz, Ignoranz, Hetze und Diskursverweigerung ist erforderlich, um die Demokratie zu bewahren und zu stärken. Dieses Buch versteht sich als Beitrag dazu.
„Dieser nüchtern-analytische Blick ist – trotz wenigen zugespitzt formulierten Passagen, die aber nicht polemisch wirken – eine wohltuende Abwechslung in der oft emotional aufgeladenen Debatte.“ SWR 2 „lesenswert Kritik“
„Empfehlenswertes Buch“ Das Parlament
Leseprobe zu »„Cancel Culture“ – Ende der Aufklärung?«
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
In diesem Buch geht es nicht um eine Positionierung im ideologisierten öffentlichen Meinungsstreit (siehe den von der Bundeszentrale für politische Bildung publizierten Text von René Pfister: www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/diskurskultur-2023/541851/wie-die-meinungsfreiheit-zum-problemfall-erklaert-wird/), sondern um eine begriffliche und gedankliche Klärung eines Phänomens, das die Kulturgeschichte und die politische Auseinandersetzung der Menschheit von jeher begleitet hat, nämlich den Versuch, missliebige Meinungen [...]
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
In diesem Buch geht es nicht um eine Positionierung im ideologisierten öffentlichen Meinungsstreit (siehe den von der Bundeszentrale für politische Bildung publizierten Text von René Pfister: www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/diskurskultur-2023/541851/wie-die-meinungsfreiheit-zum-problemfall-erklaert-wird/), sondern um eine begriffliche und gedankliche Klärung eines Phänomens, das die Kulturgeschichte und die politische Auseinandersetzung der Menschheit von jeher begleitet hat, nämlich den Versuch, missliebige Meinungen anderer zu unterdrücken und oft genug auch ihre Autoren und Autorinnen.
Die Rezeption der Hardcover Ausgabe von 2023 hat in Deutschland erkennbar zur Rationalisierung der öffentlichen Debatte um das Phänomen „Cancel Culture“ beigetragen. Vielen, die das Buch gelesen haben, wurde nun deutlich, dass Cancel Culture nicht nur links im politischen Spektrum, sondern auch rechts und in der Mitte praktiziert wird und viele haben das Argument des Autors angenommen, dass der Respekt vor abweichenden Meinungen zur Essenz der Demokratie gehört und der zunehmend verbreitete Eindruck, man könne seine Meinung nicht frei äußern, (siehe Allensbach Umfrage aus dem Jahre 2023, wonach nur 40 Prozent der Menschen das Gefühl hätten, ihre politische Meinung frei äußern zu können) ein Warnsignal für eine Fehlentwicklung der politischen Kultur in vielen westlichen Ländern, auch in Deutschland, ist.
Durch die aktuelle internationale Entwicklung mit mehreren Großkonflikten, unter anderem im Gazastreifen, wurden nun diejenigen einem öffentlichem Meinungsdruck ausgesetzt, die zuvor noch unter dem Banner der Solidarität mit den Unterdrückten Cancel Culture praktiziert haben, zum Beispiel Sympathisantinnen des BDS. Im Kulturbetrieb greifen Gesinnungsprüfungen gerade in Deutschland um sich, die zu Ausladungen von Intellektuellen und Künstlerinnen sowie zur Streichung von Fördermitteln führen. Im Bundesministerium für Bildung und Forschung ist es sogar zu dem, bis heute noch nicht vollständig aufgeklärten Skandal gekommen, dass die Leitung prüfen ließ, ob die Streichung von Fördermitteln gegenüber denjenigen Professoren und Professorinnen der Freien Universität Berlin möglich sei, die sich in einem öffentlichen Brief gegen die Räumung eines Pro-Palästina Camps ausgesprochen hatten.
Eine der renommiertesten politischen Philosophinnen weltweit, Nancy Fraser, wurde aus solchen Motiven wieder von der Universität Köln ausgeladen und spricht seitdem von einem in Deutschland um sich greifenden McCarthyismus. Auch die amerikanische und israelische Staatsbürgerin, die jüdische Philosophin Susan Neiman, kritisiert den Meinungsdruck, der gegen Kritiker der israelischen Politik, besonders in Deutschland ausgeübt wird.
Das Thema dieses Buches, die Klärung, was Cancel Culture ist, welche philosophischen und demokratietheoretischen Aspekte es hat und welche Problematik mit dieser kulturellen Praxis verbunden ist, ist also nach wie vor aktuell, vermutlich von weiter wachsender Bedeutung. Daher hat sich der Verlag entschlossen, eine Taschenbuchausgabe mit einer aktualisierten Kasuistik zu publizieren, um die Argumente einem weiteren Kreis von Lesern und Leserinnen zugänglich zu machen.
München und Berlin im Dezember 2024
Julian Nida-Rümelin
Vorwort
Das Wort „Cancel Culture“ ist ein Reizwort, an dem sich die Geister scheiden: Die einen praktizieren Cancel Culture, nennen das zum Beispiel „Deplatforming“ und weisen entrüstet zurück, dass es sich dabei um eine Form der Zensur handelt. Schließlich könnten nur Staaten Zensur ausüben. Die anderen – meist politisch eher konservativ oder auch rechtslibertär – sehen in der Cancel Culture eine große Gefahr für die Demokratie und verteidigen das freie Wort gegen die Sprachpolizei des linksliberalen Mainstreams. Die Auseinandersetzung bezieht dann auch das Thema genderkorrekte Sprache mit ein, weil sich viele durch die Moralisierung des Sprachgebrauchs gegängelt fühlen oder, wie Elke Heidenreich und viele andere Schriftsteller, eine durch öffentlichen Druck erzwungene Verhunzung der Sprache beklagen.
Dieses Buch wird sich allenfalls am Rande mit diesen Querelen und Quisquilien befassen. Vielmehr nimmt es das Phänomen Cancel Culture zum Ausgangspunkt einer tiefer gehenden Analyse. Tatsächlich ist die Praxis, unliebsame Meinungen zum Schweigen zu bringen, uralt; sie lässt sich schon in der Antike verfolgen, und sie prägt in ganz unterschiedlichen Formen das politische und gesellschaftliche Leben in den meisten Kulturen zu fast allen Zeiten.[i] Wenn man sich gegen diese Praxis wendet, und die gibt es eben nicht nur in der Form des Deplatforming, sondern ebenso in populistischer Hetze und Verfolgung Andersdenkender, verteidigt man die Demokratie als ein Projekt der Aufklärung. Aber was genau ist mit diesem Projekt gemeint? Welche Rolle spielen dabei Pluralität und politische Urteilskraft? Und was ist politische Urteilskraft? Welche erkenntnistheoretischen Probleme wirft die Analyse auf, und wie sind diese zu lösen?
Dieser Essay ist also nicht ein weiterer Beitrag zu einem vordergründigen politischen Schlagabtausch, der uns nun schon seit Jahren begleitet, in den USA seit Jahrzehnten, und wohl leider weiter begleiten wird. Es handelt sich um den Versuch einer Klärung der Begriffe und der Argumente. Eine Klärung, die weit über das Ausgangsphänomen der Cancel Culture hinausreicht, die aber notwendig ist, um den aktuellen Gefährdungen der liberalen und sozialen Demokratie und ihren zivilkulturellen Grundlagen entgegenzutreten.
Das Buch ist in Sorge um aktuelle kulturelle Entwicklungen geschrieben, aber doch vom Optimismus eines eingefleischten Humanisten getragen. Die aktuell größte Gefahr für die Demokratie als Staats- und Lebensform geht nicht von linker Cancel Culture aus, sondern – zumindest in den meisten Staaten Europas – von rechtspopulistischen Kräften. Diese werden allerdings durch kulturelle und politische Fehlentwicklungen gestärkt, zu denen die sich ausbreitende Cancel Culture gehört. Zu den internen Herausforderungen der Demokratie gesellen sich zunehmend die externen, die durch den Konflikt alter und neuer Weltmächte und die Verhärtung und Ausweitung autokratischer, diktatorischer und teilweise totalitärer Regime zunehmen. Es mag sogar sein, dass die externen Herausforderungen dazu beitragen, die internen zu bewältigen.[ii]
Die Demokratie als Staats- und Lebensform ist zahlreichen Bedrohungen ausgesetzt: der Verlust ökonomischer Leistungskraft und technologischer Innovationen, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Überforderung durch die Klimakrise, die unzureichende Verfügbarkeit von Ressourcen, wachsende Ungleichheit mit der Folge einer Refeudalisierung etc. Die Erosion der Zivilkultur und des öffentlichen Vernunftgebrauchs ist nur eine dieser Gefährdungen. Wenn sie nicht gestoppt wird, bliebe von der Demokratie im günstigsten Fall nur die äußere Form in Gestalt von Wahlen, Parlamenten und Regierungen, aber ihre Substanz wäre verloren.
Die Gefährdungen der Demokratie haben seit dem Sommer 2021, in dem dieses Buch begonnen wurde, zugenommen: im Inneren der Europäischen Union durch Wahlerfolge rechtspopulistischer Parteien in Schweden und Italien und die weitere demokratische Erosion in Ländern wie Ungarn und Polen. Hinzu kommt die äußere Bedrohung durch internationale Konflikte mit autokratischen und diktatorischen Regimen. In solchen Zeiten ist es besonders wichtig, die Substanz demokratischer Praxis und ihrer kulturellen Grundlagen zu bewahren und, wo sie beeinträchtigt ist, wiederherzustellen. Die Verteidigung von Humanismus und Aufklärung gegen Intoleranz, Ignoranz, Hetze und Diskursverweigerung ist erforderlich, um die Demokratie zu bewahren und zu stärken. Dieses Buch versteht sich als Beitrag dazu.
Cancel Culture in unterschiedlichen Theorien
Zum Begriff „Cancel Culture“
Cancel Culture ist ein uraltes Phänomen, das sich durch die Kulturgeschichte der Menschheit zieht: Praktiken, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, deren Auffassungen von den eigenen in störender Weise abweichen. Manchmal sind diese Praktiken todbringend, wie in den Ketzerprozessen des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Neben der Androhung oder Vollstreckung des physischen Todes gibt es die Praxis des sozialen Todes, des nachhaltigen Ausschlusses aus der Gemeinschaft.
Im Römischen Imperium war die Verbannung neben der Ermordung ein bei Kaisern und anderen Potentaten beliebtes Instrument der Cancel Culture. Der soziale Tod wurde nicht nur von oben dekretiert, sondern auch von unten praktiziert. Vom Scherbengericht in den griechischen Stadtstaaten, das Alkibiades, den Feldherren und lange Zeit Liebling der Athener, mitten im Krieg gegen Syrakus zum Abbruch seiner militärischen Mission und zur Rückkehr nach Athen zwang, um sich dort vor einem Tribunal zu verantworten,[iii] bis hin zu der alltäglichen Praxis des Verächtlichmachens, der Diffamierung, der Denunziation, der üblen Nachrede, der Diskreditierung in den unterschiedlichsten Varianten – meist ohne dass den betroffenen Personen eine faire Chance eingeräumt wird, sich zu verteidigen, sich zu rehabilitieren, den Weg zurück in die soziale Gemeinschaft zu finden. Cancel Culture ist darauf gerichtet, unliebsame Meinungen verstummen zu lassen.
Das Gegenmodell zu den Praktiken der Cancel Culture ist nicht die große Harmonie, die concordia klerikaler oder auch konfuzianischer Prägung, auch nicht die platonische sophrosýne, die Tugend der Besonnenheit, sondern die aufklärerisch gestimmte Kritik. Menschen sind zu theoretischer Vernunft befähigt, sie suchen nach Erkenntnis und wollen Erklärungen für Ereignisse. Zudem sind Menschen in der Lage, so zu handeln, dass sich ihre eigene Praxis in eine vernünftige Struktur der Praxis aller einbetten lässt. Sie sind befähigt zu praktischer Vernunft. Aufklärung in allen ihren Varianten beruht auf diesen beiden miteinander verkoppelten menschlichen Fähigkeiten und ist darauf gerichtet, diese zu aktivieren, zu fördern und die politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen so zu gestalten, dass sie praktisch wirksam werden. Kritik ist ein durchgängiges Merkmal der Aufklärung. Sie beginnt oft genug mit der Kritik von Vorurteilen und von Praktiken, die einem erfüllten menschlichen Leben zuwiderlaufen. Die Kritik an Aberglauben, Pseudowissenschaft, Ideologie und menschenunwürdiger Praxis steht am Beginn der Aufklärung. Die Alternative zur Aufklärung ist Rückfall in Irrationalität und Inhumanität.
Aufklärung als Praxis der Vernunft gründet auf einer optimistischen Anthropologie, sie ist seit Jahrzehnten in der Defensive. Ihre Gegner sind zahlreich und ihre Verteidiger ängstlich. Nicht allen ist bewusst, dass mit ihrem Niedergang nicht lediglich die eine oder andere Überzeugung bedroht wäre, die wir bisher für selbstverständlich gehalten haben mögen, sondern darüber hinaus eine Lebensform, ohne die die Demokratie nicht existieren kann.
Die Stärke des aufklärerischen Projekts ist zugleich ihre Schwäche. Im Vertrauen auf die menschliche Vernunftfähigkeit nimmt sie ihre Kritiker als Gesprächspartner ernst und bekämpft sie nicht als ihre Feinde. Ihre Stärke beruht auf ihrer Universalität und Inklusivität, ihre Schwäche ebenso. Wenn sie sich mit den Mitteln ihrer Feinde, zu denen Cancel Culture ganz wesentlich gehört, verteidigen würde, gäbe sie sich selbst auf. Sie muss sich verteidigen, ohne ihre eigenen Grundlagen zu gefährden.
So versteht sich auch dieses Buch. Es ist ein Gesprächsangebot an diejenigen, die dem Projekt der Aufklärung die Treue halten, aber auch an diejenigen, die sich davon verabschieden. Es appelliert an Vernunft, auch gegenüber ihren Verächtern.
Unter Cancel Culture wird dabei eine kulturelle Praxis verstanden, die Menschen abweichender Meinungen zum Schweigen bringt, indem sie
I. die Äußerung dieser Meinungen unterbindet, behindert oder zumindest erschwert;
II. Personen, die diese Meinungen haben, zum Schweigen bringt, aus dem Diskurs ausgrenzt oder zumindest marginalisiert;
III. Personen, die diese Meinungen haben, tötet, verfolgt oder ihnen Nachteile auferlegt, die die Freiheit ihrer persönlichen Lebensgestaltung beeinträchtigen.
Es handelt sich um drei Eskalationsstufen der Cancel Culture, nach denen sich konkrete historische und aktuelle Fälle gliedern lassen.[iv] Im Zentrum dieses Buches steht aber die systematische Analyse dieses Phänomens mit dem Ziel, die Alternative zu allen Praktiken der Cancel Culture herauszuarbeiten: eine Theorie der Urteilskraft in der Tradition von Aufklärung und Demokratie.
Platon: Der Ursprung aller Cancel Culture?
Platon eignet sich in seiner Ambivalenz gut für einen Einstieg in die Thematik. Der große Philosoph, dessen Schriften von hoher literarischer Qualität sind, plädiert zum Entsetzen vieler seiner Leser in der Politeia dafür, die Künstler, insbesondere die Tragödienschreiber, aus der Stadt zu vertreiben. Dabei wird oft unterschlagen, dass er an späterer Stelle in dieser Schrift erörtern lässt, unter welchen Bedingungen man sie wieder in die Stadt zurückkehren lassen könnte. Der Wissenschafts- und Erkenntnistheoretiker Karl Popper hat daraus das vernichtende Urteil abgeleitet, Platon sei ein radikaler Vertreter der geschlossenen Gesellschaft, dem Urbild der totalitären Diktatur.
Der platonische Sokrates führt für den Vorschlag, die Künstler aus der Stadt zu vertreiben, erkenntnistheoretische, politische und psychologische Argumente an. Das erkenntnistheoretische besagt, dass die Werke der Kunst den Zugang zur Realität verstellen, dass sie Abbildungen von Abbildungen seien. Für Platon gründet die Realität in den tiefer liegenden Strukturen (sogenannten eidé, was irreführend mit „Ideen“ übersetzt wird), die Welt der Erscheinungen hingegen besteht ihm zufolge lediglich aus Schatten dieser Urbilder, von denen wiederum die Kunst mehr oder weniger gelungene Nachbildungen schafft, also statt zur Realität vorzudringen, sich weiter von ihr entfernt.
Das politische Argument besagt, dass die Werke der Kunst die Harmonie in der Stadt gefährden, dass sie aufrührerisch und spaltend wirken. Und das psychologische besagt, dass sie die innere Seelenruhe, die sich für den gerechten Menschen einstellt, der damit die Harmonie der Stadt im wohlgestalteten Verhältnis ihrer Teile widerspiegelt, gefährden. Die Strukturgleichheit von psyché und pólis, der Einzelseele und der politischen Gemeinschaft, beruht bei Platon auf einer strukturellen Theorie des Ganzen, dessen Teile zueinander in einem ausgewogenen, sich wechselseitig stabilisierenden Verhältnis stehen. Die Künste bringen diese Harmonie von psyché und pólis in Gefahr. Die Künstler stören die wohlgeordnete Stadt und die Seelenruhe des Einzelnen.
In der modernen Kunst, insbesondere in der Literatur- und Filmtheorie, ist manchmal von der „Melodramatisierung“ die Rede, die von der Kunst auf die Lebenswelt übergreift.[v] Während Platon die nur in Bruchteilen erhaltene Tragödienliteratur, die das moralische Bewusstsein seiner Zeit prägte, kritisch beurteilte, wendete dies Aristoteles mit seiner kátharsis-Theorie, also der Auffassung, dass die Erschütterungen, die durch den Besuch einer Tragödienaufführung ausgelöst werden, zu einer inneren Reinigung führen, ins Positive; beide scheinen sich jedoch einig darin zu sein, dass die Kunst einen Beitrag zum gelingenden Leben zu leisten habe. Umgekehrt liegt der Schluss nahe, dass sie, sofern sie dies nicht tut, verstummen sollte. Auch in der Hochphase der europäischen Aufklärung hält diese eudämonistische Gesinnung noch an, und das Aufblühen der Wissenschaft oder die Gewährung von Freiheit wird im utilitaristischen Geist als Instrument der Optimierung des allgemeinen Wohlergehens gerechtfertigt.
Die Aufklärung kommt aber erst zu sich selbst, wenn sie die Vielfalt der Erscheinungsformen des menschlichen Geistes als solche und nicht als bloßes Instrument zu anderen Zwecken schätzen lernt. Im Zentrum des Projekts der Aufklärung aber steht der Respekt gegenüber Gründen. Gründe, die für Überzeugungen sprechen – nennen wir sie „theoretische Gründe“ –, und Gründe, die für Handlungen sprechen – nennen wir sie „praktische Gründe“. Es ist allein das bessere Argument, das unsere Überzeugungen leiten sollte, und nicht andere Erwägungen. Epistemische Rationalität bildet den Kern der Aufklärung. Nicht klerikale Autorität oder fürstliche Macht bestimmt, was richtig oder falsch ist, sondern die Abwägung von Gründen pro und kontra. Wissenschaft ist ein Kind der Aufklärung; ohne Aufklärung, ohne die Hochachtung gegenüber dem besseren Argument gibt es keine Wissenschaft.
Dies macht die Ambivalenz der platonischen Philosophie aus: Sie möchte wohlbegründetes Wissen (epistéme) an die Stelle bloßen Meinens (dóxa), bloßer Vorurteile setzen. Sie setzt auf wissenschaftliche und philosophische Rationalität, um das Gemeinwesen zu ordnen und gerecht zu gestalten. Und zugleich fürchtet sie sich vor der Irritation durch Vielfalt und Differenz. Es sind nur die wenigen, die den philosophischen, wissenschaftlichen Weg zu Ende, bis zur Schau des Guten, gehen können, und von den anderen wird sophrosýne erwartet, die sie auf diese wenigen hören lässt. Die wenigen geben die Richtung vor, und die vielen folgen. Und die Wissenden kommen zu einheitlichen Überzeugungen. Vielfalt und Differenz, Meinungsstreit und politische Konflikte sind Ausdruck von Unordnung, die durch reines Wissen behoben werden kann. Aber hier irrt Platon, und ebenso irren viele derjenigen, die diesem Konzept bis heute, meist ohne sich dessen bewusst zu sein, folgen. Wahre Wissenschaft ist vielfältig, sie respektiert den Streit der Hypothesen und Theorien, die beständige Abwägung von Argumenten, die nie enden wollende Suche nach den richtigen Überzeugungen. Sie führt eben nicht zu der einheitsstiftenden Schau des Guten, sondern bleibt auf dem Weg. Sie bezieht alle ein, auch diejenigen, die sich irren. Sie ist irrtumsfreundlich und inklusiv. Wissenschaft ist mit Cancel Culture, mit der Austreibung der Künste, mit der Ausgrenzung unliebsamer Meinungen, mit Ideologisierung und Abschottung unvereinbar.
Im Theaitetos-Dialog geht es Platon um die Frage, was Wissen sei. Und nachdem alle alternativen Wissensdefinitionen gescheitert sind, insbesondere diejenigen, die Wissen als bloßes Instrument für Macht oder Reichtum verstehen, führt Sokrates seine Gesprächspartner zu dem Ergebnis, Wissen sei wohlbegründete, wahre Meinung. An einer Stelle wendet er sich gegen die Wortstreit-Künstler, die im Kampf der Meinungen obsiegen wollen, denen es aber nicht darum geht, herauszufinden, wie es sich tatsächlich verhält.
Dieser Theaitetos-Dialog kann durchaus als eines der ersten, beeindruckendsten Dokumente des Projekts der Aufklärung gelten. Wissen ist begründete, wahre Meinung, und das Abwägen von Gründen hat das Ziel, Irrtümer zu beheben und Wissen zu erreichen. Das Ringen um das bessere Argument ist entgegen einer verbreiteten zeitgenössischen Auffassung kein Machtkampf. Niemand wird besiegt, wenn sich herausstellt, dass ein Argument, das die betreffende Person vorgetragen hat, irrig ist. Niemand obsiegt in einem Machtkampf, wenn er mit seinem Argument überzeugen konnte. Der Austausch von Argumenten, das Abwägen von Gründen pro und kontra, hat seine eigene Logik, und diese lässt sich in den Kategorien der Macht ebenso wenig rekonstruieren wie in den Kategorien des Interesses. Dies ist das Ergebnis des Theaitetos-Dialogs. Wir verstehen es als Zentrum des Projekts der Aufklärung. Wer dieses Zentrum aufgibt, fällt zurück in dunkle, eben voraufklärerische Zeiten, in denen Argumente nicht für sich selbst stehen, sondern bloße Mittel sind, um anderes als Wissen zu erreichen, zum Beispiel Macht oder Reichtum.
[i] Im Kapitel Kasuistik ist am Ende des Buches eine Reihe von Beispielen aus unterschiedlichen Epochen und Kontexten zusammengestellt.
[ii] So hat der vom russischen Präsidenten angeordnete Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nur die Europäische Union in wichtigen Fragen zusammengeführt, sondern auch das zuvor erodierende transatlantische Bündnis. Zugleich führt die sicherheitspolitische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten dazu, dass die insbesondere von Frankreich, aber auch von anderen europäischen Staaten avisierte außenpolitische Souveränität Europas als Beitrag zu einer globalen Friedensordnung in weite Ferne rückt. Welche Folgen die ökonomische und soziale Krise im Gefolge dieser internationalen Konflikte für die Demokratieentwicklung langfristig haben wird, lässt sich schwer abschätzen. Krisenzeiten und Kriegszeiten sind dem offenen Meinungsaustausch, der Zivilkultur des Respekts und der Anerkennung selten günstig gewesen. Vgl. Julian Nida-Rümelin et al.: Perspektiven nach dem Ukrainekrieg. Freiburg i. Br.: Herder 2022.
[iii] Plutarch: Nikias 11 und Alkibiades 13 (417/15 v. Chr.). Es handelte sich um das letzte Scherbengericht (Ostrakismos). Das Verfahren richtete sich am Ende gegen den Antragsteller Hyperbolos selbst, was diese Form des Volksentscheids offensichtlich so stark diskreditierte, dass das Scherbengericht in Athen nicht mehr durchgeführt wurde.
[iv] Vgl. die von Nathalie Weidenfeld zusammengestellte Sammlung von Beispielen am Ende des Buches unter dem Titel „Cancel Culture: Eine kleine Kasuistik“.
[v] Vgl. Nathalie Weidenfeld: Das Drama der Identität im Film. Marburger Schriften zur Medienforschung 2012; Dies.: „Das große Beichten“. Süddeutsche Zeitung vom 19. 12. 2018.
„Eines der 10 wichtigsten Bucher des Jahres 2023, weil es einen absoluten Zeitgeist aufgreift.“
„Empfehlenswertes Buch“
„Dieser nüchtern-analytische Blick ist – trotz wenigen zugespitzt formulierten Passagen, die aber nicht polemisch wirken – eine wohltuende Abwechslung in der oft emotional aufgeladenen Debatte.“
„Die Klarheit und Stringenz von Nida-Rümelins Argumentation ist bestechend, beeindruckend sein bedingungsloses Festhalten an Rationalität und Diskurs.“
„Dieser fesselnde Essay geht über oberflächliche Kontroversen hinaus und beleuchtet ›Cancel Culture‹ als Teil eines tieferen Verständnisses von Demokratie und Aufklärung. Eine wertvolle Analyse, die zur Klarheit und Verteidigung fundamentaler demokratischer Prinzipien beiträgt.“
„Ein Plädoyer für die Toleranz.“
„Er nimmt seine Leser mit auf eine philosophische Reise und weckt wohlmöglich durch seine anschauliche Schreibe einen Wissenshunger.“
„Das Buch ist ein Spaß und eine Bereicherung für jeden, der Philosophie mag und der von ihr Antworten auf die großen Kämpfe in unserer Gesellschaft haben möchte!“










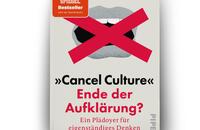
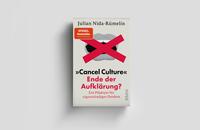
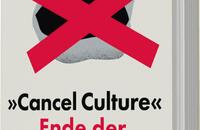
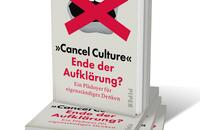
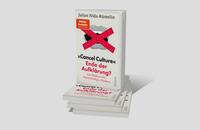


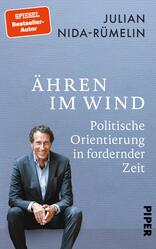
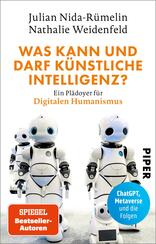

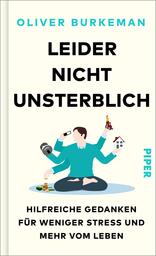





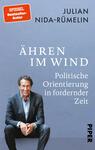


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.