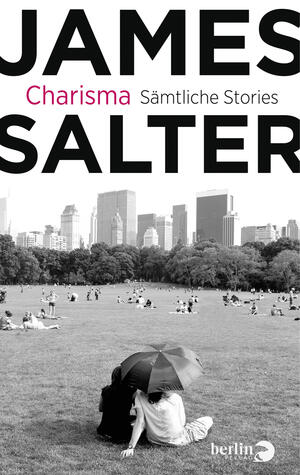
Charisma - eBook-Ausgabe
Sämtliche Stories & drei literarische Essays
„Während seine Romane ›Ein Spiel und ein Zeitvertreib‹, ›Lichtjahre‹ und ›Alles, was ist‹ als Klassiker gelten, sind seine Erzählungen bislang nur das, womit er sich zwischendrin schwertat. Aber sie haben ihren eigenen, exquisiten Ton. Schneller geschnitten, dramaturgisch verwegener aufgebaut, voller Falltüren, die sich hinter einem schließen und selbst schlechte Liebhaber nicht lächerlich erscheinen lassen.“ - Der Tagesspiegel
Charisma — Inhalt
Dieser Band versammelt die Kurzgeschichten eines der besten Autoren unserer Zeit. „Salter schreibt mit Kenntnis, Präzision und Witz ... Die frühen Geschichten aus den sechziger bis hin zu den achtziger Jahren haben einen jazzigen Rhythmus und den aalglatten, kühlen Glanz der Welt von Mad Men. ... Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts und das World Trade Center befindet sich gerade erst in der Planung. Was kann schon schiefgehen? Und doch geht am Ende so ziemlich alles schief … Salter ist ein Zauberer und seine Wunderwerke sind fein gewirkt, und doch vermögen sie, die alltägliche Wirklichkeit des Lebens kraftvoll zu packen. Wieder und wieder gelingt ihm auf diesen Seiten, was John Updike als die Aufgabe des Schriftstellers definiert hat, nämlich dass er das ›Schöne am Gewöhnlichen‹ zu zeigen habe. Salter zeigt das Gewöhnliche als das, was es wirklich ist: das Wunderbare.“ John Banville
Leseprobe zu „Charisma“
Am Strande von Tanger
Barcelona im Morgengrauen. Die Hotels sind dunkel. Alle großen Alleen weisen aufs Meer.
Die Stadt ist leer. Nico schläft. Sie ist gefesselt von verdrehten Laken, ihrem langen Haar, einem nackten Arm, der unter ihrem Kissen liegt und über die Bettkante hängt.
In einem Käfig, der sich unter einem Tuch aus indigoschwarzer Seide abzeichnet, schläft ihr Vogel, Kalil. Der Käfig befindet sich in einem offenen, ausgefegten Kamin. Daneben stehen Blumen und eine Schale mit Obst. Kalil schläft, sein Kopf unter der Weichheit eines Flügels.
Malcolm [...]
Am Strande von Tanger
Barcelona im Morgengrauen. Die Hotels sind dunkel. Alle großen Alleen weisen aufs Meer.
Die Stadt ist leer. Nico schläft. Sie ist gefesselt von verdrehten Laken, ihrem langen Haar, einem nackten Arm, der unter ihrem Kissen liegt und über die Bettkante hängt.
In einem Käfig, der sich unter einem Tuch aus indigoschwarzer Seide abzeichnet, schläft ihr Vogel, Kalil. Der Käfig befindet sich in einem offenen, ausgefegten Kamin. Daneben stehen Blumen und eine Schale mit Obst. Kalil schläft, sein Kopf unter der Weichheit eines Flügels.
Malcolm schläft. Seine stahlgerahmte Brille, die er nicht braucht – die Gläser sind ungeschliffen –, liegt geöffnet auf dem Tisch. Er schläft auf dem Rücken, seine Nase zieht durch die Traumwelt wie ein Kiel. Diese Nase, die Nase seiner Mutter oder zumindest eine Kopie der Nase seiner Mutter, ist wie ein theatralisches Requisit, eine merkwürdige Verzierung, die ihm ins Gesicht geklebt wurde. Sie ist das Erste, was einem an ihm auffällt. Das Erste, was man an ihm mag. Die Nase ist in gewissem Sinne ein Zeichen von Lebenslust. Es ist eine große Nase, die man nicht verstecken kann. Außerdem hat er schlechte Zähne.
An den Spitzen der vier steinernen Türme, die Gaudi unvollendet ließ, werden durch das Licht langsam goldene Inschriften sichtbar, zu blass, um sie entziffern zu können. Es scheint keine Sonne. Es herrscht nur weiße Stille. Sonntagmorgen, der frühe Morgen Spaniens. Dunst bedeckt die Hügel um die Stadt. Die Geschäfte sind geschlossen.
Nico ist nach ihrem Bad auf die Terrasse hinausgetreten. Das Handtuch ist um sie geschlungen, Wasser glänzt noch auf ihrer Haut.
„Es ist bewölkt“, sagt sie. „Kein guter Tag, um ans Meer zu fahren.“
Malcolm sieht auf. „Es kann noch aufklaren“, sagt er.
Es ist Morgen. Villa-Lobos läuft auf dem Plattenspieler. Der Käfig steht auf einem Hocker in der Balkontür. Malcolm lehnt sich in einen Liegestuhl und isst eine Orange. Er ist verliebt in die Stadt. Er fühlt sich mit ihr tief verbunden, zum einen durch eine Geschichte von Paul Morand, und dann wegen einer Begebenheit, die sich vor Jahren in Barcelona zutrug: Eines Abends bei Einbruch der Dunkelheit wurde Antonio Gaudi, der mysteriöse, zerbrechliche, sogar heiligenähnliche große Architekt dieser Stadt, auf seinem Weg zur Kirche von einer Straßenbahn angefahren. Er war sehr alt, mit weißem Bart, weißem Haar, er trug die einfachste Kleidung. Niemand erkannte ihn. Er lag auf der Straße, und es gab nicht einmal ein Taxi, um ihn ins Krankenhaus zu fahren. Schließlich wurde er ins Armenspital gebracht. Er starb an dem Tag, als Malcolm geboren wurde.
Die Wohnung liegt an der Avenida General Mitre, und ihr Schneider, wie Nico ihn nennt, ist nahe der Kathedrale von Gaudi am anderen Ende der Stadt. In einem Arbeiterviertel, schwacher Abfallgeruch hängt in der Luft. Der Platz ist von Mauern umgeben. In das Trottoir sind vierblättrige Kleeblätter gestanzt. Hoch oben, über allem schwebend, die Türme der Kathedrale. Sanctus, sanctus, rufen sie. Sie sind hohl. Die Kathedrale ist nie fertiggestellt worden, ihre Türen führen in beiden Richtungen ins Freie. Malcolm ist an den ruhigen Abenden Barcelonas oft um dieses leere Bauwerk herumgegangen. Er hat mehr oder minder wertlose Pesetascheine in den Schlitz mit der Aufschrift spenden für die fortsetzung der arbeiten gesteckt. Es scheint, als fielen sie auf der anderen Seite einfach auf den Boden, oder als würden sie – er hört genauer hin – von einem Priester mit Brille in eine Holzkiste geschlossen.
Malcolm glaubt an Malraux und Max Weber: In der Kunst liegt die wahre Geschichte der Nationen. In seinen eigenen Charakterzügen gibt es Hinweise auf einen nicht abgeschlossenen Prozess. Es geht darum, den Menschen zu einem wahren Instrument zu machen. Er bereitet sich auf die Ankunft jenes großen Künstlers vor, der er eines Tages sein wird, wie er hofft, ein Künstler im wahren, modernen Sinne, das heißt ohne Fähigkeiten, aber überzeugt vom eigenen Genie. Ein Künstler, der sich von den Anforderungen des Handwerks befreit hat, ein Künstler der Konzepte, des Großmuts, sein Werk ist die Erschaffung der eigenen Legende. Solange er auch nur einen einzigen Bewunderer hat, kann er an die Würde dieses Konzepts glauben.
Er ist glücklich hier. Er mag die breiten baumkühlen Alleen, die Restaurants, die langen Abende. Er ist tief versunken im Strom eines langsamen Lebens zu zweit.
Nico tritt in einem strohfarbenen Pullover auf die Terrasse.
„Hättest du gern einen Kaffee?“, sagt sie. „Soll ich dir unten einen holen?“
Er überlegt einen Moment.
„Ja“, sagt er.
„Wie willst du ihn?“
„Solo“, sagt er.
„Schwarz.“
Sie tut das gerne. Das Haus hat einen kleinen Aufzug, der langsam heraufkommt. Als er oben ist, steigt sie ein und schließt sorgfältig die Tür hinter sich. Dann fährt sie genauso langsam hinunter, Etage um Etage, als wären es Jahrzehnte. Sie denkt an Malcolm. Sie denkt an ihren Vater und seine zweite Frau. Sie ist wahrscheinlich intelligenter als Malcolm, beschließt sie. Sie hat mit Sicherheit einen stärkeren Willen. Er hingegen sieht auf eigenwillige Art besser aus. Sie hat einen breiten, ausdruckslosen Mund. Malcolm ist großzügig. Sie weiß, dass sie ein wenig spröde ist. Sie kommt am zweiten Stockwerk vorbei. Sie betrachtet sich im Spiegel. Natürlich entdeckt man diese Dinge nicht sofort. Es ist wie in einem Theaterstück, sie entfalten sich langsam, Szene um Szene verändert sich die Wirklichkeit der anderen Person. Aber pure Intelligenz ist sowieso nicht so wichtig. Sie ist etwas Abstraktes. Sie schließt dieses grausame, intuitive Wissen, wie man das neue Leben – ein Leben, das ihr Vater niemals verstehen würde – leben sollte, nicht ein. Malcolm hat es.
Um zehn Uhr dreißig klingelt das Telefon. Auf dem Sofa liegend nimmt sie den Hörer ab und spricht auf Deutsch. Als sie auflegt, ruft Malcolm ihr zu: „Wer war das?“
„Hast du Lust, an den Strand zu fahren?“
„Ja.“
„Inge kommt in ungefähr einer Stunde vorbei“, sagt Nico.
Er hat von ihr gehört und ist neugierig. Zudem besitzt sie ein Auto. Der Morgen verändert sich langsam, ganz nach seinen Wünschen. Auf der Allee unten hört man den ersten Verkehr. Die Sonne bricht für einen Moment hervor, verschwindet, bricht wieder hervor. Weit fort, fern seinen Gedanken, bewegen sich die vier Türme zwischen Schatten und Herrlichkeit. Wenn die Sonne darauf scheint, werden weit oben die Buchstaben sichtbar: Hosanna.
Gegen Mittag erscheint Inge, mit lächelndem Gesicht. Sie trägt einen camelfarbenen Rock und eine Bluse, die oberen Knöpfe sind offen. Sie ist für den Rock, der sehr kurz ist, ein wenig zu stämmig. Nico stellt sie einander vor.
„Warum hast du gestern Abend nicht angerufen?“, fragt Inge.
„Wir wollten, aber dann ist es so spät geworden. Wir haben erst um elf gegessen“, erklärt Nico. „Ich war sicher, du seist ausgegangen.“
Nein. Sie hat zu Hause die ganze Nacht darauf gewartet, dass ihr Freund anruft, sagt Inge. Sie fächert sich mit einer Ansichtskarte von Madrid Luft zu. Nico ist ins Schlafzimmer gegangen.
„Das sind alles Schweine“, sagt Inge. Sie spricht lauter, damit man sie hört. „Er sollte um acht Uhr anrufen. Um zehn hat er sich gemeldet. Er hat keine Zeit zu reden. Er ruft gleich noch mal an. Na ja, er hat sich nicht mehr gemeldet. Schließlich bin ich eingeschlafen.“
Nico zieht sich einen hellgrauen, schmal plissierten Faltenrock und einen zitronengelben Pullover an. Sie betrachtet sich von hinten im Spiegel. Ihre Arme sind bloß. Inge spricht in dem zur Straße gelegenen Zimmer weiter.
„Sie haben keine Manieren, das ist das Problem. Sie haben keine Ahnung. Sie gehen in den Polo-Club, das ist das Einzige, was sie können.“
Sie wendet sich an Malcolm.
„Wenn man mit jemandem ins Bett geht, kann man sich doch hinterher zumindest vernünftig benehmen. Hier nicht. Kein Respekt vor den Frauen!“
Sie hat grüne Augen und weiße ebenmäßige Zähne. Er überlegt sich, wie es wäre, einen solchen Mund zu haben. Ihr Vater ist angeblich Chirurg. In Hamburg. Nico sagt, das sei nicht wahr.
„Das sind Kinder hier“, sagt Inge. „In Deutschland achten sie dich heutzutage wenigstens ein bisschen. Die Männer behandeln einen nicht so wie hier, sie wissen, was sich gehört.“
„Nico“, ruft er.
Sie kommt herein, bürstet sich das Haar.
„Ich mach ihm Angst“, erklärt Inge. „Weißt du, was ich schließlich getan habe? Ich hab ihn um fünf Uhr morgens angerufen. Warum hast du nicht angerufen?, sage ich. Ich weiß nicht, sagt er – ich konnte hören, dass er geschlafen hatte – wie spät ist es? Fünf Uhr, sage ich. Bist du sauer auf mich? Ein bisschen, sagt er. Gut, ich bin nämlich auch sauer auf dich. Peng, hab ich aufgelegt.“
Nico schließt die Tür zum Balkon und bringt den Käfig herein.
„Es ist warm“, sagt Malcolm, „lass ihn da draußen. Er braucht Sonnenlicht.“
Sie sieht in den Käfig.
„Ich glaub, ihm geht es nicht gut“, sagt sie.
„Er ist okay.“
„Der andere ist letzte Woche gestorben“, erklärt sie Inge. „Ganz plötzlich. Er war nicht mal krank.“
Sie schließt einen Türflügel und lässt den anderen offen. Der Vogel sitzt im mittlerweile strahlenden Sonnenschein, gefiedert, heiter.
„Ich glaub nicht, dass sie alleine leben können“, sagt sie.
„Dem geht es gut“, versichert Malcolm ihr. „Sieh ihn dir an.“
Die Sonne bringt seine Farben zum Leuchten. Er sitzt auf der obersten Stange. Seine Augen haben vollkommen runde Lider. Er blinzelt.
Der Fahrstuhl ist noch auf ihrem Stockwerk. Inge betritt ihn als Erste. Malcolm zieht die schmalen Türen zu. Es ist, als schließe man einen kleinen Schrank. Sie fahren abwärts, die Gesichter dicht beieinander. Malcolm sieht Inge an. Sie ist in Gedanken versunken.
Sie gehen auf einen weiteren Kaffee in die kleine Bar unten im Haus. Er hält ihnen die Tür auf. Es ist niemand da – nur ein Mann, der Zeitung liest.
„Ich glaube, ich ruf ihn noch mal an“, sagt Inge.
„Frag ihn, warum er dich heut Morgen um fünf Uhr geweckt hat“, sagt Malcolm.
Sie lacht. „Ja“, sagt sie. „Wunderbar. Das werd ich machen.“
Das Telefon ist am anderen Ende der marmornen Theke, aber Nico redet mit ihm, und er kann nichts verstehen.
„Interessiert dich das nicht?“, fragt er.
„Nein“, sagt sie.
Inges Auto ist ein blauer Volkswagen, ein Blau wie das bestimmter Luftpostumschläge. Ein Kotflügel ist eingedellt.
„Du hast mein Auto ja noch nicht gesehen“, sagt sie. „Was hältst du davon? Meinst du, das war ein guter Kauf? Ich verstehe nichts von Autos. Das ist mein erstes. Ich hab es jemandem, den ich kenne, abgekauft, einem Maler, aber er hatte schon einen Unfall damit. Der Motor hat gebrannt.“
„Ich kann zwar fahren“, sagt sie. „Aber es ist besser, wenn jemand neben mir sitzt. Kannst du fahren?“
„Sicher“, sagt er.
Er setzt sich ans Steuer und lässt den Motor an. Nico sitzt hinten.
„Na, was meinst du?“, sagt Inge.
„Sag ich dir gleich.“
Obwohl es erst ein Jahr alt ist, wirkt das Auto ein wenig heruntergekommen. Der Stoff an der Decke ist ausgeblichen. Selbst das Lenkrad kommt ihm mitgenommen vor. Nachdem sie ein paar Häuserblocks gefahren sind, sagt Malcolm: „Scheint in Ordnung zu sein.“
„Ja?“
„Die Bremsen sind ein bisschen schwach.“
„Wirklich?“
„Ich glaube, sie brauchen neue Beläge.“
„Ich hab es erst kürzlich abschmieren lassen“, sagt sie.
Malcolm sieht sie an. Sie scheint es ernst zu meinen.
„Bieg hier nach links ab“, sagt sie.
Sie dirigiert ihn durch die Stadt. Mittlerweile gibt es ein wenig Verkehr, aber sie kommen gut durch. Viele Kreuzungen in Barcelona weiten sich zu großen achteckigen Plätzen. Es gibt nur wenige rote Ampeln. Sie fahren durch riesige Wohnviertel mit alten, hohen Häusern, vorbei an Fabriken, an den ersten leeren Feldern am Stadtrand. Inge dreht sich auf dem Vordersitz zu Nico um.
„Ich hab die Nase voll von hier“, sagt sie. „Ich würde gern nach Rom gehen.“
Sie kommen am Flughafen vorbei. Die Straße zum Meer ist überfüllt. Der ganze über die Stadt verteilte Verkehr läuft hier zusammen, Busse, Laster, unzählige Kleinwagen.
„Nicht mal fahren können sie“, sagt Inge. „Was machen die nur? Kannst du nicht überholen? – Na los“, sagt sie. Sie greift hinüber, um zu hupen.
„Das hat keinen Zweck“, sagt Malcolm.
Inge hupt erneut.
„Es geht nicht schneller.“
„Die machen mich wahnsinnig“, ruft sie.
Zwei Kinder im vorderen Auto haben sich umgedreht. Ihre Gesichter sind blass und durch die Heckscheibe verspiegelt.
„Warst du schon mal in Sitges?“, sagt Inge.
„In Cadaques.“
„Ah“, sagt sie. „Ja, schön da. Man muss aber jemanden mit einer Villa kennen.“
Die Sonne ist weiß. Das Land liegt strohfarben in ihrem Licht. Die Straße verläuft parallel zur Küste, entlang billiger Badestrände, vorbei an Campingplätzen, Häusern, Hotels. Zwischen der Straße und dem Meer liegen die Eisenbahngeleise mit kleinen Unterführungen für die Badegäste, um ans Meer zu kommen. Nach einer Weile verschwindet all das. Sie kommen an fast verlassenen Küstenstrecken vorbei.
„In Sitges“, sagt Inge, „versammeln sich sämtliche blonden Mädchen von Europa. Schweden, Deutschland, Holland. Ihr werdet sehen.“
Malcolm sieht auf die Straße.
„Die braunen Augen der Spanier haben es ihnen angetan“, sagt sie.
Sie greift hinüber, um zu hupen.
„Sieh sie dir an! Kriechen tun sie!“
„Sie kommen voller Hoffnungen hierher“, sagt Inge. „Sparen ihr Geld, kaufen sich Badeanzüge so groß wie ein Daumennagel, und was passiert? Vielleicht werden sie eine Nacht geliebt, das war’s. Die Spanier haben keine Ahnung, wie man Frauen behandelt.“
Nico sitzt still auf dem Rücksitz. Ihr Gesicht hat diesen ruhigen Ausdruck, der bedeutet, dass sie sich langweilt.
„Sie wissen nichts“, sagt Inge.
Sitges ist ein kleines Städtchen mit feuchten Hotels, den grünen Fensterläden und dem ausgedörrten Rasen eines Badeortes. Überall sind Autos geparkt. Die Straßen sind gesäumt von ihnen. Schließlich finden sie zwei Blocks vom Strand entfernt eine Parklücke.
„Schließ es gut ab“, sagt Inge.
„Den wird schon keiner klauen“, sagt Malcolm.
„Also gefällt er dir doch nicht so gut“, sagt sie.
Sie gehen über das Trottoir, dessen Oberfläche von der Hitze aufgeworfen scheint. Sie sind umgeben von den flachen, schmucklosen Fassaden zu dicht aneinandergebauter Häuser. Trotz der Autos ist der Ort merkwürdig verlassen. Es ist zwei Uhr. Alle sind beim Mittagessen.
Malcolm hat eine Badehose aus fester Baumwolle, die blaue glänzende Baumwolle der Tuareg. Vorne hat sie einen kleinen fingerbreiten Gürtel. Er fühlt sich stark, als er sie anzieht. Er hat den Körper eines Läufers, einen makellosen Körper, den Körper eines Märtyrers in einem flämischen Gemälde. Die Adern liegen wie Kordeln unter der Haut seiner Arme und Beine. Die Rückwände der Kabinen sind aus Beton, auf dem Boden liegen Bastmatten. Seine Kleider hängen formlos an einem Haken. Er tritt auf den Gang. Die Frauen ziehen sich noch um, er weiß nicht, hinter welcher Tür. An einem Nagel ist ein kleiner Spiegel angebracht. Er fährt sich mit der Hand durchs Haar und wartet. Draußen ist die Sonne.
Im flachen Wasser liegen Kiesel, die so scharf wie Nägel sind. Malcolm geht als Erster hinein. Nico folgt ihm wortlos. Das Wasser ist kühl. Er spürt, wie es seine Beine hochklettert, den Rand seiner Badehose berührt und ihn dann mit einer Woge – er versucht, hoch genug zu springen – umschließt. Er springt kopfüber hinein. Er taucht lächelnd auf. Salzgeschmack ist auf seinen Lippen. Nico ist auch untergetaucht. Sie kommt ganz in seiner Nähe hoch, langsam, und streicht sich ihr nasses Haar mit einer Hand aus dem Gesicht. Sie steht mit halb geschlossenen Lidern da, ohne genau zu wissen, wo sie ist. Er legt einen Arm um ihre Taille. Sie lächelt. Sie hat einen bestimmten untrüglichen Instinkt dafür, wann sie am schönsten ist. Einen Moment lang stehen sie weich aneinandergelehnt da. Er hebt sie auf die Arme und trägt sie, unterstützt von den Wellen, ins tiefere Wasser. Ihr Kopf lehnt an seiner Schulter. Inge liegt in ihrem Bikini am Strand und liest den Stern.
„Stimmt was nicht mit Inge?“, sagt er.
„Alles.“
„Nein, ich meine, will sie nicht reinkommen?“
„Sie hat ihre Tage“, sagt Nico.
Sie legen sich auf ihre Badetücher neben sie. Sie ist, wie Malcolm bemerkt, sehr braun. Nico wird nie so dunkel, egal wie lange sie in der Sonne bleibt. Es ist fast eine Art Starrsinn, als böte er ihr die Sonne an und sie nähme sie nicht.
Sie sei an einem einzigen Tag so braun geworden, erzählt Inge. An einem einzigen Tag! Es scheint unglaublich. Sie sieht auf ihre Arme und Beine, wie zur Bestätigung. Ja, so war’s. Nackt auf den Felsen von Cadaques. Sie sieht hinunter auf ihren Bauch, und dabei entstehen mehrere mädchenhafte Speckröllchen.
„Du wirst dick“, sagt Nico.
Inge lacht. „Das sind meine Ersparnisse“, sagt sie.
So sehen sie aus, wie Gürtel, wie Teile eines Kostüms, das sie trägt. Wenn sie sich zurücklegt, sind sie verschwunden. Ihr Körper ist glatt. Ihr Bauch ist wie ihr übriger Körper mit einem zarten goldenen Flaum bedeckt. Zwei spanische Jugendliche schlendern unten am Wasser vorbei.
Sie spricht zum Himmel. Wenn sie nach Amerika geht, sagt sie, lohnt es sich dann, das Auto mitzunehmen? Schließlich hat sie es sehr günstig bekommen, sie könnte es wahrscheinlich verkaufen und sogar noch etwas Geld damit machen.
„In Amerika gibt es massenweise Volkswagen“, sagt Malcolm. „Es ist voller deutscher Autos. Jeder da hat eines.“
„Sie gefallen ihnen also“, sagt sie. „Der Mercedes ist ein guter Wagen.“
„Der wird sehr bewundert“, sagt Malcolm.
„So einen hätt ich gerne. Gleich mehrere. Wenn ich Geld habe, wird das mein Hobby sein“, sagt sie. „Ich würde gerne in Tanger leben.“
„Schöner Strand dort.“
„Ja? Ich würde schwarz wie ein Neger werden.“
„Da kannst du dich aber nicht nackt sonnen.“
Inge lächelt.
Nico scheint zu schlafen. Sie liegen schweigend da, die Füße zur Sonne gerichtet. Sie hat ihre Kraft verloren. Es gibt nur noch vorübergehende Momente von Wärme, wenn der Wind völlig erstirbt und die Sonne direkt auf ihre Körper fällt, schwach, aber flutend. Die Stunde der Melancholie nähert sich, die Stunde, wenn alles vorbei ist.
Um sechs Uhr setzt sich Nico auf. Ihr ist kalt.
„Komm“, sagt Inge. „Lass uns am Strand spazierengehen.“
Sie besteht darauf. Die Sonne ist noch nicht untergegangen. Sie wird ausgelassen.
„Komm“, sagt sie, „es ist der gute Teil, da stehen all die großen Villen. Wir gehen vorbei und beglücken die alten Männer.“
„Ich will niemanden beglücken“, sagt Nico und verschränkt die Arme.
„So einfach ist das gar nicht“, versichert ihr Inge.
Nico geht mürrisch mit. Sie umfasst ihre Ellbogen. Der Wind kommt vom Land. Auf dem Meer sind jetzt kleine Wellen, die sich still zu brechen scheinen. Das Geräusch ist weich, wie vergessen. Nico trägt einen grauen Badeanzug mit freiem Rücken, und während Inge vor den Häusern der Reichen herumturnt, blickt sie auf den Sand.
Inge geht ins Wasser. Komm, sagt sie, es ist warm. Sie lacht und ist glücklich, ihre Heiterkeit ist stärker als die Stunde, stärker als die Kälte. Malcolm folgt ihr langsam. Das Wasser ist warm. Es scheint auch klarer. Und niemand darin, in beiden Richtungen, so weit das Auge reicht. Sie baden allein. Die Wellen steigen und heben sie sanft in die Höhe. Das Wasser fließt über sie und wäscht ihre Seele.
Am Eingang der Kabinen stehen die jungen spanischen Burschen, um einen Blick zu erhaschen, falls die Duschkabinentür zu früh geöffnet wird. Sie tragen blaue Wollbadehosen. Auch schwarze. Ihre Füße scheinen sehr lange Zehen zu haben. Es gibt nur eine Dusche mit einem einzigen, weiß gestrichenen Duschhahn. Das Wasser ist kalt. Inge geht als Erste hinein. Ihr Bikini erscheint – zuerst ein kleines Teil, dann das andere –, sie hängt ihn über die Tür. Malcolm wartet. Er kann das weiche Klatschen und das Streichen ihrer Hände hören, das plötzliche Aufschlagen des Wassers auf dem Beton, als sie zur Seite tritt. Die Jungen an der Tür erheitern ihn. Er sieht nach draußen. Sie sprechen mit leisen Stimmen. Sie schubsen einander, feixen, tun so, als wäre es ein Spiel.
Die Straßen von Sitges haben sich verändert. Die Glocke, die den Abend ankündigt, hat geschlagen, und überall schlendern Gruppen von Menschen. Es ist schwer zusammenzubleiben. Malcolm hat um beide einen Arm gelegt. Sie reagieren auf seine Bewegungen wie Pferde. Inge lächelt. Die Leute werden denken, dass sie es zu dritt tun, sagt sie.
Sie gehen in ein Café. Kein gutes Café, beschwert sich Inge.
„Es ist das beste“, sagt Nico schlicht. Es ist eine ihrer Begabungen, dass sie, wo immer sie hingeht, auf einen Blick sagen kann, welches Café das richtige ist, welches Restaurant, welches Hotel.
„Nein“, sagt Inge beharrlich.
Nico scheint es nicht zu kümmern. Sie gehen jetzt getrennt, und Malcolm flüstert: „Was sucht sie denn?“
„Weißt du das nicht?“, sagt Nico.
„Siehst du diese Jungen?“, sagt Inge. Sie sitzen in einem anderen Café, einer Bar. Überall um sie herum – gebräunte Glieder, von langen, glühenden Nachmittagen geblichenes Haar – sitzen junge Männer, das süße Starren des Nichtstuns im Gesicht.
„Sie haben kein Geld“, sagt sie. „Keiner von ihnen könnte dich zum Essen einladen. Kein einziger. Sie haben nichts. Das ist Spanien“, sagt sie.
Nico wählt das Restaurant, in dem sie zu Abend essen. Sie hat das Gefühl, an diesem Tag zu einer unbedeutenderen Person geworden zu sein. Die Gegenwart dieser Freundin, dieses Mädchens, mit der sie in den Tagen, als sie beide versuchten, sich in der Stadt zurechtzufinden, kurz zusammengewohnt hatte – als sie noch niemanden kannte, nicht einmal die Straßennamen, und sie so krank wurde, dass sie gemeinsam ihrem Vater telegrafierten – sie hatten kein Telefon –, dieses plötzliche Erscheinen von Inge scheint ihrer Vergangenheit die Würde zu nehmen. Ganz plötzlich wird sie von der Gewissheit geplagt, dass Malcolm sie verachtet. Ihre Sicherheit, ohne die sie nichts ist, scheint verschwunden zu sein. Das Tischtuch wirkt weiß und blendend. Es scheint sie drei unerbittlich anzustrahlen. Die Messer und Gabeln sind wie chirurgische Instrumente ausgelegt. Die Teller stehen kalt vor ihnen. Sie ist nicht hungrig, aber sie wagt nicht, das Essen abzulehnen. Inge spricht von ihrem Freund.
„Er ist schrecklich“, sagt sie. „Er ist herzlos. Aber ich verstehe ihn. Ich weiß, was er will. Eine Frau kann sowieso nie hoffen, alles für einen Mann zu sein. Das wäre nicht natürlich. Ein Mann muss mehrere Frauen haben.“
„Du bist verrückt“, sagt Nico nüchtern.
„Aber es stimmt.“
Die Aussage reicht, um ihr alle Kraft zu nehmen. Malcolm untersucht sein Uhrarmband. Er ist so dumm, denkt sie. Dieses Mädchen kommt aus einfachen Verhältnissen, und er findet das interessant. Sie glaubt, weil die Männer mit ihr ins Bett gehen, würden sie sie heiraten. Natürlich nicht. Niemals. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein, denkt Nico, obwohl sie, während sie dies denkt, weiß, dass sie vielleicht unrecht hat.
Sie gehen für den Kaffee zu Chez Swann. Nico setzt sich nicht zu ihnen. Sie ist müde, sagt sie. Sie rollt sich auf einem Sofa zusammen und schläft ein. Sie ist erschöpft. Der Abend ist kühl geworden.
Eine Stimme weckt sie, Musik, eine wunderbare Stimme zwischen einzelnen Gitarrensätzen. Nico hört sie im Schlaf und setzt sich auf. Malcolm und Inge unterhalten sich. Das Lied ist wie etwas lang Ersehntes, etwas, nach dem sie gesucht hat. Sie rückt an ihn heran und berührt seinen Arm.
„Hör doch“, sagt sie.
„Was?“
„Das Lied“, sagt sie. „Maria Pradera.“
„Maria Pradera?“
„Der Text ist wunderschön“, sagt Nico.
Einfache Sätze. Sie wiederholt sie wie eine Litanei. Geheimnisvolle Wiederholungen: schwarzhaarige Mutter … schwarzhaariges Kind. Die Ausdruckskraft der Armen, glatt geschliffen und rein wie ein Kiesel.
Malcolm hört geduldig zu, aber er versteht nichts. Sie kann es sehen: Er hat sich verändert. Während sie geschlafen hat, ist er vergiftet worden, mit Geschichten über ein hässliches Spanien, nach und nach ist er damit gefüttert worden, bis sie in seinen Venen zirkulieren, ein Spanien aus der Vorstellung einer Frau, die weiß, dass sie niemals mehr als nur ein Teil von dem sein kann, was ein Mann braucht. Inge ist ruhig. Sie glaubt an sich. Sie glaubt an ihr Recht, zu leben, zu bestimmen.
Die Straße ist dunkel. Sie haben das Verdeck geöffnet, eine Nacht so dicht von Sternen, dass sie sich ins Auto zu ergießen scheinen. Nico, auf dem Rücksitz, hat Angst. Inge redet. Sie greift ins Steuer, um Autos anzuhupen, die zu langsam fahren. Malcolm lacht darüber. In Barcelona gibt es Zimmer, in denen Inge mit ihrem Geliebten an Winternachmittagen vor einem warmen, prasselnden Feuer saß. Es gibt Häuser, in denen sie auf Felldecken miteinander geschlafen haben. Natürlich, damals war er nett. In ihrer Vorstellung sah sie sich im Polo-Club, bei Dinnerpartys in den besten Häusern.
Die Straßen der Stadt sind fast verlassen. Es ist kurz vor Mitternacht, Sonntagmitternacht. Der Tag in der Sonne hat sie ermüdet, das Meer hat ihnen die Kraft genommen. Sie fahren zur Avenida General Mitre und sagen einander durch das Autofenster gute Nacht. Der Aufzug fährt sehr langsam hinauf. Schweigen hängt an ihnen. Sie sehen auf den Boden wie Spieler, die verloren haben.
Die Wohnung ist dunkel. Nico macht Licht und verschwindet dann. Malcolm wäscht sich die Hände. Er trocknet sie. Die Zimmer wirken sehr still. Er beginnt sie langsam zu durchwandern und findet Nico auf den Knien in der Tür zur Terrasse, als wäre sie gestürzt.
Malcolm sieht auf den Käfig. Kalil liegt auf dem Boden.
„Gib ihm ein bisschen Brandy. Auf einem Zipfel Taschentuch“, sagt er.
Sie hat die Käfigtür geöffnet.
„Er ist tot“, sagt sie.
„Lass mich mal sehen.“
Er ist steif. Die kleinen Füße sind zusammengerollt und trocken wie Zweige. Er wirkt irgendwie leichter. Der Atem hat seine Federn verlassen. Ein Herz, nicht größer als ein Orangenkern, hat aufgehört zu schlagen. Der Käfig steht leer im kalten Türeingang. Es scheint, als gäbe es nichts zu sagen. Malcolm schließt die Tür.
Später im Bett lauscht er ihrem Schluchzen. Er versucht, sie zu trösten, aber er kann es nicht. Sie kehrt ihm den Rücken zu. Sie antwortet nicht.
Sie hat kleine Brüste und große Brustwarzen. Außerdem, wie sie selber sagt, einen ziemlich dicken Hintern. Ihr Vater hat drei Sekretärinnen. Hamburg liegt nah am Meer.
My Lord
Auf dem Tisch waren zerknüllte Servietten, Weingläser, in denen noch ein dunkler Rest stand, Kaffeeflecken und Teller mit hart gewordenem Brie. Hinter den bläulichen Fenstern lag der Garten bewegungslos im Vogelgesang des Sommermorgens. Der Tag brach an. Es war ein Erfolg gewesen, nur eines hatte gestört: Brennan.
Sie hatten zuerst draußen gesessen, hatten in der Dämmerung etwas getrunken und waren dann hineingegangen. Die Küche hatte einen großen runden Tisch, einen offenen Kamin und Regale mit Gewürzen und Zutaten aller Art. Deems war als Koch bekannt. Das war auch seine etwas unzugängliche Freundin Irene mit ihrem geheimnisvollen Lächeln. Sie kochten aber nie zusammen. An diesem Abend war Deems an der Reihe. Er servierte ihnen Kaviar, den er in einem weißen Gefäß auf den Tisch brachte, wie man es sonst für Gesichtscreme benutzte. Es war Sevruga, den sie mit kleinen Silberlöffeln aßen. Die einzige Art, murmelte Deems und wandte ihnen sein Profil zu. Er blickte nur selten jemandem in die Augen. Antike Silberlöffel, hörte Ardis ihn mit leiser Stimme sagen. Als ob das niemand merken würde, dass es nicht stimmte.
Sie merkte immer alles. Obwohl sie Deems nun schon ziemlich lange kannten, waren sie und ihr Mann noch nie bei ihm zu Hause gewesen. Als sie zum Dinner ins Esszimmer gingen, registrierte sie die Bilder, die Bücher und die Regale mit Gegenständen, darunter eines mit perfekten, schimmernden Muscheln. Es war ihr auf eine Weise fremd, so wie jedes Haus anderer Leute, aber doch auch halb vertraut.
Die Tischordnung war durcheinandergeraten, und Irene versuchte vergeblich, das in der Unterhaltung, bevor das Essen begann, zu korrigieren. Draußen war die Dunkelheit gekommen, tief und grün. Die Männer redeten über die Sommercamps, in die sie als Jungen gefahren waren, in den Kiefernwäldern von Maine, und über Soros, den Finanzier. Viel interessanter war ein Kommentar, den Irene abgab, in welchem Zusammenhang, wusste Ardis nicht. „Ich glaube, es gibt so etwas, wie mit einem Mann zu viel schlafen.“
„Hast du gesagt, es gibt so etwas oder es gibt so etwas nicht?“, hörte sie sich fragen.
Irene lächelte nur. Ich muss sie später fragen, dachte Ardis. Das Essen war großartig. Es gab eine kalte Suppe, Ente und einen Salat aus jungem Gemüse. Der Kaffee war serviert worden, und Ardis spielte geistesabwesend mit dem geschmolzenen Wachs der Kerzen, als plötzlich eine Stimme hinter ihr laut ertönte:
„Ich bin zu spät. Wer ist das? Sind das die schönen Menschen?“
Es war ein betrunkener Mann in einem Jackett und schmutzigen weißen Hosen mit Blutflecken darauf, weil er sich beim Rasieren vor zwei Stunden in die Lippe geschnitten hatte. Seine Haare waren feucht, sein Gesicht arrogant. Es war das Gesicht eines Herzogs aus der Regency-Ära, einschüchternd, verwöhnt. Etwas Unvernünftiges ging von ihm aus.
„Habt ihr was zu trinken da? Was ist das, Wein? Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich hab grad sieben Cognac getrunken und meiner Frau Leb wohl! gesagt. Deems, du weißt, wie das ist. Du bist mein einziger Freund, weißt du das? Der einzige.“
„Da gibt’s noch was zu essen, wenn du willst“, sagte Deems und machte eine Handbewegung in Richtung Küche.
„Nichts zu essen. Hab schon gegessen. Ich will nur was zu trinken. Deems, du bist mein Freund, aber ich sag dir was, du wirst mein Feind werden. Du weißt, was Oscar Wilde gesagt hat – mein Lieblingsschriftsteller, mein Liebling überhaupt auf dieser Welt. Jeder kann sich seine Freunde aussuchen, aber nur der weise Mann kann sich seine Feinde aussuchen.“
Er starrte Deems intensiv an. Es war wie der Griff eines Wahnsinnigen, eine Art Raserei. Sein Mund hatte einen entschlossenen Ausdruck. Als er in die Küche ging, konnte man ihn mit den Flaschen hantieren hören. Er kehrte mit einem gefährlich vollen Glas zurück und sah sich grimmig um.
„Wo ist Beatrice?“, fragte Deems.
„Wer?“
„Beatrice, deine Frau.“
„Weg“, sagte Brennan. Er suchte nach einem Stuhl.
„Ist sie zu ihrem Vater gefahren?“, fragte Irene.
„Wie kommst du darauf?“, sagte Brennan drohend. Zu Ardis’ Schrecken setzte er sich neben sie.
„Er ist doch im Krankenhaus gewesen, oder?“
„Woher soll ich das wissen“, sagte Brennan düster. „Er ist ein Schwein. Habsucht. Gier. Er ist ein Miethai, ein Verbrecher. Ich würd ihn eigenhändig aufknüpfen. Wie Gomez, der Diktator, dessen Töchter wahrscheinlich reiche Frauen sind.“
Er entdeckte Ardis und sagte zu ihr, als imitierte er jemanden, vielleicht eine Frau, mit der er sie verwechselte: „Isses nich komisch? Isses nich wunderbar?“
Zu ihrer Erleichterung wandte er sich gleich wieder ab. „Ich bin ihre einzige Hoffnung“, sagte er zu Irene. „Ich lebe von ihrem Geld, und das ruiniert mich, das ist mein Ende.“ Er hielt ihr sein Glas hin und fragte milde: „Kann ich ein kleines bisschen Eis haben? Ich liebe meine Frau.“ Ardis vertraute er an: „Wissen Sie, wie wir uns getroffen haben? Unvorstellbar. Sie ging am Strand an mir vorbei. Ich war unvorbereitet. Ich sah sie von vorne, dann von hinten, den Rest stellte ich mir vor. Rums! Wir stießen zusammen wie Planeten, endlose Unzucht. Manchmal lieg ich nur still da und beobachte sie. Der schwarze Panther ruht unter seinem Rosenstrauch“, zitierte er. „J’ai eu pitié des autres …“
Er starrte sie an.
„Was ist das?“, fragte sie vorsichtig.
„… möge das Kind in Frieden in ihrer Kirche wandeln“, intonierte er.
„Ist das Wilde?“
„Erraten Sie das nicht? Pound. Das einzige Genie des Jahrhunderts. Nein, nicht das einzige. Ich bin auch eins: ein Säufer, ein Versager und ein großes Genie. Wer bist du denn?“, sagte er. „Noch so ’ne kleine Hausfrau?“
Sie spürte, wie das Blut aus ihrem Gesicht wich, und stand auf, um sich mit dem Abräumen zu beschäftigen. Seine Hand lag auf ihrem Arm. „Geh nicht weg. Ich weiß, wer du bist, noch eine unschätzbare Frau, die still verblüht. Gute Figur“, sagte er, als sie es schaffte, sich loszumachen, „hübsche Schuhe.“
Als sie ein paar Teller in die Küche trug, hörte sie ihn sagen: „Geh nicht oft auf solche Partys. Werd nicht eingeladen.“
„Wie kommt das bloß“, murmelte jemand.
„Aber Deems ist mein Freund, mein engster Freund.“
„Wer ist das?“, fragte Ardis Irene in der Küche.
„Oh, er ist ein Dichter. Er ist mit einer Venezolanerin verheiratet, und sie läuft ihm gerade weg. Er ist nicht immer so schlimm.“
Sie hatten ihn in dem anderen Zimmer offenbar ein wenig beruhigt. Ardis sah, wie ihr Mann sich mit einem Finger nervös die Brille höher auf die Nase schob. Deems, im Polohemd und mit wirrem Haar, versuchte, Brennan in Richtung Hintertür zu führen. Brennan blieb immer wieder stehen, um zu reden. Einen Moment lang schien er sich in den Griff bekommen zu haben. „Ich will dir was sagen“, erklärte er. „Ich bin an der Schule vorbeigegangen, an der Straße da unten. Da hing ein Plakat. Die Erste Jährliche Miss-Fick-Wahl. Im Ernst. Das stimmt.“
„Nein, nein“, sagte Deems.
„Die hat stattgefunden, ich weiß nicht, wann. Die Frage ist, kommen sie allmählich zur Vernunft oder sind sie von allen guten Geistern verlassen? Nur noch ein kleiner Schluck“, bat er; sein Glas war leer. Er kehrte zu seinem Thema zurück. „Im Ernst, was sagst du dazu?“
Im Küchenlicht wirkte er nur zerknittert, wie ein Journalist, der die Nacht durchgearbeitet hat. Das Beunruhigende war, dass die Vernunft in seinem Ausdruck fehlte, in seinem starrenden Blick. Ein Nasenloch war kleiner als das andere. Er war daran gewöhnt, unbeherrschbar zu sein. Ardis hoffte, dass sie ihm nicht wieder auffallen würde. Seine Stirn glänzte an zwei Stellen, wie sprießende Hörner. Fühlten Männer sich zu einem hingezogen, wenn sie wussten, dass sie einem Angst machten?
Sie spürte seine Augen auf sich. Alles war still. Sie spürte ihn dort stehen, wie ein bedrohlicher Bettler.
„Was bist du, noch so ’ne Kleinbürgerin?“, sagte er zu ihr. „Ich weiß, dass ich getrunken habe. Lass uns essen gehen. Ich hab uns was Wunderbares bestellt. Vichyssoise. Hummer. S. G. Steht immer so auf der Speisekarte, selon grosseur.“
Er redete in einem leichten Plauderton auf sie ein, als wären sie in einem Casino zusammen, die Chips hochgestapelt vor ihnen, als wäre es eine scharfsinnige Diskussion darüber, auf was sie setzen sollten, und als wären ihre Brüste unter dem schwarzen T-Shirt ihm gleichgültig. Er streckte ruhig die Hand aus und berührte eine. „Ich hab Geld“, sagte er. Seine Hand blieb, wo sie war, legte sich um ihre Brust. Ardis war zu betäubt, um sich zu rühren. „Möchtest du, dass ich noch mehr davon tu?“
„Nein“, brachte sie heraus.
Seine Hand glitt hinunter zu ihrer Hüfte. Deems hatte ihn an einem Arm gepackt und zog ihn weg. „Psst“, flüsterte Brennan ihr zu, „sag nichts. Wir zwei. Wie ein Ruder, das ins Wasser taucht, gleitend.“
„Wir müssen gehen“, sagte Deems energisch.
„Was tust du? Ist das wieder einer deiner Tricks?“, rief Brennan aus. „Deems, es wird noch damit enden, dass ich dich zerstöre!“
Als er zur Tür geschoben wurde, redete er immer weiter. Deems war der einzige Mann, den er nicht verabscheute, sagte er. Er wollte, dass sie alle zu ihm nach Hause kamen, er hatte alles. Er hatte einen Plattenspieler, Whisky! Er hatte eine goldene Uhr!
Schließlich war er draußen. Er ging unsicher über das kurz gemähte Gras und stieg in seinen Wagen, dessen eine Seite eingebeult war. In abrupten Stößen setzte er zurück.
„Er fährt wahrscheinlich zu Cato’s“, mutmaßte Deems. „Ich sollte anrufen und sie warnen.“
„Da kriegt er nichts. Er schuldet ihnen Geld“, sagte Irene.
„Wer hat das gesagt?“
„Der Barmann. Alles in Ordnung?“, fragte sie Ardis.
„Ja. Ist er wirklich verheiratet?“
„Er war drei oder vier Mal verheiratet“, sagte Deems.
Später begannen sie zu tanzen, einige der Frauen tanzten miteinander. Irene zog Deems auf das Parkett. Er kam widerstandslos mit. Er tanzte ziemlich gut. Sie machte fließende Bewegungen mit den Armen und sang. „Sehr schön“, sagte er. „Bist du schon mal aufgetreten?“
Sie lächelte ihn an.
„Ich tue mein Bestes“, sagte sie.
Als sie gingen, legte sie die Hand auf Ardis’ Arm und sagte noch einmal: „Es ist mir so unangenehm, was da passiert ist.“
„Es war nichts. Kein Problem.“
„Ich hätte ihn mir schnappen und ihn rausschmeißen sollen“, sagte ihr Mann auf der Heimfahrt. „Ezra Pound. Weißt du, wer Ezra Pound war?“
„Nein.“
„Er war ein Verräter. Während des Krieges hat er Radiosendungen für den Feind gemacht. Sie hätten ihn erschießen sollen.“
„Was ist mit ihm passiert?“
„Sie haben ihm einen Literaturpreis gegeben.“
Sie fuhren ein langes Stück durch die Einsamkeit, wo an einer Ecke ein kleines, halb in Bäumen verborgenes Haus stand, das Zigeunerhaus. Ardis stellte es sich als ein einfaches Haus vor, mit einer Pumpe im Hof, aus dem ab und zu während des Tages ein Mädchen in sehr kurzen blauen Shorts heraustrat, um Wäsche an die Leine zu hängen. Heute Nacht brannte in einem Fenster Licht. Ein Licht in der Nähe des Meeres. Sie fuhr mit Warren im Auto und er redete.
„Am besten vergessen wir diesen Abend einfach.“
„Ja“, sagte sie. „Es war nichts.“
Brennan brach um zwei Uhr morgens auf der Hull Lane durch einen Zaun und kam auf jemandes Rasen zum Stehen. Er hatte die Kurve nicht gekriegt, wahrscheinlich weil seine Scheinwerfer nicht eingeschaltet waren, glaubte die Polizei.
Sie nahm das Buch und ging zu einem Fenster, das auf den Garten hinter der Bibliothek hinaussah. Sie las ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem und stieß auf ein Gedicht, von dem ein paar Zeilen unterstrichen waren und das an den Rändern Anmerkungen in Bleistift aufwies. Es war „Die Frau des Flusshändlers“ – sie hatte noch nie davon gehört. Draußen glühte der Sommer, weiß wie Kalk.
At fourteen I married, My Lord, you, las sie –
Mit vierzehn heiratete ich, meinen Herrn: Dich
Ich lachte nie, denn ich war schüchtern …
Da waren drei alte Männer, einer von ihnen fast blind, wie es schien, die in dem kalten Raum Zeitung lasen. Die dicken Brillengläser des fast blinden Mannes warfen weiße Monde auf seine Wangen.
Das Laub fällt zeitig diesen Herbst im Wind.
Die Schmetterlinge, zu zweit, sind schon gelb vor August
Überm Rasen des westlichen Gartens.
Sie tun mir weh. Ich werde älter.
Sie hatte Gedichte gelesen und sie vielleicht auch so angestrichen, aber das war in der Schule gewesen. Von den Dingen, die sie gelernt hatte, wusste sie nur noch wenig. Es hatte aber einen My Lord in ihrem Leben gegeben, auch wenn sie ihn nicht geheiratet hatte. Sie war einundzwanzig gewesen, ihr erstes Jahr in der Stadt. Sie erinnerte sich an das Gebäude aus dunkelbraunem Backstein in der Fifty-eighth Street, die Nachmittage mit ihrem streifigen Licht, ihre Kleider in einem Sessel oder auf den Fußboden gefallen, und die feuchten, besinnungslosen Wiederholungen an es oder an ihn oder wer weiß was: oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Der Verkehr draußen so leise, so weit weg …
Sie hatte ihn im Laufe der Jahre mehrere Male angerufen, sie glaubte, dass die Liebe nie starb, und träumte törichterweise davon, ihn wiederzusehen, hoffte, dass er zurückkam, so wie in den alten Liedern. Noch einmal in der Mittagszeit die Straße hinunterzueilen, fast zu laufen, das Geräusch ihrer Absätze auf dem Bürgersteig. Zu sehen, wie sich die Wohnungstür öffnete …
Kommst du herab, die Flußengen des Yangtze,
Bitte schick mir beizeiten Nachricht,
Dann komme ich dir entgegen,
Bis nach Ch’ang-feng-sha.[1]
Da saß sie am Fenster mit ihrem jungen Gesicht, auf dem Müdigkeit lag, eine leichte Abneigung gegen die Dinge, vielleicht sogar gegen sich selbst. Nach einer Weile ging sie zum Pult. „Haben Sie zufällig etwas von Michael Brennan?“, fragte sie.
„Michael Brennan“, sagte die Frau. „Wir haben seine Bücher gehabt, aber er hat sie uns weggenommen, weil unwürdige Leute sie lesen, sagt er. Ich glaube nicht, dass wir noch was haben. Vielleicht wenn er aus der Stadt zurückkommt.“
„Er wohnt in der Stadt?“
„Er wohnt gleich hier, die Straße runter. Wir hatten mal alle seine Bücher. Kennen Sie ihn?“
Sie hätte gerne mehr gefragt, aber sie schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte sie. „Ich habe nur den Namen gehört.“
„Er ist ein Dichter“, sagte die Frau.
Am Strand blieb sie für sich. Er war fast leer. In ihrem Badeanzug legte sie sich zurück, die Sonne auf dem Gesicht und den Knien. Es war heiß, und die See war ruhig. Sie zog es vor, oben vor den Dünen zu liegen, den sich brechenden Wellen zuzuhören, die laut ans Ufer schlugen wie die letzten Akkorde einer Symphonie, nur dass es immer weiter und weiter ging. Es gab nichts Besseres als das.
Sie kam aus dem Wasser und trocknete sich ab wie das Zigeunermädchen, die Knöchel bedeckt von klebrigem Sand. Sie spürte, wie die Sonne ihre Schultern vergoldete. Die Haare nass, tief in die Leere dieser Tage versunken, schob sie ihr Fahrrad den Weg hinauf, der Staub wie Samt unter ihren Füßen.
Sie nahm nicht den üblichen Weg nach Hause. Es war wenig Verkehr. Der Mittag war flaschengrün, große Häuser zwischen den Bäumen und weite Felder, wie eine Erinnerung, dahinter.
Sie kannte das Haus und sah es schon aus der Ferne mit seltsam schlagendem Herz. Als sie anhielt, tat sie es beiläufig, das Fahrrad zu einer Seite geneigt und sie noch halb im Sattel, als ruhte sie sich ein wenig aus. Wie schön eine einzelne Frau ist, in einer weißen Sommerbluse und mit nackten Beinen. Sie tat so, als stellte sie die Kette ein, während sie das Haus beobachtete, seine hohen Fenster, Wasserflecken oben am Dach. Da war ein Gartenschuppen, verwahrlost, Schösslinge wuchsen auf dem Pfad, der zu ihm führte. Die lange Auffahrt, die Veranda zum Meer hin, alles war leer.
Mit langsamen Schritten, sich bewusst, wie dreist sie war, ging sie auf das Haus zu. Sie wollte unbedingt in die Fenster hineingucken, nicht mehr als das. Dennoch, trotz der Stille, der vollständigen Stille, war es verboten.
Sie ging weiter. Plötzlich erhob sich jemand von der Seitenveranda. Sie konnte weder einen Laut von sich geben noch sich rühren.
Es war ein Hund, ein riesiger Hund, der ihr bis über die Taille ging. Er kam auf sie zu, mit gelben Augen. Sie hatte immer Angst vor Hunden gehabt, der Schäferhund, der unerwartet ihre Zimmergenossin auf dem College angegriffen und ihr ein Stück der Kopfhaut abgerissen hatte. Die Größe dieses Hundes, der gesenkte Kopf und der langsame, bestimmte Gang.
Man durfte keine Angst zeigen, das wusste sie. Langsam bewegte sie das Fahrrad so, dass es zwischen ihnen war. Der Hund blieb ein paar Schritte vor ihr stehen, die Augen auf sie geheftet, die Sonne auf seinem langen Rücken. Sie wusste nicht, was kommen würde, ein plötzlicher kurzer Anlauf.
„Braver Junge“, sagte sie. Ihr fiel nichts anderes ein. „Braver Junge.“
Vorsichtig begann sie, das Fahrrad in Richtung Straße zu schieben, den Kopf leicht abgewandt, um unbesorgt zu scheinen. Ihre Beine fühlten sich nackt an, die bloßen Waden. Sie würden aufgerissen werden wie von einer Sichel. Der Hund folgte ihr, seine Schultern bewegten sich so regelmäßig wie eine Maschine. Irgendwie fand sie den Mut loszufahren. Das Vorderrad wackelte hin und her. Der Hund, so hoch wie der Lenker, kam näher.
„Nein“, rief sie. „Nein!“
Nach ein oder zwei Momenten gehorchte er, wurde langsamer oder wandte sich ab. Er war fort.
Sie fuhr wie befreit, als flöge sie durch Strecken von Sonnenlicht und hohe, feierliche Tunnel aus Bäumen. Und dann sah sie ihn wieder. Er folgte ihr – eigentlich folgte er ihr nicht, da er ein Stück vor ihr war. Er schien durch die Felder zu schweben, die in der Mittagssonne brannten, entzündet. Sie bog in ihre Straße ein. Da kam er. Er schloss sich ihr an, lief direkt hinter ihr. Sie hörte das Klicken seiner Krallen wie fallende Kiesel. Sie blickte sich um. Er trabte schwerfällig, wie ein dicker Mann, der durch den Regen läuft. Ein Speichelfaden hing von seinem Maul herab. Als sie an ihrem Haus ankam, war er verschwunden.
An dem Abend machte sie sich in einen Bademantel gehüllt zum Schlafen fertig, reinigte sich das Gesicht, die Badezimmertür stand einen Spalt offen. Sie bürstete sich mit vielen schnellen Strichen das Haar.
„Müde?“, fragte ihr Mann, als sie herauskam.
Das war seine Art, das Thema anzusprechen.
„Nein“, sagte sie.
Da waren sie also in der Sommernacht mit den fernen Lauten der See. Unter den Dingen, die ihr Mann an Ardis bewunderte, war ihre außerordentlich schöne Haut, leuchtend und glatt, eine Haut so rein, dass man sie kaum zu berühren wagte.
„Warte“, flüsterte sie, „nicht so schnell.“
Hinterher legte er sich ohne ein Wort zurück, bereits in tiefen Schlaf sinkend, viel zu früh. Sie berührte seine Schulter. Sie hörte etwas draußen vor dem Fenster.
„Hast du das gehört?“
„Nein, was?“, fragte er benommen.
Sie wartete. Da war nichts. Es war ein schwacher Laut gewesen, wie ein Seufzer.
Am nächsten Morgen sagte sie: „Oh!“ Da, unter den Bäumen, lag der Hund. Sie konnte seine Ohren sehen – sie waren klein und weiß gefleckt.
„Was ist?“, fragte ihr Mann.
„Nichts“, sagte sie. „Ein Hund. Er ist mir gestern gefolgt.“
„Von wo?“, sagte er und kam sich das selbst ansehen.
„Unten an der Straße. Ich glaube, er könnte diesem Mann gehören. Brennan.“
„Brennan?“
„Ich bin an seinem Haus vorbeigekommen“, sagte sie, „und dann ist er mir gefolgt.“
„Was hast du bei Brennan gemacht?“
„Nichts. Ich bin nur vorbeigefahren. Er ist gar nicht da.“
„Wie meinst du das, er ist gar nicht da?“
„Ich weiß nicht. Das hat jemand gesagt.“
Er ging zur Tür und machte sie auf. Der Hund – es war eine Dogge – hatte da gelegen wie eine Sphinx, mit ausgestreckten Vorderläufen, die Hüften hoch und rund. Schwerfällig richtete er sich auf und bewegte sich kurz darauf, widerwillig, so schien es, fort, lief langsam über die Felder, ohne sich noch einmal umzusehen.
Am Abend gingen sie zu einer Party in der Mecox Road. Weit draußen vor Montauk fegten Winde um die Küste. Die Wellen explodierten in Wolken aus Gischt. Ardis sprach mit einer Frau, die nicht viel älter war als sie. Ihr Mann war vor Kurzem im Alter von erst vierzig Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Er hatte es selber diagnostiziert, sagte sie. Er hatte in einem Theater gesessen, als er plötzlich feststellte, dass er die Wand zu seiner Rechten nicht sehen konnte. Bei der Beerdigung waren zwei Frauen gewesen, die sie nicht kannte und die auch nicht zum Empfang hinterher kamen.
„Natürlich, er war Chirurg“, sagte sie, „und sie werden von Chirurgen angezogen wie die Fliegen. Aber ich hatte nicht den geringsten Verdacht. Ich glaube, ich war einfach ein Riesendummkopf.“
Die Bäume strömten in der Dunkelheit vorbei, als sie nach Hause fuhren. Ihr Haus ragte im strahlenden Licht ihrer Scheinwerfer auf. Sie glaubte, etwas gesehen zu haben, und hoffte seltsamerweise, dass ihr Mann es nicht gesehen hatte. Sie war nervös, als sie über das Gras gingen. Die Sterne waren nicht zu zählen. Sie würden die Tür aufschließen und hineingehen, wo alles vertraut war, sogar heiter.
Bald würden sie ins Bett gehen, während der Wind die Ecken des Hauses ergriff und die dunklen Blätter aufeinanderpeitschten. Sie würden das Licht ausmachen. Alles, was draußen war, würde in der Wildheit bleiben, in der Glorie des Windes.
Es stimmte. Er war da. Er lag auf der Seite, sein weißliches Fell gesträubt. Im Morgenlicht ging sie langsam auf ihn zu. Als er den Kopf hob, waren seine Augen haselnussbraun und golden. Er war nicht mehr so jung, das sah sie, aber seine Kraft lag darin, dass er ungebeugt war. Sie sprach mit natürlicher Stimme.
„Komm“, sagte sie.
Sie machte ein paar Schritte. Zuerst bewegte er sich nicht. Sie blickte sich wieder um. Er folgte ihr.
Es war noch früh. Als sie an der Straße waren, kam ein Auto vorbei, schäbig und von der Sonne gebleicht. Ein Mädchen saß auf dem Rücksitz, ihr Kopf war müde zur Seite gefallen. Sie wurde nach Hause gefahren, dachte Ardis, nach einer anstrengenden Nacht. Sie empfand einen unerklärlichen Neid.
Es war warm, aber die eigentliche Hitze des Tages war noch nicht da. Mehrere Male wartete sie, während er aus Pfützen am Rand der Straße trank. Er stand dabei in ihnen, seine großen nassen Krallen glänzten wie Elfenbein.
Plötzlich stürzte von einer Veranda ein anderer Hund heran, grimmig bellend. Die große Dogge wandte sich mit weiß gebleckten Zähnen um. Sie hielt den Atem an, fürchtete, einen der beiden lahm und blutend zu sehen, aber so wild es klang, sie hielten Abstand voneinander. Nach ein paar schnappenden Bewegungen war es vorbei. Er kam nun weniger stetig mit ihr, Strähnen nasser Haare am Maul.
Am Haus angekommen, ging er auf die Veranda und stand wartend da. Er musste völlig ausgehungert sein, dachte sie. Sie sah sich um, ob jemand da war. Ein Stuhl, den sie vorher nicht gesehen hatte, stand draußen auf dem Gras, aber das Haus war still wie immer, nicht einmal die Vorhänge atmeten. Mit einer Hand, die nicht die ihre zu sein schien, versuchte sie, die Tür zu öffnen. Sie war nicht abgeschlossen.
Der Flur war dunkel. Dahinter war ein unordentliches Wohnzimmer, die Couchkissen zerdrückt, Gläser auf den Tischen, Papiere, Schuhe. Im Esszimmer gab es stapelweise Bücher. Es war das Haus eines Künstlers, voller Überfluss und Gleichgültigkeit.
Im Schlafzimmer stand ein großer Schreibtisch, auf der Mitte der Schreibfläche, zwischen Büroklammern und Briefen, war ein Stück freigeräumt. Da lagen Seiten, die in einer fast unlesbaren Handschrift beschrieben waren, unvollständige Zeilen und Wörter, bei denen manche Vokale ausgelassen waren. Tod des Vatrs las sie, dann unentzifferbare Dinge und etwas, das Ktschen leer entsandt zu lauten schien. Und unten, in großem Abstand, zwei Wörter: nochmals, nochmals. Eine Seite, in anderer Handschrift, schien Teil eines Briefes zu sein: Ich liebe Dich zutiefst. Ich bewundere Dich. Ich liebe und bewundere Dich. Sie konnte nicht weiterlesen. Sie fühlte sich zu unwohl dabei. Es gab Dinge, die sie gar nicht wissen wollte. In einem gehämmerten Silberrahmen war das Bild einer Frau, das Gesicht von Schatten verdunkelt, an einer Wand lehnend, das ungesehene Weiß einer Villa irgendwo dahinter. Durch die Streifenjalousien konnte man das sanfte Klacken der Palmenwedel hören, die Vögel weit darüber, in der Villa, wo er sie gefunden hatte, wo ihre Jugend so kühn gewesen war wie eine Kriegserklärung. Nein, das war es nicht. Er hatte sie an einem Strand getroffen, sie waren zur Villa gegangen. Welche Macht der Blick auf ein wahreres Leben hat. Sie las die schräg geneigte Inschrift auf Spanisch: Tus besos me destierran. Sie stellte das Foto wieder ab. Ein Foto war sakrosankt, es schloss einen aus, immer. Das war also die Frau. Tus besos, deine Küsse.
Sie schlenderte, fast wie im Traum, in ein großes Badezimmer, das auf den Garten hinausging. Als sie eintrat, blieb ihr das Herz beinahe stehen – sie sah jemanden im Spiegel. Sie brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass sie selbst es war und, als sie näher hinsah, ein nicht ganz erkennbares, sogar ein unerlaubtes Selbst im weichen, körnigen Licht. Da verstand sie, akzeptierte das Schicksal, dass sie hier gefunden werden sollte, dass Brennan, um Post oder Brot zu holen, zurückkommen und sie entdecken würde. Aus dem Nichts würde sie das lähmende Geräusch von Fußtritten oder eines Wagens hören. Dennoch sah sie sich selbst weiter an. Sie war im Haus des Dichters, des Dämons. Sie hatte verbotene Räume betreten. Tus besos … die Wörter waren nicht verklungen. In diesem Moment kam der Hund an die Tür, stand da und ließ sich dann auf den Boden fallen, seine wissenden Augen auf ihr, wie ein vertrauter Freund. Sie wandte sich zu ihm um. Alles, was sie nie getan hatte, schien greifbar.
Langsam, ohne nachzudenken, begann sie sich auszuziehen. Sie ging nicht weiter als bis zur Taille. Sie war geblendet von dem, was sie da tat. In der Stille, mit dem Sonnenlicht draußen, stand sie schlank und halb nackt da, das fehlende Bild ihrer selbst, aller Frauen. Die Augen des Hundes waren wie in Verehrung zu ihr erhoben. Er würde sie nie verraten, er war ein Gefährte wie kein anderer. Sie dachte an bestimmte Gestalten aus ihrem College, ältere Mädchen. Kit Vining, Nan Boudreau. Ihre Gesichter und ihr Ruf waren legendär gewesen. Sie hatte sich danach gesehnt, zu sein wie sie, aber sie schien nie die Chance zu haben. Sie beugte sich vor, um den schönen Kopf zu streicheln.
„Du bist ein großer Bursche.“ Die Worte schienen ihr echt, echter als alles, was sie seit langer Zeit gesagt hatte. „Ein sehr großer Bursche.“
Sein langer Schweif bewegte sich und fegte mit einem leisen Geräusch über den Boden. Sie kniete sich hin und streichelte seinen Kopf wieder und wieder.
Da war das Knirschen von Kies unter den Reifen eines Wagens. Es brachte sie abrupt zu Sinnen. Eilig, fast panisch, streifte sie sich die Kleider über und ging in die Küche. Sie würde im Notfall die Veranda entlanglaufen und dann von Baum zu Baum. Sie öffnete die Tür und horchte. Nichts. Als sie schnell die Treppen der Gartentür an der Seite des Hauses hinunterging, sah sie ihren Mann. Gott sei Dank, dachte sie hilflos.
Sie gingen langsam aufeinander zu. Er blickte auf das Haus.
„Ich bin mit dem Wagen gekommen. Ist jemand hier?“
Sie schwieg einen Moment.
„Nein, niemand.“ Sie spürte, dass ihr Gesicht erstarrte, als hätte sie gelogen.
„Was hast du gemacht?“, fragte er.
„Ich war in der Küche“, sagte sie. „Ich hab versucht, Futter für ihn zu finden.“
„Hast du was gefunden?“
„Ja, nein“, sagte sie.
Er stand da und sah sie an. Schließlich sagte er: „Lass uns fahren.“
Als sie zurücksetzten, sah sie den Hund, der sich gerade in den Schatten legte, mit ausgestreckten Beinen, trostlos. Sie spürte die Nacktheit unter ihren Kleidern, die Befriedigung. Sie bogen auf die Landstraße.
„Jemand muss ihn füttern“, sagte sie unterwegs. Sie sah auf die Häuser und die Felder hinaus. Warren sagte nichts. Er fuhr schneller. Sie drehte sich um, blickte zurück. Einen Moment glaubte sie, den Hund zu sehen, wie er ihnen mit großem Abstand folgte.
Am Nachmittag ging sie einkaufen und kam um fünf nach Hause. Der Wind, der wieder stärker geworden war, warf die Tür knallend zu.
„Warren?“
„Hast du ihn gesehen?“, sagte ihr Mann.
„Ja.“
Er war wiedergekommen. Er lag da, wo das Grundstück leicht anstieg. „Ich ruf das Tierheim an“, sagte sie.
„Die werden nichts unternehmen. Er ist ja kein Streuner.“
„Ich halte das nicht aus. Ich ruf jemanden an“, sagte sie.
„Warum rufst du nicht die Polizei an? Vielleicht erschießen die ihn.“
„Warum machst du das nicht?“, sagte sie kalt. „Borg dir von jemandem ein Gewehr. Er macht mich verrückt.“
Es blieb bis gegen neun Uhr hell, und im letzten Licht, als die Wolken ein tieferes Blau hatten als der Himmel, ging sie leise hinaus, über die Rasenfläche zu ihm. Ihr Mann beobachtete sie vom Fenster aus. Sie trug eine weiße Schüssel. Sie konnte ihn genau sehen, das Grau seiner Schnauze dort in dem stumpfen Gras, und als sie näherkam, die klaren braunen Augen. Fast feierlich kniete sie sich hin. Der Wind war in ihrem Haar. Sie erschien in dem nachlassenden Licht fast wie eine Verrückte.
„Hier. Trink etwas“, sagte sie.
Sein Blick, ein wenig vorwurfsvoll, schweifte weg. Er war wie ein Flüchtling, der auf seinem Mantel schlief. Seine Augen waren fast geschlossen.
Mein Leben war bedeutungslos, dachte sie. Sie wollte vor allem das nicht eingestehen.
Sie aßen schweigend zu Abend. Ihr Mann sah sie nicht an. Ihr Gesicht ärgerte ihn, er wusste nicht, warum. Sie sah an sich gut aus, aber nicht immer. Ihr Gesicht war wie eine Serie von Fotos, von denen man einige hätte wegwerfen sollen. Heute Abend war das so.
„Das Meer ist in den Sag Pond eingebrochen“, sagte sie matt.
„Ach ja?“
„Sie dachten, dass ein kleines Mädchen ertrunken sei. Die Feuerwehr war da. Aber dann stellte sich heraus, dass sie nur rumgestreunt war.“ Nach einer Pause sagte sie: „Wir müssen etwas tun.“
„Was geschehen soll, geschieht“, sagte er ihr.
„Dies ist was anderes“, sagte sie. Abrupt ging sie aus dem Zimmer. Sie fühlte sich den Tränen nah.
Der Beruf ihres Mannes war im Wesentlichen ein beratender. Sein Leben bestand darin, anderen Leben zu dienen. Er half anderen, zu Einverständnissen zu kommen, Ehen zu beenden, sich gegen frühere Freunde zu verteidigen. Er konnte das ausgezeichnet. Die Sprache und die Techniken dieser Verhandlungen waren ein Teil von ihm. Er lebte inmitten von Erregung und Egoismus, aber er selbst war davor geschützt. In seinen Akten fanden sich Briefe, Memoranden, die Geheimnisse von Karrieren. Eines hatte er begriffen: wie nahe man der Katastrophe sein konnte, egal, wie sicher man sich fühlte. Er hatte gesehen, wie die Dinge plötzlich eine Wendung nehmen konnten, wie ein ruinöses Ereignis auf das andere folgte. Das konnte ohne Warnung kommen. Manchmal konnte man sich retten, aber es gab einen Punkt, an dem das nicht mehr möglich war. Er fragte sich manchmal, wie das bei ihm selbst sein würde – wenn der Schlag kam und die Stützpfeiler nachgaben und brachen, was würde dann geschehen?
Sie rief schon wieder bei Brennans zu Hause an. Da nahm nie jemand ab.
Während der Nacht tobte sich der Wind aus und ließ dann nach. Beim ersten Licht des Morgens spürte Warren die Stille. Er lag im Bett, ohne sich zu rühren. Seine Frau hatte ihm den Rücken zugekehrt. Er spürte ihre Abwehr.
Er stand auf und trat ans Fenster. Der Hund war da, er konnte seine Gestalt sehen. Warren wusste nicht viel von Tieren und nichts von der Natur, aber er konnte sehen, was geschehen war. Der Hund lag anders da.
„Was ist los?“, fragte sie. Sie war neben ihn getreten. Sie schien lange dazustehen. „Er ist tot.“
Sie wollte zur Tür. Er hielt sie am Arm fest.
„Lass mich los“, sagte sie.
„Ardis …“
Sie begann zu weinen. „Lass mich los.“
„Fass ihn nicht an!“, rief er ihr nach. „Lass ihn in Ruhe!“
In ihrem Nachthemd lief sie schnell über das Gras. Der Boden war nass. Als sie näherkam, blieb sie stehen, um sich zu beruhigen, um Mut zu schöpfen. Sie bedauerte nur eins – sie hatte nicht Lebewohl gesagt.
Sie trat einen oder zwei Schritte vor. Sie konnte sein schweres, kraftloses Gewicht spüren, ein Gewicht, das sich zerstreuen, zu etwas anderem werden würde, die Sehnen würden zerfallen, die Knochen leicht werden. Sie sehnte sich danach, etwas zu tun, was sie nie getan hatte, ihn zu umarmen. In dem Augenblick hob er den Kopf.
„Warren!“, rief sie, sich dem Haus zuwendend. „Warren!“
Als ob die Rufe ihn verstört hätten, kam der Hund auf die Beine. Er bewegte sich müde, entfernte sich von ihr. Die Hände vorm Mund, starrte sie auf die Stelle, wo er gelegen hatte und das Gras flachgedrückt war. Die ganze Nacht wieder. Wieder die ganze Nacht. Als sie aufsah, war er schon ein Stück weg. Sie lief ihm nach. Warren konnte sie sehen. Sie schien frei. Sie schien wie eine andere Frau, eine jüngere Frau, eine von denen, die man im Bikini auf den staubigen Feldern am Meer sah, mit bloßen Füßen Kartoffeln stehlend.
Sie sah ihn nicht wieder. Sie kam oft an dem Haus vorbei, sah manchmal Brennans Wagen dort, aber nie eine Spur von dem Hund, auch nicht auf der Straße oder draußen auf den Feldern.
Eines Abends im Cato’s, Ende August, sah sie Brennan selbst an der Bar. Er trug den Arm in einer Schlinge, sie hatte keine Ahnung, was für einen Unfall er gehabt hatte. Er sprach auf den Barmann ein, es war dieselbe feurige Beredsamkeit, und obwohl das Restaurant voll war, blieben die Hocker neben ihm leer. Er war allein. Der Hund war nicht draußen, auch nicht in seinem Auto, er war nicht mehr Teil seines Lebens – er war weg, verloren, lebte woanders, vielleicht fand sein Name eines Tages den Weg in eine Gedichtzeile, aber sehr wahrscheinlich war er vergessen, nur nicht von ihr.
[1] Zitiert nach: Ezra Pound, Die Frau des Flusshändlers, in der Übersetzung von von Eva Hesse.
„Seine Sprache ist alles andere als beiläufig, er hat das elliptische Erzählen zu einer beinahe stenografischen Form kondensiert wie kein anderer Autor der amerikanischen Literaturgeschichte.“
„Klassikerverdächtig. In dieser Ruhe und Gelassenheit liegt eine unglaubliche Kraft.“
„Besonders in seinen Kurzgeschichten zeigt sich seine Meisterschaft, es sind kleine literarische Schätze, die erzählen von Männern und Frauen in ihren verletzlichsten Momenten. (…) Die Geschichten zeigen das Schöne im Gewöhnlichen, wie wunderbar.“
„Wie bei allen Großmeistern der Short Story liest sich bei James Salter jede von ihnen ganz leicht; was die Schwere des Unglücks, das über die Personen unversehens hereinbricht, umso gewichtiger wirken lässt. (…) Man möchte jeden Leser dazu zwingen, Salter zu lesen.“
„Ein meisterhaftes Buch.“
„Ein Band mit sämtlichen Erzählungen James Salters zeigt den amerikanischen Autor auf der Höhe der Kunst.“
„Unvergesslich“
„Ein begnadeter amerikanischer Erzähler.“
„Seine Stories zeigen ihn als literarischen Chronisten des alltäglichen Lebens: Sie spiegeln nicht die Realität, sondern sie sind eine eigene, neue Wirklichkeit.“
„Während seine Romane ›Ein Spiel und ein Zeitvertreib‹, ›Lichtjahre‹ und ›Alles, was ist‹ als Klassiker gelten, sind seine Erzählungen bislang nur das, womit er sich zwischendrin schwertat. Aber sie haben ihren eigenen, exquisiten Ton. Schneller geschnitten, dramaturgisch verwegener aufgebaut, voller Falltüren, die sich hinter einem schließen und selbst schlechte Liebhaber nicht lächerlich erscheinen lassen.“
„Man muss aufmerksam sein beim Lesen seiner mit streng ausgewählten Details eingerichteten Geschichten, die hell sind, geräumig und von kühler Eleganz, voller Nachmittage,Tiereund Spiegel, in denen die Figuren unvermutet auf sich selbst stoßen und erschrecken. Seine Sätze gehen tief: Sie legen bloß,was unsere Menschlichkeit ausmacht.“
„Ein Lese-Erlebnis, unvergleichlich.“
„Eine Einstiegsdroge für Salter-Neulinge, ein praller Band mit Geschichten, die einen Blick in die amerikanische Gesellschaft eröffnen.“
„Der US-amerikanische Schriftsteller James Salter gilt als Meister der Verknappung.“
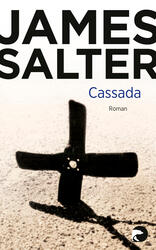

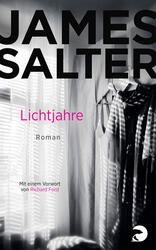







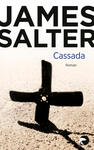


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.