

Comeback mit Backpack Comeback mit Backpack - eBook-Ausgabe
Eine Zeitreise durch Südamerika
„Ein leidenschaftlicher Beweis, dass die große Freiheit kein Verfallsdatum kennt.“ - Dresdner Neueste Nachrichten
Comeback mit Backpack — Inhalt
Zum Reisen ist man nie zu alt
1980 zog Gitti Müller als Backpackerin in die Welt. Mit einem One-Way-Ticket gelangte sie an den Amazonas, erkundete die Anden und lauschte den Wellen am Pazifikstrand. Fünfunddreißig Jahre später schultert sie erneut den Rucksack in Richtung Südamerika … Familie und Freunde halten die Idee für verrückt, doch unbeirrt macht sie sich auf, ihren Traum ein zweites Mal zu verwirklichen. Mitreißend und offenherzig schildert sie, wie sie als 24-Jährige ohne Google Maps und Smartphone ahnungslos in Militärdiktaturen stolperte, sich im Urwald verlief oder Travellerschecks unter die Kleidung klebte, und spiegelt daran augenzwinkernd ihre Erfahrungen von heute. Berichtet von generationsübergreifenden Begegnungen in Hostels und verrät, wie faszinierend das Alleinreisen als Frau immer noch sein kann. Ein leidenschaftlicher Beweis, dass die große Freiheit kein Verfallsdatum kennt.
Mit zahlreichen praktischen Tipps zum Backpacken für Jung und Alt
Leseprobe zu „Comeback mit Backpack “
2015 Deutschland digital
Wiedererwachen
Eines Morgens ist die Idee plötzlich da. Ich liege noch im Bett, gerade aufgewacht, die Haare wirr, die Lider schwer, und denke: Montevideo. Wie ein Hauch von zartem Frühnebel, der sich jeden Moment verflüchtigen will, schwebt und wabert der Gedanke hinter meiner Stirn. Müsste ich jetzt einen Wecker abstellen oder einen Blick auf die Uhr werfen, er wäre fort. Bestimmt. Hätte ich einen ganz normalen Job mit festen Arbeitszeiten, wäre ich ins Bad geeilt, hätte unter der Dusche gedanklich meine To-do-Liste [...]
2015 Deutschland digital
Wiedererwachen
Eines Morgens ist die Idee plötzlich da. Ich liege noch im Bett, gerade aufgewacht, die Haare wirr, die Lider schwer, und denke: Montevideo. Wie ein Hauch von zartem Frühnebel, der sich jeden Moment verflüchtigen will, schwebt und wabert der Gedanke hinter meiner Stirn. Müsste ich jetzt einen Wecker abstellen oder einen Blick auf die Uhr werfen, er wäre fort. Bestimmt. Hätte ich einen ganz normalen Job mit festen Arbeitszeiten, wäre ich ins Bad geeilt, hätte unter der Dusche gedanklich meine To-do-Liste aktualisiert, dann einen starken Kaffee getrunken, und es wäre nicht mal mehr der Ansatz einer Erinnerung daran geblieben. So aber halte ich die Augen geschlossen und sehe den Schriftzug Montevideo vor mir. Der nächste Gedanke ist: Da muss ich hin. Unbedingt!
Das Dösen am Morgen kann ich mir erlauben, denn ich bin Freiberuflerin. Vor mehr als drei Jahrzehnten habe ich meinen sicheren Arbeitsplatz in einem Reisebüro aufgegeben, das Abitur nachgeholt und studiert. Seitdem verdiene ich mein Geld mit Jobs für Film und Fernsehen. Die Aufträge kommen mit beständiger Unregelmäßigkeit herein und rauben mir oft den Schlaf, den ich erst wiederfinde, wenn das Honorar eingegangen und die Miete gesichert ist. Dann geht alles von vorne los. Themen suchen, Exposés schreiben, Klinken putzen …
Heute habe ich keine Termine, nur einen ahnungslosen Schreibtisch, der auf Einfälle wartet, während ich in Jogginghose und XXL-Pullover in die Küche schlurfe, um mir einen großen Latte macchiato zu machen. Es ist einer jener Tage des großen Freiheitsversprechens. Für diese Tage habe ich meine finanzielle Sicherheit und die „Wie war dein Wochenende?“-Gespräche aufgegeben.
Ich trinke meinen Kaffee, und der Montevideo-Gedanke schaut mir dabei zu. Wo zum Teufel liegt das eigentlich, Montevideo?, denke ich und schalte meinen Laptop ein, um nachzuschauen. Jetzt sind die Würfel gefallen. Aus dem Gedanken ist Handeln geworden, somit kann er sich nun nicht mehr verflüchtigen. Ich gebe „Montevideo“ bei Google Maps ein und blicke gespannt auf die sich aufbauende Landkarte. Na klar! Uruguay, dieses winzig kleine Land zwischen den beiden Riesen Argentinien und Brasilien. Hauptstadt: Montevideo. Uruguay ist eines der ganz wenigen Länder in Südamerika, die ich während einer Rucksackreise vor 35 Jahren nicht besucht habe. Ich habe den kleinen Staat wohl schlicht übersehen. Und nun sitzt er in meinem Kopf und will nicht mehr fort.
Während ich mir einen Smoothie zubereite, starre ich, den Kopf in die Hände gestützt, auf das wirbelnde Grünzeug im Mixer vor mir. Feldsalat und Spinat drehen sich mit zunehmender Geschwindigkeit und lassen das Bild einer Pirouetten drehenden Eisprinzessin entstehen. Mit einem leicht durchsichtigen Tutu und einem dicken grünen Rucksack auf dem Rücken vollführe ich Sprünge und doppelte Rittberger. Was für ein verrücktes Bild, denke ich. So ein Rucksack wäre ja wohl eher hinderlich auf der Eisfläche. Aber das Gefühl von Leichtigkeit, von Freude und Freiheit, wie ich da über das imaginäre Eis schwebe – es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich, ein grüner Rucksack spielt in dieser Erinnerung auch eine Rolle. Es ist lange her, aber immer noch lebendig. 1980.
1980 Frankreich analog
Nix wie weg
Ich gehöre zur Generation der Babyboomer. Wir waren damals viele, und eines einte uns: Wir wollten anders sein als unsere Eltern, total anders. Weg von den Wohnzimmern mit Schrankwänden aus deutscher Eiche, weg vom Wirtschaftswunder und Konsumterror der Siebzigerjahre, weg vom spießigen Sonntagnachmittagsmief, von Hütchen, Schühchen, passenden Täschchen, weg von all dem, was nach Konvention und Langeweile roch. Man könnte auch sagen, ich bin Generation N, Generation Nix-wie-weg. Manche tuckerten in den Siebzigern und frühen Achtzigern mit dem VW-Bus durch Afghanistan, andere flogen nach Indien und meditierten in Aschrams oder fuhren nach Ibiza, wo sie in Höhlen wohnten und Armbändchen flochten. Einige bauten Schulen in Nicaragua oder gruben Brunnen in Afrika, andere schlossen sich den Beduinen an und fanden das Glück in der Wüste. Ich schaute mit 13 am Kölner Hauptbahnhof den Zügen hinterher und wanderte mit 19 nach Paris aus. Mit 23 stand ich in der Wartehalle des Flughafens Roissy und wollte mal wieder nix wie weg, aber diesmal richtig. Richtig weit. Und richtig lange.
Meine Stiefel waren gut zwei Nummern zu groß, aus schwerem Leder mit dicker Sohle. Trotzdem kam ich mir darin kein bisschen klobig vor. Im Gegenteil: Ich fühlte mich leicht wie eine Eisprinzessin. Die groben Schuhe gaben meinen zu dünnen Beinen sicheren Halt und das gute Gefühl, zuverlässigen Kontakt zur Erde zu haben. Auch wenn ich noch auf dem zubetonierten Grund der Abflughalle Paris-Roissy stand. Noch. Doch schon bald sollten sie mich trockenen Fußes durch Urwaldflüsse bringen. Im hohen Gras der Tropen sollten sich Giftschlangen die Zähne an ihrem harten Leder ausbeißen, und auf 4000 Meter Höhe in den Anden sollten mich die dicken Sohlen vor Steinen, Geröll und Dornen schützen. Wohlwollend betrachtete ich sie. Handarbeit, maßgefertigt vom Schuster meines Stadtviertels Montmartre. Ich wollte sie so groß. Schick waren sie nicht gerade, und in Paris, wo ich die letzten drei Jahre gelebt hatte, waren sie allemal ungewöhnlich. Sie wogen gut zwei Kilo. Schon deshalb würde ich sie unterwegs immer tragen müssen, damit ich sie nicht im Rucksack zu schleppen brauchte.
Unverwüstlich stand ich also in den neuen Schuhen am Check-in-Schalter, während um mich herum flatterhafte Betriebsamkeit herrschte. Menschen blickten nervös auf ihre Uhren. Männer trugen Aktenkoffer geschäftig hin und her, so, als hätten sie Dringendes zu tun. Gepäckstücke wurden geschleppt, gezogen, eine ältere Dame suchte verzweifelt nach ihrem Flugticket. Lautsprecherdurchsagen meldeten krächzend den kleinen Henry, der seine Mutter verloren hatte, sowie Ankommende, die ihre Abholer nicht finden konnten. Inmitten dieser planmäßigen Unruhe fühlte ich mich seltsam ruhig. So ruhig wie noch nie. Alles war in diesem Moment perfekt. Ich musste nichts mehr tun, nichts mehr überlegen und nichts entscheiden. Es war, als stünde die Zeit still. Ich stand ähnlich still, atmete tief durch und fühlte mich großartig. Ich war jung, hatte unendlich Zeit, keine Verpflichtungen, keine Verabredungen, nicht einmal eine Flugreservierung. Ich flog Stand-by. Das war billiger und hieß: Gab es einen freien Platz, flog ich um 14 Uhr nach Cayenne. Gab es keinen, flog ich am nächsten Tag oder am übernächsten. Und zwar nur hin. Es war ein One-Way-Ticket.
Ich hatte auch keinen materiellen Ballast: keine Wohnung, um die ich mich kümmern musste, keine Rechnungen, die auf Bezahlung warteten. Alles, was ich besaß, war stillgelegt. Bücher und Kleider in Kisten gepackt, der Haushalt aufgelöst, Nützliches verschenkt und Unnützes weggeworfen. Auszeit von meinen Sachen. Bis auf zehn Kilo geplanter Nützlichkeit, verstaut in einem grünen Rucksack mit Metallgestänge. Tagelang hatte ich hin und her geräumt und gerückt, dieses rein, jenes raus, entschieden und wieder verworfen.
Zuletzt kamen fein säuberlich auf eine Liste und in den Rucksack: 1 Jeans, 1 Bermudashorts, 4 T-Shirts, Unterwäsche, 4 Paar Strümpfe, 1 langärmliges Tropenhemd, 1 Bikini, wasserfeste Sandalen, 1 Bettbezug zum Reinschlüpfen wegen der Wanzen, 1 Moskitonetz wegen der Mücken, 1 Kamera und 4 Filmrollen. Zudem 1 Wäscheleine und 4 Wäscheklammern sowie 1 Stück Kernseife, Zahnpasta und Zahnbürste. Außerdem ein nicht unerheblicher Vorrat an Zigarettentabak und Papierblättchen. Um den Bauch, direkt auf der Haut, trug ich einen cremefarbenen Geldgürtel mit 2500 Dollar in Travellerschecks und 500 Dollar in bar, sorgfältig eingewickelt in Plastikfolie, damit sich die Scheine nicht auflösten, wenn ich schwitzte. Außerdem befand sich mein frisch ausgestellter Reisepass darin, mit einem Visum für Französisch-Guayana. Frühestens in einem Jahr wollte ich zurückkommen. Wenn überhaupt.
Die letzten beiden freien Plätze in der 14-Uhr-Maschine gingen an uns. Es hatte geklappt.
Während die üblichen Durchsagen gemacht wurden, rutschten wir ungeduldig auf unseren Sitzen herum. „Kneif mich“, sagte ich, und Christian, mein französischer Freund und Reisegefährte, knuffte mich in die Rippen. „Kneif du mich“, sagte Christian, und ich startete eine Kitzelattacke. Wir beide waren die Einzigen an Bord, die ausgelassen lachten und alberten. Um uns herum nur Geschäftsleute. Klar, wer machte schon Urlaub in Guayana. Wir ja auch nicht. Wir gingen auf Entdeckungsreise nach Südamerika, und die fing nun mal in Cayenne an. Wir hatten nicht einmal eine Reiseroute und wollten so lange bleiben, wie uns die Dollar trugen.
Drei Jahre lang hatten wir beide gearbeitet und jeden Cent gespart. Ein heruntergekommenes Zimmer in der Rue Lamarck am Fuße des Montmartre war unser Zuhause gewesen. Ein Dachzimmer, eine ehemalige chambre de bonne, an dessen Schrägen wir uns die Köpfe stießen. Die alten, teilweise abgelösten Tapeten mit den großen gelben Sonnenblumen hatten wir notdürftig an den schiefen Wänden festgeklebt. Wir wollten ja nicht lange bleiben. Nur mal kurz arbeiten und sparen und dann nichts wie weg. Unser Leben bestand aus „métro, boulot, dodo“, wie die Pariser sagen, also aus „Metro fahren, arbeiten, schlafen“. Und träumen. Wir schwärmten von dieser Reise wie Teenager von einem Idol, das sie doch gar nicht kannten. Abends, wenn wir unseren billigen Wein tranken, malten wir uns aus, unter Palmen zu liegen, frischen Lobster zu essen und Cuba Libre zu trinken. Wenn der Sommer in Paris den Asphalt dampfen ließ und wir schwitzend zu unseren Jobs trotteten, stellten wir uns vor, unter tropischen Wasserfällen zu duschen oder im glasklaren Wasser des Titicacasees zu schwimmen.
Dass wir tatsächlich irgendwann am Titicacasee saßen und nicht etwa auf Ko Samui, hatte etwas mit einer Münze zu tun. Wir konnten uns nämlich anfangs nicht einigen, wohin die Reise gehen sollte. Christian wollte nach Asien, ich nach Südamerika. Unbedingt nach Südamerika. Warum, wusste ich selbst nicht so genau.
Jahre später fiel es mir dann ein. Ich hatte bei meinem ersten Freund, in den ich unsterblich verliebt gewesen war, ein Gemälde gesehen: Ein alter Mann, ein südamerikanischer Indianer, sitzt, eingehüllt in seinen Poncho und gestützt auf einen Stock, auf einem Felsen und schaut in die Ferne. Mit seinem Blick hatte er mich eingefangen und ließ mich nicht mehr los. Darin war so viel Wissen, so ein unerschütterliches Vertrauen in das Leben, die Gewissheit, es würde schon alles gut werden. „Da geht es lang!“, sagte dieser Blick. Als wären Zukunft und Vergangenheit in seinen Augen vereint, war er von einer Präsenz, die mich fortan nicht mehr losließ.
Ich lieh mir das Bild aus und versuchte, diesen alten Mann zu malen. Das Muster seines Ponchos in allen Einzelheiten, das tiefe Kobaltblau des Himmels, das so ganz anders, so viel klarer war als in Deutschland. Ich verbrachte Stunde um Stunde, Tag um Tag mit dem Versuch, den Ausdruck des alten Mannes zu treffen, und während ich ihn betrachtete und ihn malte, freundete ich mich mit ihm an. Als das Bild fertig war, versprach ich ihm, eines Tages nach Südamerika zu kommen und ihn zu besuchen.
Christian hingegen träumte von Asien, er wusste damals auch nicht, warum. „Vielleicht war ich in meinem früheren Leben ein Thai“, probierte er mich zaghaft zu überzeugen. Weil keiner von uns nachgeben wollte, warfen wir eine Münze. Ich hatte Kopf, Christian Zahl. Es fiel Kopf. So einfach war das. Christian war ein guter Verlierer, das musste man ihm lassen. Und von da an träumten wir beide gemeinsam von Südamerika.
Als das Flugzeug endlich abhob, wurde alles wahr, wonach wir uns all die Jahre gesehnt hatten. Die große Freiheit, ja, es gab sie wirklich. Das war genau das Gefühl, für das ich meine Blitzkarriere in Paris hingeschmissen hatte. Die totale Unabhängigkeit auf Zeit. Ein Gefühl, das stärker war als all die Zweifel, die mich zwischendurch immer wieder überkommen hatten. Etwa wenn mein Chef sagte: „Warte doch noch ein paar Jahre mit der Reise.“ Oder wenn die Eltern fassungslos den Kopf schüttelten und einfach nur seufzten: „Nä, nä, nä, Kindchen …“ Oder wenn Freunde rieten: „Mach das doch, wenn du alt bist.“
Alles gut gemeinte Ratschläge, aber ich roch die Lunte: Wäre ich nach ein paar Jahren Luxusleben noch bereit, in billigen Bruchbuden abzusteigen? Würde ich mich in drittklassige Züge setzen, zwischen Ziegen und Hühner? Würde ich Flusswasser trinken, wenn es kein anderes gab? Wäre ich dann nicht schon viel zu vernünftig?
Vielleicht hätte ich bereits Kinder. Und ein Haus, das abbezahlt werden müsste. Und einen Friseur, zu dem ich einmal im Monat ginge; „meine“ Kosmetikerin, „meinen“ Käseladen, „meine“ Boulangerie, „mein“ Oberbekleidungsgeschäft. Wie alle Pariserinnen. Vielleicht liefe ich in ein paar Jahren nur noch in High Heels herum, und die Vorstellung, klobige Stiefel anzuziehen, wäre völlig absurd. Selbst wenn nicht: Hätte ich dann überhaupt noch den Mut, alles hinter mir zu lassen? Den schönen Arbeitsplatz, das satte Gehalt, den guten Wein (den ich dann bestimmt trinken würde), die Restaurantbesuche mit Austern, Coq au vin und fünf Nachspeisen, die geräumige Wohnung mit begehbarem Kleiderschrank, das fließende Leitungswasser, den Kühlschrank, das französische Bett? Würde ich alles hinter mir lassen können, wenn ich einmal ins Reich der Bequemlichkeit abgetaucht wäre? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich hatte da so meine Zweifel. Und diese Reise wollte ich unbedingt machen. Nicht später. Nicht wenn ich in Rente war. Oder an Krücken lief. Sondern jetzt.
Die Wolken flogen wie Zuckerwatte am Fenster vorbei, und ich saugte das Gefühl von unendlicher Freiheit und zitternder Erwartung in mir auf, als gelte es, den Rekord im Glücklichsein zu brechen.



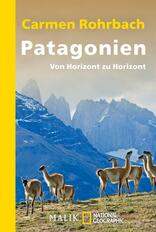







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.