

Cortex Cortex - eBook-Ausgabe
Thriller
— Ein packender Wissenschaftsthriller, exzellent recherchiert„Wer sich auf diesen turbulenten Wissenschaftsthriller einlässt, der wird von der ersten bis zur letzten Seite gut unterhalten und nebenbei auch ein bisschen klüger.“ - Wilhelmshavener Zeitung
Cortex — Inhalt
Ein Thriller der besonderen Art: In einem Biolabor wird mit gezüchtetem menschlichem Gewebe experimentiert – doch das Unterfangen gerät außer Kontrolle …
In den USA stürzt ein Flugzeug unter rätselhaften Umständen ab. In Honduras kommt es zu einer Reihe brutaler Morde. Als die Reporterin Livia Chang den Fall untersucht, stößt sie auf bizarre Ungereimtheiten: Eine verdächtige Hautprobe, ein geheimes Forschungslabor, aggressive Meerestiere, ein chinesischer Magnat. Nach und nach kommt sie einem Komplott ungeheuerlichen Ausmaßes auf die Spur. Menschenversuche sind außer Kontrolle geraten. Wird sie selbst Opfer dieser Machenschaften? Vor scheinbar unlösbare Aufgaben gestellt, muss sie nicht nur ihre eigene Familie retten, sondern auch einen Anschlag auf höchster politischer Ebene vereiteln.
„Eine modernisierte Version von Mary Shellys Frankenstein – wissenschaftlich unmoralisch, aber denkbar.“ BR24
Als Wissenschaftsjournalist konnte Patrick Illinger in einem Max-Planck-Institut selbst erleben, wie menschliches Gewebe gezüchtet wird. Wie realistisch ist das Szenario aus „Cortex“?
„Noch ist diese Forschung am Anfang. Und das Szenario in Cortex ist fiktiv. Aber die Fortschritte sind gewaltig und ethische Grenzen werden unweigerlich berührt. Gezüchtetes menschliches Gehirngewebe wurde bereits in Tiere verpflanzt, mit erstaunlichen Ergebnissen. Was, wenn man noch weiter geht? Eines habe ich gelernt als Journalist: Grenzen werden irgendwann überschritten. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht in staatlich finanzierten Laboren, aber geforscht wird auch an anderen, oft obskuren Orten.“
„Cortex“ ist genial recherchiert und atemberaubend spannend
Der Journalist und Autor Patrick Illinger war selbst Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. 1997 ging er zur Süddeutschen Zeitung, wo er viele Jahre lang das Ressort „Wissen“ leitete und nun die Wochenendausgabe der SZ koordiniert. Dem Autor und erfahrenen Wissenschaftsjournalisten ist mit „Cortex“ ein rasanter Thriller über die Macht der Wissenschaft und der modernen Gentechnik gelungen.
Leseprobe zu „Cortex“
Teil 1
1
12 Chestnut Road, Newnan, Georgia, USA
Zwei Minuten, bevor ihre Welt unterging, kniete Maria Jiménez vor einem Bohnenstrauch. Sie stieß einen Fluch aus, zog eine knallgrüne Sprühflasche aus dem Putzeimer und nebelte die Pflanze von oben bis unten ein. Mit einem Lächeln blickte sie auf das Warndreieck auf der Dose. Das Zeug war ein Wunder. Die reinste Biowaffe. Keine Blattlaus würde das überleben.
Schuldbewusst blickte sie sich um. Familie Dawson wäre mit ihrem kleinen Geheimnis ganz und gar nicht einverstanden. Hunderte Male hatten die Arbeitgeber [...]
Teil 1
1
12 Chestnut Road, Newnan, Georgia, USA
Zwei Minuten, bevor ihre Welt unterging, kniete Maria Jiménez vor einem Bohnenstrauch. Sie stieß einen Fluch aus, zog eine knallgrüne Sprühflasche aus dem Putzeimer und nebelte die Pflanze von oben bis unten ein. Mit einem Lächeln blickte sie auf das Warndreieck auf der Dose. Das Zeug war ein Wunder. Die reinste Biowaffe. Keine Blattlaus würde das überleben.
Schuldbewusst blickte sie sich um. Familie Dawson wäre mit ihrem kleinen Geheimnis ganz und gar nicht einverstanden. Hunderte Male hatten die Arbeitgeber ihr eingeschärft, keine Chemie im Garten zu benutzen, weder im Hochbeet noch sonst wo. „Organic“ stand auf jeder Lebensmittelpackung, die Ms. Dawson von ihren Einkäufen nach Hause brachte.
Aber Ms. Dawson musste auch nicht mit ansehen, wie die Blattläuse jeden Tag das Gemüse, die Kräuter, ja sogar die Süßkartoffelstauden zerfraßen, dachte Maria Jiménez. Also hatte sie von ihrem eigenen Geld dieses prächtige Wundermittel gekauft. Ein Zisch, und die Schädlinge fielen wie Brotkrümel von den Gewächsen. Die grüne Spraydose war ungleich wirkungsvoller als das Zwiebelwasser, das Ms. Dawson als Mittel gegen die Läuse zusammenbraute.
Die Dawsons brauchten nichts davon zu erfahren. Appetitliche Bohnen würden auch ihnen besser gefallen als zerfressene Sträucher. Allerdings war Maria Jiménez klar, dass sie ihren Job riskierte, sollten die Dawsons erfahren, dass sie im Biogarten eine chemische Keule einsetzte.
Mit einem Seufzen stand sie auf, stemmte sich auf den Rechen und drückte ihren steif gewordenen Rücken durch. Die Okras waren bald reif. Das Basilikum sah allerdings erbärmlich aus. Sie fragte sich, ob sie das Kräuterbeet woanders hätte platzieren sollen.
Aus dem Augenwinkel blickte sie durch die Kozuhecke auf die Straße. Selten genug kam ein Auto durch die Chestnut Street, aber jedes einzelne versetzte ihr einen kleinen Schrecken. Vor zwei Wochen war ihre siebenundsechzig Jahre alte Freundin Carmen in East Newnan verhaftet worden. Die pendejos von der Einwanderungsbehörde wurden immer hartnäckiger. Seit fast vierzig Jahren lebte Maria Jiménez nun im Land der Gringos. Vierzig Jahre als Illegale. Um eine Greencard wollte sie sich nicht bewerben. Dazu müsste sie aus dem Schatten treten und erklären, was sie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hatte. Keine gute Idee. Also führte sie ihr Leben im Verborgenen weiter, so wie Hunderttausende andere Latinas.
Wer würde sich um die Blattläuse in den Vorgärten kümmern, wenn nicht Leute wie sie?
Ein Rauschen ließ die Luft vibrieren. Maria Jiménez drehte den Kopf hin und her, um die Richtung des Geräuschs zu bestimmen. Am Himmel erblickte sie einen leuchtenden Punkt. Sie hielt ihn zuerst für einen Stern. Doch dafür war das Ding zu hell. Und Sterne rauschten nicht. Das Geräusch kam von diesem Licht. Es schwoll zu einem Grollen an. Kein Zweifel, das war ein Flugzeug. Seltsam, dachte Maria Jiménez, Flugzeuge waren in dieser Gegend immer nur weit oben am Himmel zu sehen, klein wie Mücken. Dieses Flugzeug war alles andere als eine Mücke.
Plötzlich verdoppelte sich das Licht. Zwei kräftige Scheinwerfer strahlten nun in ihre Richtung. Und es veranstaltete einen Höllenlärm. Triebwerke heulten in unterschiedlichen Tonlagen auf. Die Flügel standen nicht seitlich, sondern senkrecht nach oben und unten ab. Die Maschine flog hochkant. Der Lärm wurde ohrenbetäubend. Maria Jiménez legte ihre Hände auf die Ohren und blinzelte im Licht der Scheinwerfer. Angst und Adrenalin lähmten ihre Körperfunktionen, als sie zusah, wie sich das Flugzeug dem Erdboden näherte und eine Flügelspitze den Vorgarten der Gulbraiths durchpflügte.
Die Tragfläche brach. Brennendes Kerosin spritzte wie aus einem Flammenwerfer. Der Bug der Maschine krachte mit infernalischem Lärm auf den Asphalt der Chestnut Street. Der übrige Rumpf mit der verbliebenen Tragfläche kreiselte seitwärts über mehrere Einfamilienhäuser hinweg. Maria Jiménez presste ihre Hände noch fester auf die Schläfen, als das abgerissene Seitenleitwerk in die Garage der Vandenbergs einschlug. Das Knirschen brechender Dachstühle mischte sich mit dem Knallen von Aluminiumstreben und dumpfen Einschlägen, die das Erdreich aufspritzen ließen.
Panik lähmte sie. Adrenalin trieb ihren Herzschlag in bedrohliche Höhen. Lehmige Erdbrocken trafen ihren Oberkörper. Sie wich nicht mal aus, als ein glühendes Metallstück so knapp über ihren Kopf schwirrte, dass sie den Luftzug spürte.
Unvermittelt ließ der Lärm nach. Nur noch das Knistern unzähliger Brände erfüllte die Luft, überall dort, wo das Flugzeug sein Kerosin verspritzt hatte. Schwarzer Rauch verdunkelte die Sonne.
Maria Jiménez wollte die Augen schließen und ins Haus rennen. Doch die apokalyptische Szenerie zog sie in ihren Bann. Sie starrte auf das gigantische Seitenleitwerk mit dem Logo der Fluggesellschaft. Reglos bemerkte sie, dass der Walmart knapp verschont geblieben war. Sie hörte die ersten Sirenen von Rettungsfahrzeugen. Ihr Blick schweifte über den mit Erdbrocken und Metallteilen übersäten Garten ihrer Arbeitgeber. Links neben dem Okrabeet, zwischen Süßkartoffeln und Basilikum, erspähte sie einen seltsamen Gegenstand. Sie ging einige Schritte darauf zu. Als ihr klar wurde, was dort lag, quoll ein schrilles Kreischen aus ihrer Kehle.
Sie fiel auf die Knie und übergab sich.
2
Pete’s Tavern, New York City, USA
Yu Jihai, ein zwei Meter fünfzehn großer Angreifer des chinesischen Kaders, trat an die Freiwurfmarke. Dreimal ließ er den Basketball vom Boden abprallen, bevor er den Korb anvisierte. Er hob den Wurfarm und stabilisierte den Ball mit der linken Hand. Die Bewegung sah perfekt aus, aber der Ball prallte an die Platte, federte am Korb ab und fiel zurück ins Spielfeld, wo ihn ein italienischer Abwehrspieler schnappte und zum Gegenangriff überging.
In der Bar brach Jubel aus. Eine Gruppe italienischer Touristen prostete dem Fernsehschirm zu und ließ die Gläser aneinanderknallen.
„Ihr seid noch gut im Rennen“, rief Livia Chang zu ihnen hinüber, „sechs Punkte Rückstand, das ist zu schaffen!“ Ihr Italienisch war makellos.
Die Italiener rissen die Köpfe herum. Sie blickten Livia erstaunt an, hoben ihre Daumen und prosteten ihr zu. Auch sie hob ihr Glas und schenkte ihnen ein Lächeln.
„Was hast du gesagt?“, fragte Rebecca Blumenstein, eine Nachrichtenredakteurin, die neben Livia saß.
„Nur eine kleine Aufmunterung. In Wahrheit fürchte ich, dass ihre Mannschaft keine Chance gegen die Chinesen hat.“
Es war ein langer Tag gewesen. Der Chefredakteur der New York Times hatte die gesamte Redaktion zusammengetrommelt, um diverse Umstrukturierungen zu verkünden. Für das Meeting war Livia zwei Tage zuvor eigens aus Rom angereist, wo sie das Außenbüro der Times leitete. Nachdem das Treffen zu Ende gegangen war, hatte sie sich einer Gruppe Kollegen angeschlossen, um den Tag mit einem Feierabendbier abzuschließen. Oder auch zwei.
Bill Kortz, der das berühmte Kreuzworträtsel der Times gestaltete, prostete Livia zu. „Dein Italienisch ist verflucht gut“, sagte er. „Ich habe vor Jahren einen Kurs belegt. Kann mich aber nur an mille grazie erinnern.“
Dan Fernandez, ein Reporter aus dem Hauptstadtbüro in Washington, mischte sich ein: „Mit meinem Spanisch kann ich immerhin Bruchstücke verstehen.“
Vom Italienertisch kam erneut Jubel.
„Wow, 66 : 70. Das können die Italiener noch schaffen. Oder bist du für die Chinesen, Livia?“, fragte Jeff Glockner, ein Investigativreporter, der bereits das dritte Bier leerte.
„Sie wartet ab, wer gewinnt“, witzelte Blumenstein.
„Halb Italienerin, halb Chinesin, ein Traum“, sagte Glockner.
Livia lächelte ihre Kollegen an. „Habt ihr vergessen, dass ich Amerikanerin bin?“
„Na klar, so gut, wie du Italienisch sprichst!“, rief Fernandez. Er lachte über seinen albernen Scherz.
„Achtung, Leute …“ Jack Westinghouse, ein Technikredakteur, deutete mit gestrecktem Arm auf den Flachbildschirm über dem Bartresen.
Die Squadra Azzurra passte den Ball mit beeindruckender Geschwindigkeit um die Dreipunktelinie. Gilberto Tomba, Italiens Center, lancierte vom rechten Corner einen überraschend hohen Wurf und traf präzise. Der Ball berührte nicht mal das Metall der Netzhalterung, sondern donnerte mit Wucht hindurch. Drei Punkte. Nun stand es 69 : 70. Noch führten die Chinesen, aber am Italienertisch ging es zu, als wäre die Partie schon gewonnen.
„Na ja, irgendwie bist du keine typische Amerikanerin“, brummte Glockner, der überaus charmant sein konnte, wenn er nicht gerade das vierte Bier bestellte.
„Wie sind denn Amerikanerinnen?“, fragte Livia.
Fernandez kam ihr zu Hilfe. „Na ja, groß, blond, dicke Titten, aufgespritzte Lippen. Glockners Typ eben …“
„Fick dich“, zischte Glockner.
Livia lachte. „Das mit den Lippen überlege ich mir noch.“
„Bloß nicht!“, rief Blumenstein. „Nur schade, dass du dich an diesen weltfremden Physiker verschenkst.“
„Hey, das ist meine Sache. Nicola ist ein wundervoller Mann.“
„Nur, dass du ihn kaum je zu sehen bekommst, weil er ständig in seinem Teilchenlabor unter der Erde steckt.“
Livia blickte auf ihr Bierglas. „Er ist es wert.“
„Geschmack hat er auf jeden Fall“, sagte Kortz, der Kreuzworträtselmann.
„Danke, Will, aber sprachen wir vorhin nicht über Compliance-Regeln?“
„Man darf keine Komplimente mehr machen?“ Glockners Zunge wurde minütlich schwerer.
„Jetzt ist gut, ihr Möchtegernmachos“, ging Blumenstein dazwischen.
Die Männer lachten und prosteten sich zu.
Livia musste schlucken. Sie dachte an Nicola. Vor drei Wochen hatte sie ihn zuletzt gesehen. Es war ein romantisches Wochenende gewesen, in Chioggia, der kleinen Schwester Venedigs. Sie hatte es genossen, aber mit düsterem Gewissen. Sie hätte es Nicola damals schon erzählen müssen. Die Sache mit Gigi. Mit Giancarlo Idda, einem Redakteur von La Stampa. Sie spürte ein ungutes Stechen im Bauch.
Seit dem Ausrutscher hatte sie pausenlos gearbeitet und weder an Nicola noch an Gigi gedacht. Sie war froh gewesen über dieses Meeting in New York. Eine willkommene Ablenkung. Auch wenn sie morgen wieder im Flugzeug nach Rom sitzen würde. Zurück in ihr Leben. Vor Entscheidungen gestellt.
Seit mehr als einem Jahr war sie inzwischen Korrespondentin der New York Times in Rom. Den Job hatte sie sich aussuchen können, nachdem sie den Pulitzerpreis gewonnen hatte. Die Auszeichnung hatte sie für eine Reportage im New York Times Magazine erhalten. Darin hatte sie den Verbleib des vor achtzig Jahren auf mysteriöse Weise verschwundenen Physikers Ettore Majorana aufgeklärt. Die Recherche und der achtzehn Seiten lange Bericht hatten ihr neben Ruhm und Ehre auch einen Buchvertrag mit vierhunderttausend Dollar Vorschuss eingebracht. Das Buch mit dem Titel Peacock House war vor einigen Monaten erschienen und sofort ein Bestseller geworden, auch in Italien. Der verschwundene Physiker, ein gebürtiger Sizilianer, war in seinem Heimatland seit Jahrzehnten eine Legende. Es war der berühmteste Vermisstenfall Italiens. Livia hatte jedoch keine Sekunde lang daran gedacht, sich auf diesem Erfolg auszuruhen, sondern sich in ihre Arbeit als Korrespondentin gestürzt.
Für den Ortswechsel hatte es einen weiteren Grund gegeben. Während der Recherche zu der Majorana-Geschichte hatte sie sich in Nicola Caneddu verliebt, einen Wissenschaftler, der in einem unterirdischen Labor in Mittelitalien Elementarteilchen erforschte. Sein Arbeitsplatz war nur zwei Autostunden von Rom entfernt. Doch die teils wochenlangen Experimente unter dem zweitausend Meter hohen Granitberg nahmen den Physiker voll in Beschlag. Für Livia fühlte es sich zunehmend an, als wäre sie mit einem Astronauten liiert.
Dabei hatte Nicola in den vergangenen Wochen mit seiner liebevollen Art das Thema Kinder ins Gespräch gebracht. Doch wie sollte das gehen, fragte sich Livia. Sie hatten beide mörderisch zeitaufwendige Jobs. Wann und wie wäre da Zeit für eine Familie?
Sie hatte sich mehr denn je in ihre Arbeit vertieft. Die Regierungskoalition Italiens war zum zweiten Mal in zwölf Monaten zerbrochen. Als erste ausländische Journalistin hatte Livia in Erfahrung gebracht, wer neuer Ministerpräsident werden würde, und ein langes Interview mit dem Sozialisten in ihrer Zeitung veröffentlicht. Wenn sie tief in ihrer Arbeit steckte, musste sie sich nicht den Kopf zerbrechen, ob sie mit Nicola eine Familie gründen wollte. Oder mit Gigi ein neues Abenteuer beginnen. Oder nichts davon.
Das Gebrüll der Italiener am Nebentisch holte sie zurück in die Realität. Die Chinesen hatten einen Zweipunktewurf geschafft und führten wieder mit drei Punkten Abstand.
„Basketball kommt für dich eher nicht infrage, oder, Livia? Mit deinen Einswieviel?“, fragte Fernandez.
„Einszweiundsechzig.“
„Eher Bodenturnen. Oder Pferderennen“, sagte Glockner. Seine Witze wurden nicht besser.
„Mugsy Bogues!“, rief Livia.
„Wie bitte?“
„Gutes Beispiel“, sagte Bill Pennington, ein Sportkolumnist. „Mugsy Bogues war von 1987 bis 2003 Stammspieler der amerikanischen NBA. Und nur eins sechzig groß.“
„Zwei Zentimeter kleiner als ich“, betonte Livia.
Ihre Kollegen blickten erstaunt.
„Im Ernst? An den kann ich mich gar nicht erinnern“, sagte Fernandez. „Sein Trick war vermutlich, durch die Beine der Gegner zu schlüpfen.“
„Die Charlotte Hornets und die Dallas Mavericks liebten ihn. Er hat im Laufe seiner Karriere mehr als zwanzig Millionen Dollar Gehalt kassiert. Plus Werbeeinnahmen“, erklärte Livia.
„Irre.“
„Aber du hast schon recht“, sagte sie, „mein Sport ist eher Karate. Wollt ihr eine Lektion?“
Alle lachten.
Was ihre Kollegen nicht wussten: Livias Selbstverteidigungskünste waren tatsächlich ausgezeichnet. Allerdings war nicht Karate ihre Disziplin, sondern der jahrhundertealte vietnamesische Kampfsport Viet Vo Dao. Aber das gehörte zu den Geheimnissen, die sie niemandem erzählte. So wie das noch größere Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter.
Die große Lüge.
Livia liebte ihren Job in Rom. Anders als viele dort arbeitende Ausländer mied sie Botschaftspartys und Irish Pubs, wo sich das internationale Publikum traf – die Diplomaten, Lehrer und Journalisten. Livia hielt sich an ihre einheimischen Kollegen. Sie mochte die Italiener, ihre Lebensfreude, ihren Humor. Dank einiger Freundschaften, die sie geschlossen hatte, war sie deutlich besser informiert als andere ausländische Korrespondenten. Die Italiener schätzten Livia ebenso, was nicht nur an ihrem umwerfenden Lächeln, ihren haselnussbraunen Augen und dem kräftigen, dunklen, schulterlangen Haar lag. Livia hatte viel Mühe darauf verwendet, im Rekordtempo Italienisch zu lernen. Und wenn sie zum Abendessen einlud, entzückte sie ihre Gäste mit einem butterzarten Ossobuco.
Noch immer stand es 69 : 72. Das italienische Basketballteam setzte zu einem Rebound an. Wenn ihnen ein Dreipunktewurf gelang, würden sie gleichziehen. Tomba, der italienische Center, schnappte sich den Ball mit einem rekordverdächtigen Sprung, wirbelte einmal um die eigene Achse und brachte sich mit leichter Rückenlage in Stellung für einen Weitwurf. Er hob den Ball, der in einer perfekten Parabel auf das Netz zuflog. Die Italiener sprangen von ihren Sitzen und brüllten aus vollem Leib.
Das Fernsehbild wechselte.
Statt des Basketballcourts sah man Rauchschwaden, Feuerwehrmänner, Wrackteile, zerstörte Einfamilienhäuser, aufgerissenes Erdreich und ein alles überragendes blaues Seitenleitwerk mit dem Logo der Delta Airlines.
Am unteren Bildschirmrand informierte eine Laufschrift über die Flugzeugkatastrophe bei Atlanta. Hundertneununddreißig Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder waren an Bord der Boeing 737 gewesen und vermutlich tot. Auch unter den Einwohnern eines Ortes namens Newnan, vierzig Kilometer südlich von Atlanta, war mit Opfern zu rechnen.
Es wurde schlagartig still in der Bar. Lediglich die italienischen Touristen stießen ein paar Flüche aus. Drei von Livias Kollegen zogen ihre Smartphones hervor und legten sie in die Mitte des Tischs.
„Sechzig Sekunden“, sagte Blumenstein und zeigte auf ihr Handy.
„Niemals.“ Glockner deutete auf Fernandez. „Diesmal trifft es ihn.“
Livia kannte das Ritual. Wer als Erster vom diensthabenden Nachrichtenchef in die Redaktion gerufen wurde, musste die Zeche für alle bezahlen.
Nach dreißig Sekunden klingelte das erste Handy.
Aber es war keins von denen auf dem Tresen. Es steckte in Livias Hosentasche. Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte sie ihre Kollegen an, hob die Schultern und zog das Telefon hervor. Es war Thomas Bell, der Chefredakteur der New York Times. Sie ging ran.
„Tom, dein Anruf kostet mich jetzt um die zwanzig Biere, acht Cheeseburger und …“
„Ich habe gerade keine Lust auf Scherze, Livia. Es sind vermutlich mehr als hundertfünfzig Menschen tot.“
„Ich hab’s gesehen, Tom. Grauenhaft. Aber deshalb rufst du wohl kaum deine Italienkorrespondentin an.“
„Doch, Livia. Genau deshalb rufe ich dich an. Ich möchte, dass du dieses Unglück coverst.“
„Wie bitte? Hast du mitbekommen, dass die Maschine in Atlanta abgestürzt ist und nicht in den Abruzzen?“
„Ich will, dass du das übernimmst. Du fliegst morgen mit der ersten Maschine nach Atlanta. Kurz nach fünf von La Guardia. Das Ticket schickt dir Nancy auf dein Telefon.“
„Wozu betreibt die New York Times ein Außenbüro in Atlanta? Fausset ist ein guter Mann. Er könnte heute Abend noch … “
„Kann er nicht. Er ist im Urlaub auf Hawaii.“
„Was ist mit Gambetta aus Houston oder Rojas aus Miami?“
„Ich bin alles durchgegangen. Gambetta wäre verfügbar, aber er ist politischer Analyst, kein besonders guter Reporter. Rojas ist krank. Ich konnte einen Volontär in Atlanta auftreiben, der uns ein paar nachrichtliche Meldungen schreibt. Aber ich will noch jemanden in Georgia haben. Eine Vollblutreporterin wie dich. Ich halte es für möglich, dass es eine spannende Hintergrundstory gibt. Hast du gehört, woher die Maschine kam?“
„Nein, woher?“
„Aus Honduras. Vielleicht gibt es einen kriminellen Hintergrund. Ein Drogending. Was Politisches. Oder ein Einwandererdrama.“
„Mein Flug zurück nach Rom geht morgen.“
„In bella Italia verpasst du gerade nichts, ich brauche dich in Georgia. Morgen früh. Bitte, Livia.“
Sie seufzte und blickte ihre Kollegen mit heruntergezogenen Mundwinkeln an. Sie unternahm einen letzten Versuch, ihren Chef von der Idee abzubringen.
„Das Untersuchungsteam des NTSB ist garantiert schon unterwegs zur Unfallstelle. Lass jemanden in deren Zentrale recherchieren. Das bringt vermutlich mehr, als sich als Zaungast an der Absturzstelle herumzutreiben.“
„Das National Transportation Safety Board ist eine verdammte Bundesbehörde voller Techniknerds. Die tauchen frühestens morgen an der Unfallstelle auf und gehen erst rein, wenn die Leichen weg sind. Und es gibt viele Leichen. Nicht nur Passagiere, auch Bewohner am Boden. Danach werden sie monatelang mit Schrottteilen herumpuzzeln, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Also spielt die Musik jetzt in Atlanta. Oder wie das Kaff weiter südlich heißt, wo die Maschine abgestürzt ist. Wir haben dich auf den Direktflug gebucht, Businessclass, und vor Ort einen Fahrer besorgt. Das klingt doch gut, oder?“
„Es gibt auch First Class …“
„Dir ist wohl der Pulitzer zu Kopf gestiegen.“
„War nicht ernst gemeint.“
Mit dem Telefon am Ohr winkte Livia den Barmann herbei und drückte ihm ihre Kreditkarte in die Hand. Er solle die Zeche des gesamten Tisches abbuchen. Und sie bat ihn, ein Taxi zu rufen.
„Okay, Tom, ich schlafe drei, vier Stunden, nehme ein paar Sachen aus der Wohnung mit und fliege morgen früh nach Atlanta.“
„Du bist ein Schatz.“
„Eine Sache nur, Tom.“
„Was?“
„Ich mache das auf meine Weise.“
„Warum habe ich mir das fast schon gedacht?“
„Meine Regeln, Tom. Keine Kompromisse.“
„Okay, Livia. Solange ich nicht in der Post zuerst lese, warum dieser Flieger runtergekommen ist.“ Er legte auf.
Livia erklärte ihren erstaunten Kollegen, was los war. Dass sie nach Atlanta aufbrechen musste, wegen des Unglücks. In Fernandez’ Gesicht war Enttäuschung zu lesen. Vermutlich hätte er den Job gerne übernommen. Livia blickte ihn an.
„Ich hätte dir das gerne überlassen. Aber du kennst den Chef – wenn er was will, müssen wir nicht diskutieren.“
3
Hafengelände, La Ceiba, Honduras
Das Dunkel der Nacht verbarg, wie furchterregend die Männer aussahen. Der größere, der aufrecht stand, hatte ein aufgerissenes Haifischmaul quer über die untere Gesichtshälfte tätowiert. Auf der Stirn prangten die Buchstaben „M“ und „S“ in Frakturschrift. Sie standen für „Mara Salvatrucha“, der Name der brutalsten Bande Zentralamerikas. Unter dem linken Auge waren acht dunkelblaue Tränen verewigt. So viele Menschen hatte Tiburón, wie sie ihn ehrfürchtig nannten, angeblich ermordet. Einem Schläger der verfeindeten Barrio-18-Gang hatte er angeblich die Kehle mit einer Machete aufgeschlitzt. Aber das war nur ein Gerücht.
„Hat sich einer der verhurten Achtzehner blicken lassen?“
„Alles ruhig, jefe.“
Der kleinere, dickere Mann hatte weniger Tätowierungen im Gesicht. Dafür war das Wort „MARA“ auf seine Finger buchstabiert, und eine riesige „13“ zierte seine Brust. Er fläzte auf einem Schemel an einer Hauswand auf der Zugangsstraße zum Hafen der honduranischen Küstenstadt La Ceiba. Im Osten war das Schimmern zweier Laternenmasten zu sehen. Sie beleuchteten die Brachfläche im Hafen. Nach Westen hin lag die Zufahrtsstraße im Dunkel.
„Halt bloß die Augen auf, Pippo. Wenn einer von den pendejos seinen Fuß in die Calle setzt, gibt es keine Gnade. Du ballerst sie weg. Wir sind sofort bei dir.“
„Keine Sorge, Tiburón, ich hab alles im Griff.“
„Munition?“
„Null-null-Schrot. Vier Schachteln.“
„Okay, das wird den Ärschen einheizen. Ich bin dann mal mit Gordo und Jesús bei Mama Juanita.“
„Klar, jefe. Trink einen plata für mich mit. Und steck ihn einmal für mich rein.“
Tiburón zeigte seine Zähne. Ein Dutzend von ihnen war mit Gold überzogen. „Hab Geduld, Pippo. Noch ein, zwei Jahre, und du bist auch ein jefe. Die Mara vergisst ihre Treuen nicht.“
„Alles klar, jefe, ich regle das hier. Wie letzte Nacht. Und die Nächte davor.“
„Okay. Aber nicht sinnlos herumballern. Das weckt nur die federales.“
„Está bien.“
Tiburón verschwand in eine Seitengasse. Pippo richtete seine Augen ins Dunkel. Eine geladene Remington 870 stand griffbereit an die Hauswand gelehnt. Mit Dunkelheit kam er gut klar, aber der vor ihm liegende Straßenabschnitt war nicht nur dunkel. Er war schwarz wie ein Kohlebergwerk. Pippo malte sich aus, auf welchem Weg die hijos de puta von der Barrio-18-Gang wohl kommen könnten.
Sie würden es vielleicht über die Dächer probieren. Vielleicht aber auch nicht, denn das Blech auf den Häusern machte verdammt viel Lärm. Außerdem würden sie ihn von oben schlecht sehen können. Vielleicht hatten sie aber auch Nachtsichtgeräte und Präzisionsgewehre. Schon oft hatte er Tiburón gebeten, solche Sachen anzuschaffen, das Zeug aus den Kriegsfilmen. Die Barrios würden jedenfalls nicht planlos angreifen, so viel war sicher. Sie wussten, dass die Mara 13 die Zugänge zum Hafen bewachte. Der Hafen, ihre wichtigste Geldquelle. Das Herz des Mara-Territoriums.
Pippo hatte Sehnsucht nach einer Zigarette. Aber die Glut würde ihn verraten. Ein Schluck Rum wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber das hatte Tiburón strikt verboten. Und Pippo wollte es nicht versauen. Ohne die Mara war sein Leben wertlos. Seit er vierzehn war, hatte er sich dem vida loca verschrieben. Dem hemmungslosen, brutalen Leben als Gangster.
La Mara para siempre.
Nach einer Stunde stand Pippo vorsichtig auf, um sein eingeschlafenes Bein zu schütteln.
Ein leises Knattern ließ ihn herumfahren. Eine Uzi, war sein erster Gedanke. Eine vollautomatische Maschinenpistole. Schoss da jemand im Hafen herum? Doch das Knattern hielt an. Eine Uzi konnte es daher nicht sein. Die hatte ihr 50-Schuss-Magazin nach zwei Sekunden verballert. Dieses Knattern hörte nicht auf. Es wurde langsam lauter. Es war ein gottverdammter Diesel. Ein Schiffsdiesel. Das Geräusch kam vom Wasser her.
Pippo blickte mit zusammengekniffenen Augen in Richtung Mole. Hatte Tiburón nicht gesagt, die Ladung aus Kolumbien komme erst morgen? Was, wenn es doch die Kolumbianer waren? Wenn sie schon heute kamen, und niemand empfing sie im Hafen? Er sollte Tiburón anrufen. Aber sein Smartphone konnte er unmöglich benutzen. Es leuchtete heller als jede Zigarette. Ein Scharfschütze von den Barrios, und er hätte sofort eine Kugel im Kopf.
Vielleicht sollte er den Posten verlassen und im Hafen nachsehen. Nur kurz. Als das Knattern deutlich zu hören war, nahm Pippo die Remington zur Hand und schlich an der Hauswand entlang in Richtung Mole. Was soll’s, dachte er, die Barrios hatten sich seit Wochen nicht blicken lassen. Es wäre schon okay, wenn er kurz im Hafen nach dem Rechten sah. Falls es die Kolumbianer waren, würde man ihn dafür loben, die cabrones aus Cartagena mit ihrem coca in Empfang genommen zu haben.
Pippo überquerte die Brachfläche vor der Hafenmole und sah das Boot. Tiburón hatte gesagt, die Kolumbianer würden mit einem dieser selbst gebauten U-Boote auftauchen. Aber das hier war kein U-Boot. Es war ein kleiner Fischtrawler mit buntem Holzrumpf.
Ohne Positionslichter tuckerte das Fischerboot quer durch das Hafenbecken und krachte ungebremst auf die Mole. Der Bug knirschte, während der Dieselmotor das Boot unnachgiebig gegen den Beton presste. Das war eine unerwartete Situation. Vielleicht eine Finte der Barrios? Pippo versteckte sich hinter einem rostigen Container und versuchte zu erkennen, wer dieses Boot steuerte.
Nach einigen Minuten nahm seine Neugier überhand. Er rannte an die Kante der Mole und sprang beherzt auf den Bug des Trawlers. Mit der Remington im Anschlag warf er sich hinter ein Bündel zusammengelegter Fischernetze. Dort blieb er einige Sekunden lang in Deckung. Als sich noch immer nichts tat, tastete er sich an der Kajüte vorbei in Richtung Heck, die Waffe im Anschlag.
»¡Colombianos! ¡Bienvenidos compadres!«, rief Pippo, auch, um sich selbst Mut zu machen.
Nichts regte sich. Pippo öffnete die Tür zum Steuerstand und setzte ein Bein in die Kajüte, als er vom Heck ein hölzernes Klappern vernahm. Es war der Deckel eines Stauraums. Doch Pippo kam nicht mehr dazu, sich umzudrehen. Etwas Weiches schlang sich um seinen Hals und drückte mit übermenschlicher Kraft zu. Aus der Remington löste sich ein Schuss. Die Schrotkugeln krachten in die Kajüte und zerfetzten den Steuerstand.
Eine Anakonda, war Pippos letzter Gedanke. Er hörte das Knacken seines Genicks. Und dann nichts mehr.
Wie bist du auf die Idee zu Cortex gekommen?
Als Journalist bekam ich im Labor eines Max-Planck-Instituts eine Petrischale in die Hand gedrückt. Darin sah ich kleine, fleischfarbene Knödel auf einer Nährlösung. In der Sekunde, als die Forscherin mir sagte, was das war, wusste ich: Das war der Stoff für meinen nächsten Thriller. Es waren Miniatur-Gehirne, gezüchtet aus menschlichen Stammzellen.
Hattest du in diesem Moment eine Frankenstein-Assoziation?
Allerdings.
Wie bist du vom Journalismus zur Belletristik gekommen?
Je länger ich sachlich und faktisch über Wissenschaft berichtet habe, desto stärker wuchs in mir der Wunsch, auch in die Fiktion auszubrechen. Es fühlte sich an wie die Sehnsucht, an einen fernen, exotischen Ort zu reisen. Wie die Lust auf einen schönen Traum. Fiktionales Schreiben ist wie Tagträumen.
Du hast neben Physik auch Theaterwissenschaft studiert, sind das zwei Seelen in einer Brust oder sind das Bereiche, die sich gegenseitig beflügeln?
In Filmen und Theaterstücken sind Physiker ja oft grotesk überzeichnete Charaktere. Hilflose Nerds, siehe Dürrenmatt. Und es gibt sie tatsächlich. Gleichzeitig gibt es auch Menschen, bei denen sich die Neigungen zu Mathematik, Musik und Sprache nicht gegenseitig ausschließen. Wobei ich zugeben muss, dass es bei mir mit der Musik nichts geworden ist.
Cortex spielt an vielen ungewöhnlichen Schauplätzen, was hat es mit diesen auf sich?
Ich hatte das Glück, von Kind auf viele hochspannende Orte kennenzulernen. Das habe ich als Student fortgesetzt. Später kam ich beruflich herum, besuchte Universitäten in Indien und Iran, das Atomkraftwerk von Tschernobyl oder den höchsten Staudamm der Welt in den Bergen Sichuans in China. Ich verrate jetzt mal nicht, welche dieser Orte in Cortex auftauchen.
Cortex ist ein sehr komplexer Thriller mit unterschiedlichen Handlungssträngen, die am Ende auf meisterhafte Weise zusammengeführt werden. Wie gehst du beim Schreiben vor?
Puh, vielen Dank für das Lob. Tatsächlich durchlaufe ich immer wieder Phasen tiefer Selbstzweifel. Jedenfalls habe ich mich für Cortex gezwungen, den Plot einigermaßen zu strukturieren, bevor ich mit dem eigentlichen Schreiben begann. Das lässt sich allerdings nur bis zu einem gewissen Grad durchhalten. Beim Schreiben kommen viele Ideen hinzu, die auf Seitenwege führen oder den geplanten Plot durchkreuzen, und man muss die Stränge neu flechten.
In Cortex spielt moderne Biotechnik eine große Rolle, wie hast du hierzu recherchiert?
Die vorhin genannten Mini-Gehirne sind Teil eines erstaunlichen, von der Öffentlichkeit noch zu wenig beachteten Forschungsgebiets. Als Wissenschaftsjournalist hatte ich Zugang zu wissenschaftlichem Material wie auch zu Expertinnen und Experten. Auch konnte ich über die Jahre viel von SZ-Kolleginnen und Kollegen lernen, die selbst Biochemie und Medizin studiert hatten.
Wie realistisch ist das Szenario aus Cortex?
Das Genre, in dem sich Cortex bewegt, ist nicht Science Fiction. Es geht also nicht um eine komplett erfundene Welt, oder um eine Geschichte, die in ferner Zukunft spielt. Cortex spielt im hier und heute, und die beschriebene Forschung ist real, auch wenn, klar, in einem Thriller ein bisschen überspitzt wird. Michael Crichton war der Großmeister dieses Genres. Die Forschung aus „Jurassic Park“ war realistisch, auch wenn das Ausbrüten von Dinosauriern letztlich noch nicht funktioniert. Andererseits bringt die Wissenschaft immer wieder Dinge hervor, die niemand für möglich gehalten hätte. Kürzlich wurde einem Mann ein Schweineherz implantiert. Und ethische Grenzen werden früher oder später überschritten. Insofern: Wer weiß, vielleicht wird das Szenario in Cortex eines Tages von der Wirklichkeit überholt.
In Cortex steht eine starke Frauenfigur, die Journalistin Livia, im Mittelpunkt: Sie recherchiert zu einem Flugzeugabsturz und kommt dabei einem ungeheuerlichen Komplott auf die Spur. Warum hast du dich für eine weibliche Heldin entschieden?
Mit meiner Frau und meinen beiden inzwischen erwachsenen Töchtern bin ich von drei wunderbaren, starken Menschen umgeben. Ich spüre jeden Tag, dass Frauen wie sie die James Bonds, Philip Marlowes und Jack Reachers der Zukunft sein werden. Das ist kein anbiedernder Feminismus, sondern schlichte Realität. Livia ist unerschrocken und mutig. Ihre Neugier bringt sie aber auch in Teufels Küche. Und wie Livia als Journalistin tickt, das kenne ich – ganz genderneutral – aus meinem eigenen Berufsleben.
„Gründlich recherchierter Wissenschaftsthriller über Menschenversuche auf Frankensteins Spuren.“
„Ein spannender Thriller“
„Der Thriller ist handwerklich gut gemacht, mit profunder Recherche und vielen verschiedenen Handlungssträngen, die sich ineinander verzahnen.“
„Wer sich auf diesen turbulenten Wissenschaftsthriller einlässt, der wird von der ersten bis zur letzten Seite gut unterhalten und nebenbei auch ein bisschen klüger.“
„Patrick Illinger verknüpft Aspekte moderner Biotechnik mit einem fesselnden Plot.“
„Genial recherchiert, man merkt, dass Illinger, ehemals Wissenschaftler am Forschungszentrum CERN, vom Fach ist. Trotz des ›schwierigen‹ Themas leicht und verständlich lesbar. Top!“
„Man glaubt es kaum, aber ganz so abwegig sind die Gedanken des Autors keinesfalls. Kein Wunder, da er perfekt recherchiert und eigentlich vom Fach kommt (…). Ein hervorragendes Lesevergnügen.“
„Actionreicher Gentechnik-Thriller.“
„Wow wow wow. Was für ein Thriller. ›Cortex‹ hat sich für mich als ein weiteres Highlight entpuppt und war eine echte Überraschung“
„Packende Atmosphäre.“
„Seine Sprache ist präzise, schnörkellos, die Handlung springt im Minutentakt über den Globus.“
„Mit rasanten Actionszenen, einer taffen Protagonistin und weiteren auffälligen Akteuren schmiedet er einen nachdenklich stimmenden Plot.“
„Relevantes Thema, das wirklich gesellschaftlichen Sprengstoff birgt.“
„Unbedingte Leseempfehlung: Hier finden gut recherchierte Wissenschaft, raffinierte Spannung und gekonntes Erzählen hervorragend zusammen.“
„Eine modernisierte Version von Mary Shellys Frankenstein - wissenschaftlich unmoralisch, aber denkbar.“

















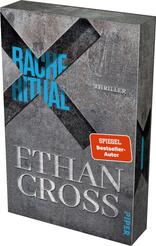











DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.