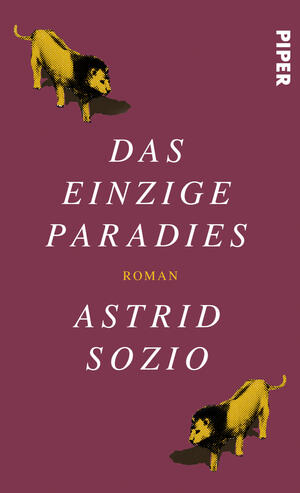
Das einzige Paradies - eBook-Ausgabe
Roman
„Wie Astrid Sozio den Verfall von Haus und Bewohnerin und die zögerliche Annäherung der beiden Frauen begleitet, ist im besten Sinne schauderhaft. Nämlich rau, kompromisslos und eindrücklich“ - Brigitte
Das einzige Paradies — Inhalt
Ein Leben im Hotel: so viele Zimmer, so viele Erinnerungen. Frieda Troost hat im „Zum Löwen“ jahrzehntelang als Zimmermädchen gearbeitet, jetzt liegt das Haus im Randgebiet eines sterbenden Ruhrpott-Orts verlassen da und Frieda wird nicht mehr gebraucht. Aber wo sollte sie hin – ohne Familie, ohne Heimat und scheinbar umzingelt von der Bedrohung des Fremden: „Ölaugen“, „Zigeuner“, „Kroppzeug“, das sind die Wörter, die Frieda für die Bewohner des Asylbewerberheims um die Ecke findet; falsche Wörter, aber Frieda kennt keine anderen. Sie folgt ihren in den Zimmern abgelegten Erinnerungen durch das Haus, spricht dabei mit sich selbst und ihrer verstorbenen Tante. Bis sich eines Tages Nasifa, eine junge Frau aus Ghana, in ihrem Hotel „einnistet“…
Leseprobe zu „Das einzige Paradies“
1
Die Nächte waren das Einzige. Alles andere machte mir nichts. Vierzehn Zimmer allein, das war Knochenarbeit. Aber Knochenarbeit hab ich mein Leben lang geleistet.
Früher wars die Hütte. Das Hochofenfeuer hat die ganze Nacht lang die Stadt beleuchtet. Als es dann aus war, wurd es trotzdem nicht dunkel, weil sie das nutzlose Ding mit bunten Lichtern anstrahlten, als wärs der Eiffelturm. Erholungspark nennen sie das. Für mich wärs erholsamer gewesen, wenn die Nacht mal wieder schwarz geworden wär und ich mehr als ein Schnapsglas Schlaf bekommen hätte. Ich [...]
1
Die Nächte waren das Einzige. Alles andere machte mir nichts. Vierzehn Zimmer allein, das war Knochenarbeit. Aber Knochenarbeit hab ich mein Leben lang geleistet.
Früher wars die Hütte. Das Hochofenfeuer hat die ganze Nacht lang die Stadt beleuchtet. Als es dann aus war, wurd es trotzdem nicht dunkel, weil sie das nutzlose Ding mit bunten Lichtern anstrahlten, als wärs der Eiffelturm. Erholungspark nennen sie das. Für mich wärs erholsamer gewesen, wenn die Nacht mal wieder schwarz geworden wär und ich mehr als ein Schnapsglas Schlaf bekommen hätte. Ich hatte jeden Tag vierzehn Zimmer zu machen, es konnte schließlich jederzeit jemand kommen, und das merkt man einem Zimmer an, wenns nicht jeden Tag gemacht wird.
Ich hab nie viel von irgendwas gebraucht. Mit einer Tasse Kaffee kam ich bis zum Abend aus, bisschen Zucker drin oder ein Schluck Eierlikör, das reichte. Meine Mutter und ich haben ganze Winter mit einem einzigen Sack Kartoffeln überlebt. Eine Kartoffel am Tag und wenns wärmer wurde ein Klacks Löwenzahngemüse dazu.
Ich hab auch nie dran gedacht, Tante Gertrud die Wurst vom Brot zu mopsen. Mir fehlte nichts. Außer Schlaf. Schlaf war das Einzige, von dem ich viel brauchte. So viel, dass Tante Gertrud mich oft an den Haaren aus dem Bett ziehen musste.
Dann war ich plötzlich allein und hätte so lange schlafen können, wie ich wollte – und war wach. Jede Nacht.
Lag wach, fror bitterlich und wünschte mir, dass die Nacht endlich vorbeiging. Dass sich draußen wieder was bewegte. Und wenns ein Zigeuner gewesen wär.
Aber das ist eine Geisterstadt nachts, vor allem im Winter. Ehrlich gesagt, im Sommer ist es auch nicht besser. Auch tags nicht. Das war ganz schnell gegangen, nachdem sie die Flüchtlinge in die alte Berufsschule gesetzt hatten. Erst verschwanden die Leute von den Straßen, dann wurden die Schaufenster vernagelt. Gertrud hatte grad das neue Leuchtschild anbringen lassen. Hotel Zum Löwen, mit einem Löwenkopf oben, und drunter stand „Zimmer frei“, das konnte man anschalten. Keine drei Tage hat das geblinkt, da hatten sie es uns eingeschmissen.
Im Kino versuchten sie es noch eine Zeit mit Schmuddelfilmen, aber das lockte auch keinen mehr. War ja keiner mehr da. Außer uns, aber das schien niemand zu wissen. Wie auch, ohne Leuchtschild. Da hat auch der Glaspalast nicht geholfen, den sie am alten Bahnhof hingesetzt haben, wo kein Wunsch offenbleibt, wie das auf den Plakaten hieß. Von denen, die da einkauften, kam keiner bis zu uns rauf. Es war, als hätte man die Stadt hinterm Bahnhof abgebunden wie ein zerschossenes Bein. Das Einzige, was durchsickerte war Kroppzeug. Zigeuner, Kopftuchfrauen, Ölaugen. Aber in den kalten Nächten blieben auch die lieber in ihren Löchern.
Nur Gertrud krabbelte noch unterm Lichtkegel der Straßenlaterne herum, tastete nach dem Pfahl und zog sich daran wieder auf die Beine, wurde länger und länger und dünner, wie ein Schatten, wenn die Sonne untergeht, und schaute zu mir rein. Ihr Gesicht war schwarz wie lackiert, die Augen blendend weiß darin.
Das war nicht Gertrud, das war die Negerin. Wieder die Negerin.
Das konnte nicht sein. Mein Zimmer lag im ersten Stock, da konnte niemand durchs Fenster reinsehen. Und nachts kam die Negerin nie, da hatte ich oft genug nachgeschaut.
War ich also doch eingeschlafen.
Endlich, dachte ich und war wieder hellwach. Und blieb es.
Das war nicht nur das Licht und die Kälte. Da war was. Ich stand auf und sah nach, aber unter der Laterne war niemand.
Selbst die Negerin schlief also. Ich zog den Vorhang wieder zu, aber nicht ganz. Wenn ich schon mal wach war, konnte ich auch stehen bleiben und warten, bis sie kam.
Ich hatte sie noch nie kommen sehen. Und auch nicht gehen. Sie war immer einfach da, sobald es hell war, und wieder weg, wenns dunkel wurde. Also wartete ich. Blies mir in die hohlen Hände und legte sie über meine Ohren. Ich war zwar an die Kälte gewöhnt, aber meine Ohren sind empfindlich.
Irgendwann schliefen mir die Beine ein. Da musste ich vorsichtig sein, die knickten leicht weg, wenn sie so kribbelten. Ich ging zurück ins Bett. Was hatte ich davon, zu sehen, wie sie kam? Zu mir rein konnte sie nicht. Unser Löwe ist eine Burg. Das Kribbeln in den Beinen ließ nach. Schlafen konnte ich trotzdem nicht.
Die Dämmerung kommt nicht mit der Sonne von unten, sie fängt oben an, ein bleiches Schimmern in der Mitte des Himmels, das sich langsam verteilt, wie Seife in Badewasser. Wenn alles milchig war, stand ich auf. Seit die Batterien in meiner Uhr den Geist aufgegeben hatten, musste ich mir mit solchen Himmelszeichen behelfen.
Aufstehen wär eine Erlösung, wenns nicht so kompliziert wär. Jeden Morgen dachte ich mir, lass es bleiben, aber ich hatte die vierzehn Zimmer. Außerdem saß ich schon beinah, so viele Kissen hatte ich hinter mich gestopft. Ich hab nie gut liegen können wegen meinem Rundrücken. So hat es mal ein Oberarzt genannt, der unser Gast war.
Ja, wir hatten Ärzte im Löwen, oft sogar. Und Studienräte. Überhaupt viele gehobene Leute.
Immer gerade halten, hatte der Oberarzt gesagt, dann werden Sie auch wieder gerade, Fräulein. Tante Gertrud lachte mich aus: Rundrücken? Das ist ’nen Buckel. Da kannste deinen Busen noch so rausstrecken, der bleibt. Sie hat recht behalten.
Kalt wars. Ich musste mir lang in die Hände atmen, bis ich meine Finger bewegen konnte. Ich schob meine Füße aus dem Bett und stemmte mich hoch.
Stand ich erst mal, ging es. Ich tauschte das Nachthemd gegen Bluse und Putzkittel. Das war wichtig. Wer tagsüber Schlafsachen trägt, der wartet nur darauf, für immer zu schlafen.
Ich holte meinen Schlüsselbund unter dem Kissenberg hervor und steckte ihn in die Kitteltasche. Bevor ich ins Bad ging, warf ich einen Blick aus dem Fenster und erschrak.
Da stand die Negerin aus meinem Traum, schwarz wie ein Rest Nacht.
Dass mich das immer noch so erschreckte. Die war doch schon vor dem Weihnachtsbaum da gewesen. Dem einzigen Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr nach Dreikönig auf der Straße gelegen hatte. Früher hatten die sich hier mal gestapelt.
Der Baum war immer kleiner und brauner geworden und dann über Nacht verschwunden. Zu Brennholz gemacht von irgendeinem Zigeuner. Die Negerin blieb. Suchte die Fenster ab, nach einem Loch, durch das sie hereinkriechen könnte. Lauerte, wie ein Tier. Sie versuchten es alle immer zuerst hier. Das lag an mir. Weil ich das Haus in Schuss hielt. So was sieht man auch von außen.
Ich wich zurück. Ich wollte im ersten Augenblick auch noch den Vorhang zuziehen, aber wenn ich das tat und sie die Bewegung sah, wusste sie sicher, dass jemand hier war.
Na und? Wem sollte sie denn davon erzählen? Selbst wenn sie Deutsch konnte, es würden doch alle denken, sie hätte Geister gesehen. Eine alte weiße Frau? Im Löwen? Gibts den überhaupt noch?
Wahrscheinlich hatte sie ohnehin nichts gesehen. Die Sonne spiegelte zu sehr in den Fenstern.
Ich ließ den Vorhang, wie er war, ging ins Bad und dachte nicht mehr an sie. Im Bad lagen ganz andere Gedanken.
Seit ich allein war, hatte ich meine Gedanken so auf die Zimmer verteilt. Das half, wenn ich Zeit verlor und der Himmel, wie so oft, keine eindeutigen Zeichen gab. Die Zimmer blieben fest, unser Löwe war eine Burg. Viele der Wände hatte ich selber gezogen. Eins a gerade, hatte Gertrud gesagt. Daran dachte ich zum Beispiel immer, wenn ich durch den Flur im ersten Stock ging.
Eins a, davon zehr ich heut noch. Ich sag ja, ich bin genügsam. Im kleinen Bad erinnerte ich mich dann dran, dass Tante Gertrud es auch ausgehalten hatte, allein hier zu sein. Nach dem Krieg. Und was hatte sie sich darauf eingebildet! Als wärs ihr Verdienst, dass der Löwe noch stand, wo alles drum herum in Schutt und Asche lag. Ein abgebrochener Zahn in einem zertrümmerten Mund.
Es dauerte, bis ich begriff, dass ich das war, dieser Trümmermund.
Morgens sah ich Gertrud erschreckend ähnlich. Dabei hab ich die Augen meiner Mutter, die Nase, die Lippen – aber an mir ist das alles ein winziges bisschen anders, größer oder kleiner, ich hab es nie ausmachen können, aber an mir ist das hübsche Gesicht hässlich.
Ich wusch mich – jeden Morgen froh, dass ich mir warmes Wasser nie angewöhnt hatte – und nahm die Seifendose aus dem Schrank. Ich benutzte sie nicht mehr, ich roch nur dran. Das Stück war trotzdem kleiner geworden über die Jahre, aber es war noch immer lilienweiß und duftete nach süßer Milch.
Im Spiegel sah ich, wie meine Mutter hinter mir in den Bottich stieg und sich wusch. Sie zerreibt die Seife zu Schaum und bläst ein paar Flocken in mein Spiegelgesicht. Lilienmilch macht sogar Neger weiß. Meine Mutter steigt aus dem Bottich, und wie alle hässlichen Menschen kann ich mich nicht sattsehen an etwas so Schönem.
Komisch, wie deutlich diese Sachen werden.
Ihre Haut schimmerte auch noch seifenweiß, wenn sie frühmorgens zurückkam und sich neben mich legte. Ich konnte immer erst einschlafen, wenn ich sie berührt hatte. Das hatte ich vergessen.
Ich schloss die Küche auf – ich sperrte stets alle Räume ab, das war für mich so überlebenswichtig wie für einen Gefängniswärter. Dann löffelte ich Kaffeepulver in den Topf und ließ den Löffel klingeln, dass es sich anhörte, als wären zwanzig Mann im Raum. Wie früher, wenn wir die Schweißer dahatten für ihre Berufsschulwochen. Zwanzig Jungens mit Schlafkörnchen in den Wimpern und Bartresten unter den Kieferknochen. Einmal bin ich mit einem ausgegangen, ins Kino, vor den Schmuddelfilmen. Es war das einzige Mal, dass ich in einem Gästezimmer eingeschlafen bin – und dann auch noch auf einen Sonntag! Tante Gertrud musste warten, bis der Schweißer – um zwölf Uhr Mittag! – wach wurde und in die Schankstube runterging, bevor sie mich aus seinem Bett zerren konnte. Der Gast wird nicht geweckt!
Ich weiß noch, wie wunderbar es war, im Halbschlaf das Getrippel auf den Gängen zu hören, und wie die Sonne auf meinen Beinen wärmer wurde.
Ich machte mir ein Brot, und bevor ich merkte, was ich tat, hatte ich es zur Hälfte gegessen. Normalerweise aß ich morgens nichts, das Brot war für die Kitteltasche, für den Mittag. Ich machte ein zweites und hätte beinah auch da reingebissen. Das mussten die schlaflosen Nächte sein, die machten hungrig. Wenn ich weiter so fraß, würde ich in zwei, drei Tagen schon wieder rausmüssen. Ich steckte das Brot ein, trank noch ein Glas Wasser und holte mein Putzzeug. Ausgeschlafen oder nicht, in einem Hotel muss jedes Zimmer jeden Tag makellos aussehen. Die Betten papierglatt und papierweiß, so als könnte man nach einer Nacht darin noch mal ganz von vorn beginnen.
2
Die Negerin war immer noch auf ihrem Posten unter der Laterne, während ich die vierzehn machte. Die vierzehn war mein liebstes Zimmer, da ließ ich mir Zeit beim Putzen, hier waren so viele Gedanken drin. Manchmal legte ich mich sogar aufs Bett, um mich an wirklich alles zu erinnern. Es stand schon lang leer, seit dem Lehrer, aber riechen konnte man das nicht. Es war immer das erste auf meiner Runde, sodass ich es selbst an diesen kurzen Tagen im Winter machen konnte, wo ich manchmal nicht mehr als zwei, drei Zimmer schaffte.
Ich achtete darauf, nicht zu nah ans Fenster zu kommen, während ich Staub wischte. Das tat ich nicht erst, seit die Negerin da lauerte, das war mir in Fleisch und Blut übergegangen, seit ich allein war.
In meinem hohlen Zahn fing Gertrud leise zu singen an: Vor dem Tor, da steht ein Neger, und er wartet auf sein Opfer, das er tötet mit dem Klopfer.
Du machst mir keine Angst, sagte ich. Und die auch nicht. Sie stand jetzt schon so lang da, und nichts war passiert. Wenn sie jetzt noch kein Loch gefunden hatte, würde sie keins mehr finden. Außerdem sah sie erbärmlich aus.
Es war windig an dem Tag, aber ihre Kraushaare bewegten sich nicht. Ein erstarrter schwarzer Wattebausch. Die musste halb erfroren sein, so wie der Wind an ihrem dünnen Mäntelchen zerrte. Wie dürr sie war. Als würde sie jeden Augenblick umkippen vor Hunger.
Warum stand die nicht am Bahnhof, wie die Zigeuner, passte die paar Leutchen ab, die zu diesen Glasarkaden gingen mit ihren Taschen voll Geld. Oder wenn sie sich zu schade war zum Betteln: Die Container dahinter quollen nachts über. Vieles davon war vollkommen in Ordnung, noch verpackt und höchstens mal zwei Tage abgelaufen.
Schlau war sie jedenfalls nicht. Sie bemühte sich ja nicht mal, sich zu verstecken. Ich konnte sie von fast jedem Fenster aus sehen.
Der Löwe ist ein Eckhaus, was gut ist für ein Hotel, da schaut kein Zimmer auf einen hässlichen Hinterhof raus. Und es war gut für mich, da ich so immer die Straße im Blick halten konnte und das Kroppzeug, das sich da rumtrieb.
Die Negerin war seit Tagen die Einzige. Und die konnte auch nicht mehr lang bleiben, wenn sie nicht erfrieren wollte.
Hau ab, dachte ich, als ich das nächste Zimmer betrat und sie noch immer da unten sah. Obwohl sie sich kaum bewegte, machte sie mich nach einer Weile doch fickerig. Ich wurde hastig und schlampte bei der Arbeit, vergaß meinen Staubwedel in einem Zimmer, meinen Schlüsselbund in einem anderen, musste zurückgehen und fand ein Bett ungemacht.
Und als ich aus dem Fenster sah, war die Negerin immer noch da.
Wenn die nicht bald verschwand, würde mir hier alles durcheinandergeraten.
Hau ab, dachte ich. Hau endlich ab.
Aber sie blieb. Stand da wie festgefroren und stierte ins Nirgendwo. Wo glotzte die denn da hin?
Ich trat näher ans Fenster. Sie hatte die Eingangstür im Blick.
Gib auf, dachte ich. Da kommst du nie rein.
Die Tür war so sicher vernagelt wie ein Sarg. Ich hatte zugeschaut, als sie das machten, drei Mann, mit Nägeln dick wie kleine Finger und so lang wie meine Hand.
Es dauerte nicht lang, da bemerkte die Negerin, dass sie beobachtet wurde. Sie ruckte mit dem Kopf, und das Weiß in ihren Augen blitzte wie in meinem Traum. Und wie in meinem Traum sah sie mir geradewegs ins Gesicht, geradewegs, ohne erst andere Fenster abzusuchen. Die wusste genau, wo ich war.
Das konnte nicht sein.
Ich stand hinter dem Vorhang, und das Fenster war vom getrockneten Regen so dreckig, dass es fast blind war. Zum ersten Mal war ich glücklich über meine ungeputzten Fenster. Ich musste die ja dreckig lassen, so schwer mir das fiel. Aber wenn ich Fenster geputzt hätte, hätt ich auch gleich die Vordertür aufreißen und das Leuchtschild wieder anschmeißen können.
Die konnte mich nicht sehen. Wahrscheinlich suchte sie nur nach einem Fenster zum Einschmeißen. Hatte vielleicht die Steine schon in den Fäusten, die sie da in den Manteltaschen ballte.
Und der Häuptling Schwarzer Zacken, der frisst deinen weißen Backen, sang Gertrud aus meinem einsamen Zahn. Und von deinen kurzen Knochen lässt er sich ’ne Suppe kochen.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund, obwohl ich wusste, dass die Schwarze da draußen nichts gehört haben konnte. Ich hielt ganz still, hielt sogar den Atem an, bis sie ihren Blick – langsam, langsam, wie ein träges Raubtier – abwandte.
Sehr vorsichtig zog ich den Vorhang ganz vor das Fenster, sammelte mein Putzzeug ein und schlich rauf in die 23.
Normalerweise arbeitete ich mich ordentlich von unten nach oben durch die Räume, aber da hätt sie mich noch Stunden beobachten können. In der 23 konnte sie mich nicht sehen. Das winzige Fenster hatte ich mit Pappe verklebt, seit mir ein paar halbstarke Ölaugen einen Flachmann reingeworfen hatten. Doch bei denen hatte ich nur meinen Besen schwingen müssen, und sie waren gerannt, kreischend wie Mädchen.
Ich hätt gleich den Glaser rufen sollen, aber dann gefielen mir das Halbdunkel und der Wind, der mir über die Beine strich, wenn ich im Bett lag und mein Pausenbrot aß. Kalt wars eh überall, daran war ich gewöhnt.
In der 23 lagen die Schweißergedanken. Nichts anderes. Komisch, da hatte ich für eine einzige Nacht im Löwen ein ganzes Zimmer, und von anderen ganzen Jahren vor dem Löwen war nichts geblieben als ein bisschen grüngoldenes Geflirr in der Kitteltasche.
Doch als ich an diesem Morgen ins Schweißerzimmer kam, waren da gar keine Gedanken. Und es war auch nicht dunkel. Das Zimmer war taghell und so schneidend kalt, dass sich niemand dran hätte gewöhnen können. Die Pappe war aufgeweicht und runtergefallen. Ich sah direkt, ungeschützt, runter auf die Schwarze, die noch immer unter der Laterne stand und die Fenster nach mir absuchte. Ich duckte mich, bevor sie mich entdecken konnte, schob die nasse Pappe von der Bettdecke runter und kroch dann ins Bett. Zum Glück war die Decke nicht ganz durchgeweicht. Ich zog sie über mich, machte die Augen zu und wartete auf die Schweißergedanken.
Es kamen keine. Als hätte der Wind das Zimmer leer gepustet. Ich öffnete die Augen wieder und sah, dass über dem Bett, in der Zimmerecke, irgendwas hing. Da war was gewachsen. Fächer von flachen, fleischig gelben Hüten wie bei einem Baumpilz. Mein Mund zog sich zusammen.
Wärs was anderes gewesen – ich hätt die Tür abgeschlossen und das Zimmer nie wieder betreten. Mich von den Schweißergedanken verabschiedet und mich gefreut, nur noch dreizehn Zimmer zu haben. Aber Pilz – ein Pilz ist das Schlimmste, was einem Hotel passieren kann. Das ist ein Todesurteil.
„Wie Astrid Sozio den Verfall von Haus und Bewohnerin und die zögerliche Annäherung der beiden Frauen begleitet, ist im besten Sinne schauderhaft. Nämlich rau, kompromisslos und eindrücklich“
„Ein Plädoyer gegen Vorurteile“
„Thematisch hochaktuell begeht er [der Roman] glücklicherweise nicht den Fehler, eine stereotyp rassistische Figur in den Mittelpunkt zu rücken, die Vorurteile bedient. Er illustriert, dass Annäherung und Verständigung selbst unter widrigsten Umständen möglich sind, wenn wir uns selbst im anderen erkennen.“
„Astrid Sozio erzählt diese hinreißende Geschichte aus Frieda Troosts Perspektive: schnörkellos, klar, in einem wohltuend ungekünstelten Ton. Eindringlich, aber nie aufdringlich.“
„Die Autorin verwebt auf überraschende Weise die psychologisch fein ausgearbeitete Beschreibung einer alten Frau mit der aktuellen politischen Lage. (…) Ein beeindruckender Erstlingsroman.“



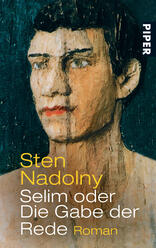




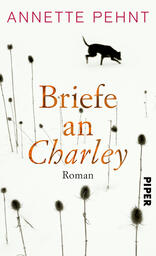





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.