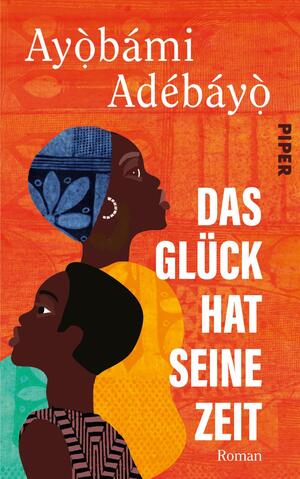
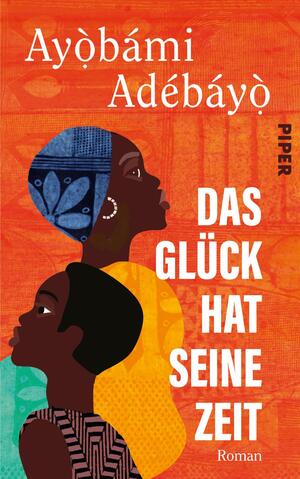
Das Glück hat seine Zeit Das Glück hat seine Zeit - eBook-Ausgabe
Roman
— Booker Prize 2023 (Longlist)„Ihr zweiter Roman ist so mitreißend wie ihr Debüt ›Bleib bei mir‹.“ - Der Spiegel
Das Glück hat seine Zeit — Inhalt
Gibt es Glück in einem zerrissenen Land?
Eniola ist groß für sein Alter, ein fünfzehnjähriger Junge im Körper eines Mannes. Jeden Tag fürchtet er die Schläge seiner Lehrer, denn seit der Entlassung des Vaters fehlt das Geld für seinen Schulbesuch. Bis Eniola als Laufbursche einer Näherin der wohlhabenden Yeye begegnet.
Wuraola dagegen hat Glück: Die junge Ärztin ist frisch verlobt, ihr Freund Kunle stammt aus besten Verhältnissen. Während ihre Mutter Yeye vom Hochzeitskleid träumt, zeigen sich erste Risse. Die Familie wird bedroht, seit Kunles Vater als Gouverneur kandidiert. Und der amtierende Honorable wirbt für seine Leibgarde Jugendliche an, so groß und kräftig wie Männer.
„›Das Glück hat seine Zeit‹ setzt sich mit Klasse und sozialem Aufstieg im heutigen Nigeria auseinander. Während Eniolas Armut dazu führt, dass ihm die ersehnte Bildung verwehrt wird, muss Wuraola erleben, dass ihr Wohlstand sie nicht vor der harten Realität des Lebens bewahrt. Eine eindrückliche, erschütternde Lektüre.“ Jury des Booker Prize 2023
„Ein herausragendes Buch!“ BBC Radio 4
»Adébáyọ̀ zeichnet all diejenigen, die in den Strudel der Macht geraten, mit bemerkenswertem Mitgefühl. Die Irrtümer und Irrwege ihrer Figuren sind so tief, so empathisch nachempfunden, dass sie selbst lebendig werden.« The New York Times
»›Das Glück hat seine Zeit‹ löst auf ganzer Linie ein, was man sich von einer so begabten Erzählerin wie Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ verspricht.« Oprah Daily
„Unwiderstehlich … Dieser ausgesprochen gut lesbare Roman ist eine schonungslose Anklage des (politischen wie privaten) Machtmissbrauchs und der allgegenwärtigen Gewalt, die ganze Leben über Nacht zu zerstören vermag.“ Observer
Ein mitreißender Roman über Armut und Privileg im zerrütteten Nigeria – und über die Kosten des Glücks.
Leseprobe zu „Das Glück hat seine Zeit“
1
Eniola beschloss, so zu tun, als wäre es nur Wasser. Ein schmelzendes Hagelkorn. Nebel oder Tau. Vielleicht war es sogar etwas Gutes: ein vereinzelter Regentropfen, einsamer Vorläufer einer wahren Sintflut. Die ersten Regenfälle des Jahres bedeuteten, dass er bald endlich wieder eine Agbalumo-Frucht essen konnte. Die Obstverkäuferin am Stand vor seiner Schule hatte gestern einen Korb mit Agbalumo im Angebot gehabt, aber Eniola hatte keine gekauft, weil, wie er sich einredete, seine Mutter ihn oft gewarnt hatte, wenn man die Früchte vor dem ersten Regen [...]
1
Eniola beschloss, so zu tun, als wäre es nur Wasser. Ein schmelzendes Hagelkorn. Nebel oder Tau. Vielleicht war es sogar etwas Gutes: ein vereinzelter Regentropfen, einsamer Vorläufer einer wahren Sintflut. Die ersten Regenfälle des Jahres bedeuteten, dass er bald endlich wieder eine Agbalumo-Frucht essen konnte. Die Obstverkäuferin am Stand vor seiner Schule hatte gestern einen Korb mit Agbalumo im Angebot gehabt, aber Eniola hatte keine gekauft, weil, wie er sich einredete, seine Mutter ihn oft gewarnt hatte, wenn man die Früchte vor dem ersten Regen esse, bekomme man Bauchkrämpfe. Doch wenn die Flüssigkeit in seinem Gesicht Regen war, würde er sich in ein paar Tagen den süßen, klebrigen Saft einer Agbalumo von den Fingern lecken, auf dem faserigen Fruchtfleisch herumkauen, bis es eine gummiartige Konsistenz hatte, die Samenkapseln knacken und seiner Schwester die Samen schenken, die sie halbieren und daraus Ohrringe zum Ankleben machen würde. Und so versuchte er, sich vorzumachen, es wäre nur Regen, auch wenn es sich nicht so anfühlte.
Er spürte die Blicke des guten Dutzend Männer, die sich um den Stand des Zeitungsverkäufers drängten, obwohl sie die Augen niedergeschlagen hatten. Stumm und starr standen sie da, wie die ungehorsamen Kinder, die von einem bösen Zauberer in Stein verwandelt worden waren, eine Geschichte, die ihm sein Vater früher oft erzählt hatte.
Als Kind hatte Eniola immer die Augen zugekniffen, wenn er in Schwierigkeiten war, in der Gewissheit, für jeden, den er nicht sehen konnte, unsichtbar zu sein. Obwohl er wusste, dass die Augen zu schließen und zu hoffen, dass er sich in Luft auflöste, ebenso albern war, wie zu glauben, dass Menschen in Stein verwandelt werden konnten, machte er auch jetzt die Augen zu. Natürlich löste er sich nicht in Luft auf. So viel Glück hatte er nicht. Der wackelige Verkaufstisch befand sich immer noch so dicht vor ihm, dass seine Oberschenkel die daraufliegenden Zeitungen berührten. Der Verkäufer, den er Egbon Abbey nannte, stand noch immer neben ihm, und die Hand, die er schwer auf Eniolas Schulter gelegt hatte, bevor er sich geräuspert und ihm ins Gesicht gespuckt hatte, ruhte immer noch dort.
Eniola strich sich über die Nase, und sein Finger näherte sich dem feuchten Gewicht des Schleims. Stumm vor Verblüffung, dass etwas so Unerwartetes ihre Alltagsroutine unterbrach, schienen alle Männer, selbst Egbon Abbey, den Atem anzuhalten und darauf zu warten, was als Nächstes passieren würde. Nicht einer von ihnen zog die Chelsea-Fans damit auf, dass Tottenham ihr Team am Vorabend vernichtend geschlagen hatte. Niemand stritt über den offenen Brief, den ein Journalist und Politiker über andere Politiker verfasst hatte, die angeblich in Menschenblut badeten, um sich vor bösen Geistern zu schützen. Alle waren verstummt, als der Speichel des Verkäufers Eniola im Gesicht traf. Und jetzt ließen die Männer, die sich jeden Morgen um den Stand scharten, um über die Schlagzeilen zu diskutieren, Eniola nicht aus den Augen. Sie wollten sehen, wie er reagieren würde. Sie wollten, dass Eniola den Verkäufer schlug, ihn anschrie, ihn beleidigte, in Tränen ausbrach, oder noch besser, sich ebenfalls räusperte, den Auswurf im Mund sammelte und Egbon Abbey seinerseits ins Gesicht spuckte. Eniola fuhr sich mit der Hand über die Stirn; er war zu langsam gewesen. Der Schleim war ihm schon seitlich die Nase hinuntergelaufen und hatte eine feuchte, klebrige Spur auf seiner Wange hinterlassen. Die zähe Flüssigkeit wegzuwischen kam nicht mehr infrage.
Er spürte, wie etwas gegen seine Wange gedrückt wurde, verzog das Gesicht und stieß gegen den Zeitungsstand. Um ihn herum murmelten ein paar Leute „Tut mir leid“, als er sich am Tisch festhielt, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Einer der Männer hatte ihm ein blaues Taschentuch ins Gesicht gedrückt.
„Hin se, Sir“, sagte Eniola, als er es annahm; und er war dankbar, obwohl das Stück Stoff schon mit weißen Striemen überzogen war, die abblätterten, als er es sich an die Wange hielt.
Eniola sah sich in der kleinen Menschentraube um und straffte die Schultern, nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand von seiner Schule dort war. Nur Erwachsene drängten sich um den Tisch. Manche Männer waren schon für die Arbeit angezogen und zupften an zu fest gebundenen Krawatten oder schlecht sitzenden Jacketts herum. Viele trugen verblichene Pullover oder Bomberjacken, deren Reißverschlüsse bis zum Hals hochgezogen waren. Die meisten der Jüngeren, deren Namen er ein „Brother“ voranstellen musste, um keine Kopfnuss zu kassieren, hatten vermutlich erst vor Kurzem ihren Abschluss an der Fachhochschule oder der Universität gemacht. Sie lungerten oft den ganzen Vormittag an Egbon Abbeys Stand herum, lasen, redeten oder notierten sich Stellenanzeigen aus den Zeitungen in Notizbücher oder auf Papierfetzen. Dann und wann halfen sie dem Verkäufer mit Kleingeld aus, aber keiner kaufte eine Zeitung.
Eniola wollte das Taschentuch zurückgeben, doch der Mann winkte ab und blätterte in einer Ausgabe der Wochenzeitung Alaroye. Wenigstens war niemand da, der seinen Klassenkameraden berichten konnte, wie der Verkäufer ihn fast eine Minute lang angefunkelt hatte, bevor er ihm ins Gesicht spuckte. Es war so überraschend gekommen, dass er den Kopf erst zur Seite gedreht hatte, als er schon spürte, wie die Feuchtigkeit an seiner Nase hinunterlief, und dass es selbst die Männer zum Schweigen brachte, deren Stimmen sonst in der ganzen Straße zu hören waren. Wenigstens hatten Paul und Hakeem, Klassenkameraden von ihm, die in dieser Straße lebten, es nicht mitbekommen. Nachdem Paul ein altes Video von einem Auftritt des Komikers Klint da Drunk in Night of a Thousand Laughs gesehen hatte, eiferte er Klint nach. Seitdem verbrachte er jede Unterrichtsstunde, in der ein Lehrer nicht aufgekreuzt war, damit, durch die Klasse zu taumeln, gegen Tische und Stühle zu stoßen und seinen Klassenkameraden Beleidigungen zuzulallen.
Eniola rieb sich die Wange, um die übrige Feuchtigkeit auf der Haut zu verteilen. Wenn auch nur der kleinste Rest Speichel auf seiner Wange zu sehen war, wenn er auf dem Heimweg an Pauls Haus vorbeikam, würde es bei der knapp einstündigen Vorführung des Jungen vor der Klasse heute nur um ihn gehen. Paul würde behaupten, Eniola sabbere im Schlaf, habe sich nicht gewaschen, bevor er die Schuluniform anzog, oder komme aus einer Familie, die sich keine Seife leisten könne. Alle würden ihn auslachen. Er lachte ebenfalls, wenn Paul andere Schüler drangsalierte. Die meisten seiner Witze waren nicht einmal lustig, doch in der Hoffnung, dass Paul weiterhin seine Aufmerksamkeit auf das bedauernswerte Opfer konzentrierte, das er sich für den Nachmittag ausgesucht hatte, lachte Eniola über alles, was er sagte. Wenn Paul jemand anderen aufs Korn nahm, dann normalerweise ein Mädchen, das nicht über seine Witze lachte. Normalerweise. Doch an einem schrecklichen Nachmittag hatte Paul aufgehört, über die abgewetzten Schuhe einer Klassenkameradin herzuziehen, um zu verkünden, Eniolas Stirn sehe aus wie das dicke Ende einer Mango. Eniola, der immer noch über das Mädchen mit den abgewetzten Schuhen lachte, merkte, während die Klasse stattdessen in Gelächter über ihn ausbrach, welches er noch Monate später in seinen Träumen hörte, dass er den Mund nicht mehr zubekam. Er wollte aufhören zu lachen, konnte es jedoch nicht. Weder als ihm vor lauter Tränen der Hals wehzutun begann, noch als seine Klassenkameraden verstummten, weil die Chemielehrerin fünf Minuten vor dem Ende ihrer Stunde in den Raum platzte. Er lachte und lachte, bis sie ihm befahl, sich mit dem Gesicht zur Wand in eine Ecke zu knien.
Er bräuchte einen Spiegel … nein. Nein. Er würde keinen der Männer hier fragen, ob auf seinem Gesicht noch Flecken zurückgeblieben waren. Auf keinen Fall. Eniola nahm die Hand von der Wange und schaute mit zusammengekniffenen Augen zu dem dreistöckigen Gebäude auf, in dessen erster Etage Pauls Familie lebte. Sie teilten sich die vier Räume der Wohnung mit zwei anderen Familien und einer alten Frau, die keine Verwandten hatte. Diese Frau stand jetzt vor dem Haus und streute Körner für die gackernden Hühner zu ihren Füßen in den Sand. Kein Paul. Vielleicht hatte er sich schon auf den Weg zur Schule gemacht. Aber vielleicht lungerte er auch nur im Treppenhaus oder im Flur herum, bereit, aus dem Haus zu treten, sobald Eniola vorbeiging.
Eniola drückte gegen die vorspringende Stelle an seiner Stirn, die seine Nasenwurzel überragte, als wollte er sie in den Schädel zurückpressen. Vielleicht sollte er einfach an dem Haus vorbeirennen. All das war die Schuld seines Vaters. Die Dinge, die Paul womöglich über ihn sagen würde, die Männer, die seine geballten Fäuste beäugten, als erwarteten sie, er würde den Zeitungsverkäufer verprügeln, die Wut des Verkäufers selbst. Besonders die Wut des Verkäufers. Denn es war sein Vater, der dem Mann Tausende Naira schuldete, sein Vater, der seit Monaten The Daily auf Pump kaufte, damit er alle Stellenanzeigen lesen konnte, sein Vater, der heute Morgen darauf bestanden hatte, dass Eniola den Verkäufer um eine weitere Ausgabe anbetteln sollte. Und so hätte die stinkende Mischung aus Speichel und Auswurf eigentlich im Gesicht seines Vaters landen sollen.
Er spürte eine Hand auf der Schulter und wusste, wem sie gehörte, noch bevor er sich zu dem Verkäufer umdrehte. Der Mann stand so dicht bei ihm, dass Eniola den Gestank seines Atems riechen konnte. Wobei der auch von seinem eigenen Gesicht stammen konnte. Denn obwohl er sich den Speichel abgewischt hatte, der Geruch war geblieben. Egbon Abbey hustete, und Eniola wappnete sich. Was konnte der Verkäufer ihm noch antun? Ihm ins Gesicht schlagen, sodass er mit einem nicht zu übersehenden Bluterguss im Gesicht oder einer gebrochenen Nase nach Hause käme, was Eniolas Vater verraten würde, was hier passiert war?
„Du wolltest die Daily? Hier hast du sie.“ Der Verkäufer gab Eniola mit der aufgerollten Zeitung einen Klaps auf den Arm. „Aber wehe, ich erwische dich oder deinen Vater noch einmal hier, hörst du? Sag’s ihm. Sag ihm, wenn ich einen von euch beiden noch mal sehe, werde ich mit meiner Faust in eurem Gesicht ein blaues Wunder vollbringen, verstanden? Jeder, der euch begegnet, wird glauben, ihr wärt von einem Laster überfahren worden. Ich warne dich – entscheidet euch nicht für das Unglück.“
Eniola hätte dem Verkäufer am liebsten die Zeitung in den Rachen gestopft. Er wünschte sich, sie auf die rote Erde zu werfen und darauf herumzutrampeln, bis sie völlig zerfetzt war – oder zumindest, sich umzudrehen und Egbon Abbey einfach stehen zu lassen, ohne die Zeitung angenommen zu haben. Solchen Unsinn musste er sich ständig von Erwachsenen gefallen lassen, selbst von seinen Eltern. Er wusste, der Verkäufer würde sich nie für seinen Wutausbruch entschuldigen; er würde eher aus dem Rinnstein trinken, als zuzugeben, dass es falsch gewesen war, Eniola ins Gesicht zu spucken. Die Zeitung diente auch als Entschuldigung. Bei der Vorstellung, ein Erwachsener, seine Mutter oder sein Vater, könnte sich für irgendetwas bei ihm entschuldigen, hätte er fast laut aufgelacht.
„Hast du dich in eine Statue verwandelt?“, fragte der Verkäufer und stupste Eniola mit der Daily gegen die Brust. Bald würde sein Vater wieder genug Geld haben, um ihn loszuschicken, eine Zeitung zu kaufen. An dem Tag würde er den ganzen weiten Weg zum Wesley Guild Hospital laufen und sie dort erstehen. Auf dem Rückweg würde er am Stand von Egbon Alley vorbeigehen und darin blättern, sodass der boshafte Mann es sehen würde. Aber zuerst musste sein Vater eine Stelle finden. Und so nahm Eniola die Zeitung an, murmelte etwas, was man mit einem Dank hätte verwechseln können, und rannte davon. Weg von dem Verkäufer mit seinem stinkenden Atem, vorbei an Pauls Haus, wo die alte Frau mit einem Küken kämpfte, an dessen Federn sie einen roten Faden befestigen wollte, schneller und schneller, den Abhang hinunter nach Hause.
Sein Vater schien die Seiten der Daily beim Umblättern nur mit den Fingerspitzen zu berühren. Oder vielleicht auch nur mit den Fingernägeln – das konnte Eniola, der bei der Tür stand, nicht genau erkennen. So viel Vorsicht, und das, nachdem er sich zweimal die Hände gewaschen und es abgelehnt hatte, sie sich an einem Stück Stoff abzutrocknen; er hatte sogar die Spitzenbluse verschmäht, die Eniolas Mutter aus ihrer Spezialbox gefischt hatte, in der sie ihre Sammlung von Spitze und Aso-oke-Stoffen aufbewahrte. Stattdessen war er im Zimmer auf und ab geschritten – von der Wand zum Bett, vom Bett zur Matratze auf dem Boden, von der Matratze auf dem Boden zum Schrank mit den Töpfen, Tellern und Tassen – und hatte die Arme hochgehalten, bis die Feuchtigkeit verdunstet war. Er hatte sich sogar mit jedem Finger gegen die Augenlider getippt, bevor er Eniola bat, ihm die Daily zu reichen. Wenn sie zehn Ausgaben beisammenhatten, konnten sie sie gegen Geld oder Essen bei einer der Frauen eintauschen, die Erdnüsse, gebratene Yamswurzel und geröstete Kochbananen in ihrer oder einer benachbarten Straße verkauften. Eniola wäre Essen lieber gewesen, besonders wenn es von jener Verkäuferin kam, die die Kochbananen genau so briet, wie er es mochte, außen knusprig, innen noch saftig. Aber seine Eltern verlangten immer Geld für die Zeitungen, und je sauberer sie waren, desto mehr waren die Frauen bereit, dafür zu bezahlen.
Sein Vater war noch zu jung, um zu ergrauen. Das hatte zumindest seine Mutter gesagt, als sie zum ersten Mal ein graues Haar auf Baamis Kopf ausgerissen hatte; sie behauptete, wenn man sie mitsamt der Wurzel auszupfe, würden sie schwärzer nachwachsen als zuvor. Und doch war im letzten Jahr innerhalb eines Monats jede einzelne Strähne auf Baamis Kopf grau geworden. Das Grau hatte sich rasend schnell von Baamis Schläfen über jeden Quadratzentimeter seiner Kopfhaut ausgebreitet, sodass Eniola sich innerhalb weniger Wochen alte Fotos seines Vaters anschauen musste, um sich daran zu erinnern, wie dieser ausgesehen hatte, als seine Haare noch schwarz gewesen waren.
Auf einem zerknitterten, abblätternden Bild steht Baami neben einer Tür und schaut mit schmalen Augen in die Kamera, als wollte er den Fotografen warnen, ja kein schlechtes Bild zu machen. Sein Haar war nicht nur an den Schläfen, sondern auch überall sonst schwarz. Ein Scheitel auf der linken Seite enthüllte ein Stück seiner glänzenden Kopfhaut. An der Tür prangte – so, dass man es gerade noch auf dem Bild erkennen konnte, obwohl ein Ende davon abgeschnitten war – ein schwarzes Namensschild mit der Aufschrift „Vizedirektor“ in goldener Kursivschrift. Darunter stand, auf ein rechteckiges Blatt Papier getippt, das aussah, als wäre es erst vor Kurzem angebracht worden und würde bald wieder abgerissen werden, Baamis Name: Mr. Busuyi Oni. Baami stand kerzengerade da, die Schultern so weit zurückgenommen, dass Eniola sich fragte, ob er vielleicht deshalb nicht lächelte, weil ihm die Schulterblätter wehtaten. In den Jahren, seitdem das Foto aufgenommen worden war, hatte Baami aufgehört, Kameras oder Menschen direkt anzublicken. Nur Eniolas Mutter bestand immer noch drauf, dass er ihr in die Augen sah, wenn er mit ihr redete. Sprach er dagegen mit Eniola oder seiner Schwester, schaute er mit unruhigem Blick auf ihre Füße hinunter, als würde er wieder und wieder ihre Zehen zählen.
Baami faltete die Daily zusammen und räusperte sich. „Was, wenn du das Gemüse verkaufst, das wild im Hinterhof wächst? Ich kann dir bei der Ernte helfen …“
„Nein, nein, nein, das kann man auf keinen Fall verkaufen, Baba Eniola. Schau dir die Zeitung bitte genau an. Hast du sie von vorn bis hinten studiert?“, fragte Eniolas Mutter.
„Hast du etwas gefunden?“, fragte Eniola.
Sein Vater schlug die Zeitung erneut auf, ohne zu antworten. Eniola wäre am liebsten nach draußen gegangen, um sich das Gesicht zu waschen, doch er fühlte sich genötigt, bei seinen Eltern zu bleiben. Außerdem hatte er sich heute schon gewaschen, und seine Mutter hatte die Seife in einem ihrer zahllosen Verstecke deponiert. Wenn er sie jetzt um Seife bat, würde sie wissen wollen, wozu er sie brauchte. Sie würde nicht lockerlassen, bis er ihr erklärte, warum er sie haben wollte, nicht einmal dann, wenn er seine Meinung änderte und ihr erzählte, dass er sie doch nicht brauchte. Sie würde ihn dazu bringen, ihr zu gestehen, was passiert war, sie fand immer einen Weg. Und er wusste, sobald er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, würde sie zu dem Verkäufer eilen und ihm ins Gesicht spucken, bis sie einen trockenen Mund bekam. Und das wollte er nicht. Ja, er hätte liebend gern erlebt, wie der Verkäufer versuchte, dem Zorn seiner Mutter zu entgehen, aber das hätte bedeutet, dass noch mehr Leute von seiner Demütigung an diesem Morgen erfuhren. Im Grunde brauchte er keine Seife. Vielleicht sollte er sich das Gesicht nur mit Wasser und dem Schwamm waschen, den er benutzte, wenn ihnen die Seife ausging.
Er hätte gleich in den Hinterhof gehen können, aber Busola war nicht im Zimmer. Vielleicht fegte sie gerade den Hof, wusch Teller ab oder schrubbte den Topf, in dem ihre Mutter am Vorabend amala gekocht hatte. Es war besser zu warten, bis sie zurückkam, denn er wollte seinen Vater nicht mit der Zeitung allein lassen. Wann immer es ging, blieb er bei seinem Vater, damit der nicht allein war. Seine Mutter war zwar ebenfalls hier, aber sie verhielt sich seltsam. Sie saß am Fußende des Bettes und faltete wieder und wieder die Bluse, die sie Baami zuvor angeboten hatte.
„Niemand kauft gbure“, sagte sie. „Die wächst jetzt überall im Hinterhof, niemand kauft sie. Selbst Hunde und Ziegen haben gbure-Blätter im Hinterhof.“
Eniola lehnte sich gegen die Wand; es machte keinen Unterschied, ob gbure überall im Hinterhof oder auf jedem Quadratzentimeter dieses Zimmers, auf seinem Kopf oder dem seiner Eltern wuchs. Wie viel hätte sie seiner Mutter schon eingebracht? Es würde nie für Busolas und seine Schulgebühren reichen. Das wusste er, weil er selbst in den Ferien gbure auf der Straße verkauft hatte. Obwohl er den ganzen Weg zum Krankenhaus gegangen war, im Zickzack über den Markt, am Palast vorbei, dann bis zur Christ Apostolic Church neben der Brauerei, hatte er kaum mehr als die Hälfte davon losbekommen.
Eniolas Vater hustete. Anfangs schien es, als würde er sich nur räuspern, aber bald wurden seine Schultern von einem Anfall geschüttelt, bis er nach Luft schnappte. Seine Mutter warf die Bluse aufs Bett, füllte einen Becher bis zum Rand mit Wasser, ging, ein Rinnsal in ihrem Kielwasser hinterlassend, zu Baami und legte ihm die Hand auf die Schulter. Sein Vater trank das Wasser in einem Zug aus, doch der Husten blieb hartnäckig, bis er seine Knie umfasste und sich auf das Bett setzte.
„Und du, wann willst du in die Schule gehen?“, fragte Eniolas Mutter und rieb ihrem Mann den Rücken, während der Husten langsam nachließ.
„Ich … ich wollte nur wissen, ob Baami etwas in der Zeitung gefunden hat.“
„Nimm jetzt deine Tasche und geh“, sagte seine Mutter.
Baami deutete mit dem Finger in Eniolas Richtung. „Keine Sorge, ich habe etwas Vielversprechendes gesehen, etwas sehr, sehr Vielversprechendes, Eniola. Ich schreibe noch heute die Bewerbung.“
„Ich kann dir helfen, sie zur Post zu bringen“, sagte Eniola.
„Das ist nicht nötig – deine Mutter kann sie mitnehmen, wenn sie zum Markt geht.“
„Ich dachte, sie geht nicht zum –“
„Wieso sehe ich immer noch deinen Schatten in diesem Haus?“ Seine Mutter deutete mit weit ausholender Geste auf das Zimmer. „Sag deiner Schwester, sie soll aufhören zu tun, was auch immer sie tut, und zur Schule gehen. Wozu sollen wir versuchen, eure Schulgebühren aufzubringen, wenn ihr sowieso zu spät kommt?“
„Ja, ma.“ Eniola nahm seine Schultasche. „Kann ich Salz haben?“
„Wieso bittet das Kind mich um Salz, obwohl es längst in der Schule sein müsste? Willst du etwa heute Morgen einen Topf Suppe kochen, Eniola?“
„Ich – ich habe mir noch nicht die Zähne geputzt.“
Seine Mutter sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an, als wäre da, wo sein Kopf sein sollte, eine große Kokosnuss. Er rührte sich nicht, schaute weiter in ihre Richtung, denn er wusste, wenn er den Blick abwandte, würde sie ihn verdächtigen zu lügen. Gleichzeitig vermied er es, ihr direkt in die Augen zu sehen. Das hätte sie als Mangel an Respekt betrachtet, als einen Beweis, dass er sich in einen wilden Vogel verwandelt hatte, der ihr ins Gesicht fliegen würde, wenn sie ihn nicht mit einem gezielten Schlag abwehrte. Er hatte nicht bemerkt, dass er den Atem anhielt, bis sie mit dem Kopf auf den Schrank mit den Töpfen, Tellern und einem kleinen Sack Salz deutete.
Eniola schaufelte einen gehäuften Löffel voll in seine Hand und ballte sie zur Faust.
Busola war gerade damit fertig, den Topf auszuwaschen, als Eniola den Hinterhof betrat. Sie gab ihm eine große Schüssel Wasser, die sie nicht benutzt hatte, damit er keins vom Brunnen in der Ecke des Hofs holen musste. Der Harmattan überzog seine Beine mit einer feinen Staubschicht, trocknete seine Lippen aus und ließ seine Arme von den Ellbogen bis zu den Fingerspitzen kribbeln wie eine Million Nadelstiche. Er spritzte sich Wasser ins Gesicht und schrubbte sich mit dem Salz die Nase, bis die Haut sich wund anfühlte, als könnte sie sich jeden Moment schälen. Wieder und wieder wusch er sich das Gesicht, bis die Schüssel leer war. Und doch glaubte er immer noch, das feuchte Gewicht zu spüren, schale Zwiebeln und faule Eier zu riechen. Und noch etwas anderes, das er nicht einordnen konnte, obwohl er den ganzen restlichen Vormittag darüber nachdachte.
„Adébáyò ist eine so brillante Erzählerin, dass man wie im Flug durch dieses Buch gleitet, angetrieben von einer makellos-flüssigen Sprache.“
„Spannende Geschichte mit fatalen Wendungen und mutigen Entscheidungen.“
„Ihr zweiter Roman ist so mitreißend wie ihr Debüt ›Bleib bei mir‹.“
„Sie erzählt anrührend und ohne jeden Hauch von Kitsch.“
„Der nigerianische Alltag wird schnörkellos und sehr plastisch geschildert. Ein lesenswertes Buch, das einen Insider-Blick auf Nigeria wirft.“
„Dazu gibt es unvergessliche Nebenfiguren und eine (gesellschaftspolitische) Geschichte, die unterhaltsam ist, in Momenten sogar auflachen lässt, nur um mich dann in einen Moment zu werfen, der wütend macht oder mir das Herz zerreißt.“
„Die Geschichte ist ganz stark in der gesellschaftlichen Realität verankert und das ist es auch, was mich am meisten überzeugt hat.“
„Adébáyò schafft es wieder mich mit ihrem großem Schreibtalent in den Bann ihres Romans zu ziehen.“
„Ein beeindruckender wie bewegender Roman.“
„Dieser spannende Roman erzählt von Nigeria und der klaffenden Kluft zwischen Reichen und Mittellosen.“
„Die Schriftstellerin Ayòbámi Adébáyò, ist zweifelsohne eine der spannendsten Stimmen der afrikanischen Gegenwartsliteratur.“
„Mit enormer Erzählkraft und gespickt mit Details und Vokabeln aus dem nigerianischen Alltag schildert Adébáyò das Schicksal zweier Familien.“
„Adébáyò richtet das Schlaglicht in ihrem Roman dabei neben den Frauen vor allem auf die Gefahren, in Machtstrudel zu geraten, und das tut sie mit viel Sensibilität und Empathie, dass es einen beim Lesen fast zerreißt.“

























DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.