

Das Haus der Malerin Das Haus der Malerin - eBook-Ausgabe
Roman
„Wer gerne über das Leben mit all seinen Tücken liest, der ist mit dem neuen Buch von Judith Lennox bestens bedient.“ - Radio Euroherz
Das Haus der Malerin — Inhalt
Surrey, 1970: Rose Martineau führt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in Walton-on-Thames ein beschauliches Leben. Doch die Idylle wird durch zwei unerwartete Ereignisse jäh bedroht. Zum einen erbt sie ein Haus in den dichten Wäldern von Sussex, das ursprünglich ihrer bislang vollkommen unbekannten Großtante Sadie gehört hatte – einer Künstlerin, die eines Tages spurlos verschwand. Wer war diese Frau, und warum wurde nie von ihr erzählt?Zum anderen bringt ein Medienskandal Roses Bilderbuchehe ins Wanken. Rose stürzt sich in Nachforschungen über Sadie und geht nach und nach einem düsteren Familiengeheimnis auf den Grund. Beflügelt durch die Erkenntnisse um die starke Persönlichkeit ihrer Großtante, wagt auch sie schließlich einen Neuanfang …
Leseprobe zu „Das Haus der Malerin“
Prolog
Sussex, Dezember 1928
Sie stiegen aus dem Auto, einem viersitzigen Austin 12. Die Luft roch würzig nach feuchter Erde und faulendem Laub, zudem nach etwas Fleischigem, Bitterem. Edith stellte sich Sporen vor, die von den schwammigen gelben Pilzen an den Baumstämmen über die Straße schwebten. Es war kälter als in London, kälter sogar als in Nutcombe, unten im Tal, wo sie angehalten hatten, um im Dorfladen Pfefferminzbonbons zu kaufen. Sie zog ihren Pelzkragen höher.
„Heiliger Bimbam“, sagte Cyril, als er das Haus sah.
„Gefällt es dir?“
»Ich weiß nicht [...]
Prolog
Sussex, Dezember 1928
Sie stiegen aus dem Auto, einem viersitzigen Austin 12. Die Luft roch würzig nach feuchter Erde und faulendem Laub, zudem nach etwas Fleischigem, Bitterem. Edith stellte sich Sporen vor, die von den schwammigen gelben Pilzen an den Baumstämmen über die Straße schwebten. Es war kälter als in London, kälter sogar als in Nutcombe, unten im Tal, wo sie angehalten hatten, um im Dorfladen Pfefferminzbonbons zu kaufen. Sie zog ihren Pelzkragen höher.
„Heiliger Bimbam“, sagte Cyril, als er das Haus sah.
„Gefällt es dir?“
„Ich weiß nicht recht“, meinte er. „Es ist ziemlich überwältigend.“ Er trat ein paar Schritte zurück und schob seine Brille hoch. „Oder doch, ich glaube, ja.“ Er gab ihr einen Kuss. „Ich glaube, ich werde begeistert sein.“
„Ich wusste es.“ Edith war wie beschwipst von der Freiheit: ein Tag ohne Haushalt, ein Tag mit den zwei Männern, die ihr die liebsten waren, in diesem schönen, lichterfüllten Haus.
Sie hatte gewusst, dass Gull’s Wing Cyril gefallen würde. Wie sollte es auch anders sein: Das Märchenschloss aus Glas, Holz und Stein stand am Höhenweg, der den Grat entlangführte. Die kluge, ordnende Hand ihres Vaters verriet sich in der scheinbaren Einfachheit des Baus, der so leicht hingesetzt schien, als könnte ihn ein Windstoß von der Höhe fegen. Die Fassade entlang, dem Anschein nach beinahe zu fragil, um das überhängende Dach zu tragen, reihten sich Säulen, schlank wie die hohen, hageren Nadelbäume des Paley High Wood auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die blassgraue Holzverschalung leuchtete in der Wintersonne und ließ an die Segel eines Schiffs denken – oder die Schwingen eines Meeresvogels.
Cyril hatte den Wagen hinter dem Bentley von Ediths Vater abgestellt. Sie sagte: „Daddy muss im Haus sein.“
Die Tür war angelehnt. Cyril stieß sie auf. „Mr. Lawless?“, rief er. „Edward? Wir sind da.“
Edith hörte Stimmen aus dem oberen Stockwerk. „Ich wusste gar nicht, dass Mama auch kommt“, sagte sie, und auf dem Weg nach oben erklärte sie Cyril: „Daddy hat das Wohnzimmer in den ersten Stock gelegt, damit man die Aussicht genießen kann. Die Küche und die Spülküche und dergleichen, das ist alles im Parterre.“
Als sie durch die breite Flügeltür traten, fiel Ediths erster Blick auf ihren lächelnden Vater, der ihr mit seinem vertraut schiefen Gang entgegenkam, die Folge eines Fahrradunfalls vor dem Krieg in Berlin.
Dann sah sie Sadie am Fenster stehen, und ihre Freude versickerte wie Wasser aus einem Becken, in dem man den Stöpsel gezogen hat. Sie hatte nicht erwartet, ihre Schwester hier zu treffen: Sadie, die, hübsch und lebhaft, wie sie war, alle überstrahlen und die ganze Aufmerksamkeit ihres Vaters für sich in Anspruch nehmen würde. Sadie, die ihr alles verderben würde.
Cyril legte den Arm um sie, um ihr zu zeigen, dass er verstand, was in ihr vorging. „Ein atemberaubendes Haus, Edward“, sagte er zu ihrem Vater. „Da kann man nur gratulieren.“ Aber Edith gelang es nicht, ihre Mimik zu beherrschen und Groll und Enttäuschung zu verbergen.
Ihr Vater hatte sie nach Sussex eingeladen, um ihr das fertige Haus zu zeigen, und sie war an diesem Tag in der Erwartung nach Gull’s Wing gefahren, ihn ganz für sich zu haben. Und nun war Sadie da. Sie wusste, dass sie sich selbst den Tag verderben und ihr Vater sich von ihrer Einsilbigkeit abwenden würde, um sich stattdessen mit Sadie zu unterhalten. Was er vielleicht ohnehin getan hätte. Ihm und Sadie fiel das Reden so leicht. Mit einer Wendigkeit, die Edith fehlte, wechselten die beiden vom oberflächlichen Geplauder zum tiefgründigen Gespräch und zurück. Sie selbst war zu bemüht und wirkte in ihrer krampfhaften Suche nach der klugen oder geistreichen Bemerkung, die seinen Beifall finden würde, oftmals langsam und schwerfällig.
Sie verharrte den Rest des Tages in ihrer vorwurfsvollen Haltung, und als sie um fünf zur Rückfahrt nach London aufbrachen, verabschiedete sie sich kühl und mit pflichtschuldigem Kuss von ihrem Vater, ohne zu ahnen, dass es ihre letzte Begegnung sein würde. Wenig später reisten ihre Eltern nach Frankreich, und man sah sich über Weihnachten nicht. Drei Wochen später verunglückte das Flugzeug, in dem Edward und Victoire Lawless von Le Touquet aus nach Sussex zurückflogen, in einem Schneesturm vor der Küste. Die Zeitungen brachten Nachrufe, und das Telefon läutete unablässig, als Freunde und Kollegen anriefen, um ihr Beileid zu bekunden. Eben noch waren sie da gewesen, nun waren sie fort, ausgelöscht vom wirbelnden Weiß.
Ihre Tränen flossen unaufhörlich, und als sie schluchzend zu Cyril sagte, dass ihr Vater nun niemals mehr stolz auf sie sein würde, schüttelte er den Kopf. „Er war stolz auf dich, Liebling. Ich weiß es. Ich habe es gesehen.“ Seine Worte trösteten sie ein wenig, aber später, nach der Eröffnung des Testaments, entdeckte sie, dass Cyril, der klügste Mensch, den sie kannte, der Mann, der sich kaum je irrte, in diesem Fall doch geirrt hatte. Sie liebte die zwei Häuser, die ihr Vater in Sussex gebaut hatte, The Egg und The Gull’s Wing, doch er hatte sie beide Sadie hinterlassen. Wenn er ihr Gull’s Wing vermacht hätte und das kleinere The Egg Sadie, wäre das gerecht gewesen, da Sadie die Jüngere war; aber selbst wenn er ihr nur The Egg vererbt hätte, hätte sie gewusst, dass er ihrer gedacht – dass er sie geliebt hatte.
Im ersten Moment des Schocks wurde ihr übel – dann packte sie die Wut. Sie schrie Cyril an, dass sie das Testament anfechten werde, worauf er ihr behutsam erklärte, dass ein solches Vorgehen sinnlos sei. Das Testament war formgerecht abgefasst und bezeugt. Edward Lawless hatte weder unter einer Einschränkung seiner geistigen Fähigkeiten gelitten noch unter unzulässiger Beeinflussung gestanden.
Edith gab Sadie die Schuld. Erst viel, viel später erkannte sie, dass sie ihrem Vater die Schuld hätte geben sollen.
„Sadie ist nicht verheiratet“, argumentierte Cyril, bemüht, vernünftig mit ihr zu reden. „Es besteht kaum Aussicht, dass sie je heiraten wird. Deshalb hat dein Vater ihr die Häuser hinterlassen, zu ihrer Sicherheit.“
Edith entgegnete bitter, Sadie sei selbst schuld an ihrer Situation. Welcher Mann wolle schon eine Frau heiraten, die sich wie eine Zigeunerin kleidete und eigensinnig darauf bestand, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen? Eine Frau, die fluchte und in der Öffentlichkeit rauchte?
„Edith, Edith“, flehte Cyril, „du darfst Sadie nicht hassen. Damit tust du dir nur selbst weh.“
Und genauso war es gekommen. Sie ließ ihre Schwester ganz einfach aus ihrem Leben gleiten. Sadie, die Glanz in jedes Zimmer brachte, die glitzernd und sprunghaft war wie ein Waldbach, die temperamentvoll und spritzig sein konnte, aber auch schweigsam und in sich gekehrt. Seit dem Tag ihrer Geburt hatte Sadie bei ihrer älteren Schwester derart widerstreitende und schwer zu entwirrende Gefühle hervorgerufen, dass diese am Ende zornig und erschöpft die Flucht angetreten hatte.
1
Surrey, Mai 1970
Edith Fullers Freunde und Bridgepartner standen mit steifen Gliedern vom Tisch auf, um sich die Beine zu vertreten und noch etwas miteinander zu plaudern, als das Trauermahl zu Ende ging.
Robert Martineau legte seiner Frau den Arm um die Schultern. „Wie fühlst du dich?“
„Es geht schon“, antwortete Rose. „Aber Großmutter wird mir fehlen.“ Sie sah lächelnd zu ihm auf. „Unsere gemeinsamen Mittagessen: Curry und rosa Pudding.“
„Ich weiß, Liebes.“ Robert sah auf seine Uhr. „Ich muss los.“
„Ich dachte, du wolltest dir den Nachmittag freinehmen?“
„Zu viel Arbeit. Leider. Wir sehen uns später.“ Robert gab ihr noch einen Kuss, dann ging er.
„Rose.“
Sie drehte sich um, als sie die Stimme ihres Vaters hörte. „Hat Katherine das nicht schön gemacht, Dad?“ Ihre sechsjährige Tochter Katherine hatte am Morgen bei der Trauerfeier Rudyard Kiplings Gedicht If – vorgelesen.
„Ich hatte feuchte Augen. Ich geb’s zu.“ Giles Cabourne öffnete die Saaltür. „Ich muss etwas mit dir besprechen, Rose. Wollen wir einen Moment hier rausgehen, wo es ruhiger ist?“
Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Katherine und ihre kleine Schwester, die vierjährige Eve, sich bestens mit einer alten Freundin der Familie unterhielten, folgte sie ihrem Vater in den Korridor.
„Deine Großmutter hat mich zu einem ihrer Testamentsvollstrecker bestellt“, sagte Giles. „Abgesehen von einigen kleineren Vermächtnissen hat sie alles dir hinterlassen, Rose.“
„Oh, Dad.“ Sie drückte die Hand auf den Mund.
„Es ist kein Vermögen, aber immerhin einiges an Geld, und ihre Wohnung, natürlich.“
„Ich hatte keine Ahnung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.“ Aber wem sonst hätte ihre Großmutter ihre Habe hinterlassen sollen? Edith Fuller war Witwe gewesen und hatte nur eine Tochter gehabt, Louisa, Roses Mutter, die vor neun Jahren gestorben war. Und Rose war selbst ein Einzelkind.
Ihr Vater sagte: „Und es ist noch ein Haus in Sussex da.“
Rose und ihr Vater drückten sich an die Wand, um eine Bedienung in schwarzem Kleid und weißem Rüschenschürzchen vorbeizulassen, die ein Tablett voller Gläser trug.
„Ein Haus?“, wiederholte Rose erstaunt. „Was für ein Haus, Dad?“
Giles strich sich mit einer Hand über das gelichtete graue Haar. „Ich erinnere mich vage, mal davon gehört zu haben. Es ist Jahre her. Ich hatte es, ehrlich gesagt, komplett vergessen.“
„Ein Haus …“
„Irgendwo in der Pampa. Keine Ahnung, in was für einem Zustand es sich befindet. Ediths Anwalt zufolge hat es ihr schon sehr lange gehört. Sie hat nie darin gewohnt, hat es immer vermietet. Du kennst deine Großmutter, Rose – sie war nie sehr mitteilsam. Wie dem auch sei, das Haus gehört jetzt dir, Schatz.“
Eine Schulfreundin ihrer Großmutter, eine zierliche Frau, einen Kopf kleiner als Rose, mit einem schwarzen Hut und einem Mantel aus lavendelblauem Seidenkrepp, trat aus dem Saal, um sich zu verabschieden.
Man gab sich die Hände, bedankte sich und wünschte sich gegenseitig alles Gute.
Als sie wieder allein waren, zog Giles einen Umschlag aus seiner Jackentasche und reichte ihn Rose. „Edith hat in ihrem Testament darum gebeten, dass dir nach ihrem Tod dieser Brief übergeben wird. Vielleicht erfährst du darin mehr.“
Sie fühlte sich benommen. „Granny hat nie mit mir über das Haus gesprochen. Nie.“
Bei einem Blick durch die Glastür sah sie Eve eifrig damit beschäftigt, das Salz aus den Streuern auf den Tisch zu kippen und einen kleinen, glitzernden weißen Berg anzuhäufen.
„Dad, ich muss rüber.“ Sie umarmte ihren Vater kurz. „Eine Wohnung und ein Haus … Wahnsinn.“ Dann lief sie in den Saal, nahm ihre kleine Tochter bei der Hand und führte sie sehr bestimmt vom Tisch weg.
Auf den ersten Blick hätte man Katherine und Eve sicher nicht für Schwestern gehalten. Katherine war groß, schlank und langgliedrig, hatte die grauen Augen ihrer Mutter und das feine, glatte, rotblonde Haar ihrer Großmutter Martineau geerbt. Eve war klein und stämmig, mit braunen Augen, die sie von Robert mitbekommen hatte, und wuscheligen dunklen Locken. Katherine war ein liebevolles und großzügiges Kind, eine kleine Perfektionistin, die von sich selbst und anderen erwartete, dass sie ihr Bestes gaben, manchmal aber auch ungeduldig und gereizt reagieren konnte. Eve war ein Energiebündel, ein kleines Plappermaul, ein sonniges, unbekümmertes Kind, das bisweilen von einem wilden Kummer erfasst wurde. Dass die beiden Schwestern waren, erkannte man höchstens an ihrer Lebhaftigkeit und der Ähnlichkeit eines Blicks oder einer Bewegung.
Nachdem Rose ihre jüngere Tochter zu Hause in Walton-on-Thames zu Bett gebracht hatte, ging sie zu Katherine, die drüben in ihrem Zimmer im Schlafanzug auf dem Boden kniete und mit ihrem Spirograph kämpfte.
„Ach!“ Ein frustrierter Aufschrei. „Der Stift rutscht immer raus.“
„Leg das jetzt weg, Schatz. Du kannst morgen weiterspielen. Wo ist dein Buch? Bis acht darfst du noch lesen.“ Rose tippte auf den Wecker auf dem Nachttisch.
Als sie die Mädchen endlich beide im Bett hatte, ging sie nach unten. Robert kam wenig später nach Hause. In der Küche, wo das Abendessen auf dem Herd köchelte, machte sie zwei Gin Tonics, und nachdem sie Robert sein Glas gebracht hatte, erzählte sie ihm vom Testament ihrer Großmutter, der Wohnung und dem Haus in Sussex.
„Du meine Güte“, sagte er, „meine Frau, die Immobilienkönigin.“
„Dieses Haus … ich hatte keine Ahnung, dass es überhaupt existiert. Wahrscheinlich ist es eine alte Bruchbude. Ich versteh nicht, warum Granny nie was davon gesagt hat. So ein Haus ist doch eine zu große Sache, um sie so einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Findest du nicht auch?“
„Doch, find ich auch.“
„Es hat sogar einen Namen – The Egg. Ziemlich schräg, oder? Grannys Vater hat es gebaut. Du weißt schon, der Architekt.“ Sie sah ihn forschend an. „Robert?“
„Hm?“
Er gab sich den Anschein, als hörte er zu, aber er war mit seinen Gedanken woanders. Sein Blick war abwesend.
„Ist irgendwas?“, fragte sie.
„Was?“ Ein flüchtiges Lächeln. „Aber nein, gar nichts. Schlafen die Mädchen schon?“
„Eve bestimmt. Katherine auf gar keinen Fall.“
„Ich seh mal nach ihnen.“
„George hat angerufen“, rief sie ihm nach, als er schon auf dem Weg nach oben war.
George war Roberts älterer Bruder, unverheiratet, hoher Beamter in irgendeinem Ministerium. Die beiden Brüder verstanden sich nicht.
Mit gerunzelter Stirn drehte Robert sich um. „Was wollte er denn?“
„Mit dir über die Feier für deine Eltern reden.“ Lionel und Mary Martineau würden bald ihren 40. Hochzeitstag feiern. „Festreden und Blumen.“
Als sie später zu Bett gingen, presste sie sich an ihn. Er wandte sich ihr zu und spielte mit den Fingerspitzen über die kleinen Höcker auf ihrem Rücken. Ihre Umarmung war voller Hast und Bedürftigkeit.
Danach schlief Robert ein. Rose jedoch ließ die Erinnerung an die Ereignisse des Tages nicht schlafen: die Beerdigung ihrer Großmutter, das unerwartete Erbe – und das Haus in Sussex, The Egg.
In dem Brief hatte ihre Großmutter geschrieben:
„In den 1920er-Jahren baute mein Vater, der Architekt Edward Lawless, auf seinen Grundstücken in Sussex zwei Häuser. Beide zeichnen sich durch ihre moderne Gestaltung aus. Mein Vater sagte immer, sie seien seine Meisterwerke, sein Vermächtnis. Er und meine Mutter hatten vor, sich in Gull’s Wing niederzulassen, dem größeren Haus, das er am Höhenweg erbaut hatte, doch kurz nach seiner Vollendung kamen sie beide im Januar 1929 ums Leben. Danach wurde das Haus verkauft. Dir, Rose, vermache ich das kleinere der zwei Häuser, The Egg. Ich habe es immer vermietet, doch mein letzter Mieter, Mr. Manners, der mehr als ein Jahrzehnt dort gelebt hat, ist vor sechs Monaten gestorben; es steht also derzeit leer.“
Es folgte eine ziemlich komplizierte Wegbeschreibung – eine Straße, die in Nutcombe an der Kirche vorbeiführt … du musst an der Wegbiegung auf halber Höhe parken … ein Fußweg durch die Bäume. Dazu, in Papier eingeschlagen, zwei Schlüssel, ein Yale-Schlüssel und ein kleinerer.
Sie hatte Durst. Unten in der Küche ließ sie sich ein Glas Wasser einlaufen. Sie wusste wenig über ihre Urgroßeltern, Ediths Eltern. Edward Lawless war ein Architekt gewesen, der zusammen mit seiner Frau bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen war – das war so ziemlich alles. Nun erfuhr sie, dass die beiden sich ein Haus gebaut, es jedoch nie bewohnt hatten. Gull’s Wing. Vielleicht hatte ihre Großmutter deshalb nie von dem Haus in Sussex gesprochen, weil es zu eng mit dem tragischen Tod ihrer Eltern verbunden war.
In jedem Haus steckt viel von einem selbst. Sie und Robert hatten ihr Haus vor fünf Jahren gekauft, ein großzügiges Reiheneckhaus, zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut, mit Erkern und einem Windfang, wie zu jener Zeit üblich. Sie hatten sich in die hohen Räume verliebt und in den Glanz des Lichts auf den Holzdielenböden. Die Zimmer hatten Stuckleisten und gekachelte offene Kamine, und hinter dem Haus war ein verwilderter Garten mit Rosen, Jelängerjelieber und Brombeerbüschen. Nach ihrem Einzug hatten sie das Haus in Eigenregie von oben bis unten renoviert, gemalert und tapeziert. Sie hatten die Armaturen erneuert, sogar neue Leitungen gelegt und die Vollendung des Werks mit einer Flasche Champagner auf der Terrasse gefeiert. Der Garten war noch immer eine Wildnis – sie besaßen beide kein Talent zum Gärtnern.
Das Chaos und die Strapazen jener Tage fehlten ihr gewiss nicht, aber gerade jetzt musste sie daran denken, wie nahe sie einander bei der Arbeit gewesen waren. Wären sie heute in das Haus gezogen, so hätten sie Handwerker genommen. Roberts Geschäfte – zwei Autowerkstätten, mehrere kleine Ingenieurbüros und seine neueste Erwerbung, ein Flugfrachtunternehmen – hatten sich in den letzten Jahren glänzend entwickelt, und er hätte sich für den aufwendigen Umbau gar nicht mehr die Zeit nehmen können.
Als sie Robert kennenlernte, war sie einundzwanzig gewesen, hatte gerade ihr Bachelorstudium in Physik abgeschlossen und überlegt, ob sie weiterstudieren sollte. Einerseits zolg es sie in die Welt hinaus, andererseits hatte ein Abschluss als Master of Science durchaus praktische Vorteile. Um sich Bedenkzeit zu geben, nahm sie für den Sommer eine Aushilfsstellung bei einem Ingenieurbüro an, wo sie etwas Geld verdienen und Erfahrung sammeln konnte.
Als die Sekretärin des Direktors in Urlaub ging, bat man Rose einzuspringen. Genau an dem Tag kam Robert zu Besuch. Sie begrüßte ihn am Empfang. Auf der Treppe nach oben erkundigte er sich nach ihrem Namen; im Flur, auf dem Weg zum Büro des Direktors, bat er sie, mit ihm essen zu gehen. Sie sah noch mehr in ihm als sein gutes Aussehen und seinen Charme, etwas Beständigeres vielleicht; jedenfalls sagte sie Ja.
Robert war ein Mann, der unweigerlich auffiel, groß und breitschultrig, kontaktfreudig und selbstsicher, dunkel, mit einer starken Ausstrahlung. Er hatte etwas im Blick, das ihr zeigte, dass ihre Antwort ihm wichtig war. Beim Essen entdeckte sie, dass er nicht nur tatkräftig und entschlossen, sondern auch intelligent, witzig und großzügig war.
Sechs Monate später heirateten sie. Katherine wurde im folgenden Jahr geboren. Mit zweitem Namen wurde sie Louisa getauft, nach Roses Mutter, die drei Jahre zuvor an Brustkrebs gestorben war. Eve Mary Rose – Mary war sie nach Roberts Mutter benannt, die gesund und munter mit ihrem Mann in Oxfordshire lebte – kam zwei Jahre später zur Welt.
Rose räumte das bisschen Geschirr auf, das noch auf dem Abtropfbrett neben der Spüle lag. Das feine Gefühl von Langeweile, das sich eingestellt hatte, seit Eve im April zur Schule gekommen war, die Lustlosigkeit, die Richtungslosigkeit und die Unzufriedenheit, die sie mit der Erfüllung häuslicher Aufgaben und gesellschaftlicher Verpflichtungen zurückzudrängen versuchte, senkten sich über sie wie eine graue Hülle. Sie hatte Ambitionen gehabt. Sie hatte sich ein Leben mit großen, ja, ungewöhnlichen Zielen vorgestellt, stattdessen war sie, ohne sich eigentlich wirklich dafür entschieden zu haben, Hausfrau geworden. So wie ihre Mutter, die nie etwas anderes getan hatte, als sich um Haus und Familie zu kümmern. Rose hatte gemeint, bei ihr würde es anders werden, aber was tat sie? Sie bewirtete Roberts Geschäftsfreunde und klaubte seine Socken zusammen. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, vor Katherines Geburt, da hatte sie Roberts Sachen aus Prinzip einfach liegen lassen. Inzwischen hatte sie ihren Widerstand aufgegeben und räumte ihm brav hinterher.
Manchmal hatte sie das Gefühl, immer kleiner und dünner zu werden, zu etwas zu schrumpfen, das sie nie hatte sein wollen. Die Gewichte hatten sich verlagert. Robert arbeitete viel, und es gab keine festen Zeiten, sehr oft führte er abends Kunden zum Essen aus. Bisweilen begleitete sie ihn. Häufiger lehnte er ihr Angebot mit der Begründung ab, sie werde sich nur langweilen.
Vielleicht sollte sie sich eine Halbtagsarbeit suchen. Sie war allerdings wenig optimistisch, dass sie mit ihrem Angebot, einem angestaubten Bachelorabschluss in Physik und Arbeitszeiten, die sich nach den Tagesläufen ihrer Töchter richten mussten, Erfolg haben würde. Doch es quälte sie, dass das Kreuzworträtsel zur einzigen intellektuellen Herausforderung des Tages geworden war, und sie wusste sehr wohl, dass sie sich die langen, stillen Abende gelegentlich schöntrank.
Sie haderte mit sich selbst. Es begann ja schon zur Gewohnheit zu werden, dieses ständige Wühlen in ihrer Unzufriedenheit, diese Suche nach einer Möglichkeit des Ausbruchs – woraus denn? Aus einem sorgenfreien, komfortablen Leben. Sie hatte ihren eigenen Wagen, regelmäßige Urlaube, eine Putzfrau. Sie hatte zwei hübsche, gesunde Töchter und einen Ehemann, der sie liebte.
Trotzdem fehlte ihr Eve, ihre Kleine, ihr fröhliches Geplapper, der innige Kontakt mit der kleinen, warmen Hand, wenn sie zusammen einkaufen gingen. Sie hasste die Stille, die sich in den leeren Räumen staute, sie hasste die strukturlosen Tage, wenn die Kinder in Kindergarten und Schule waren, und es fiel ihr schwer zu begreifen, dass die Zeit der frühen Mutterschaft mit ihrem sprudelnden Überschwang von Gefühlen für immer vorbei war. Vielleicht sollten sie versuchen, noch ein Kind zu bekommen. Sie war erst neunundzwanzig, reichlich Zeit.
Ihr fiel das unerwartete Vermächtnis ihrer Großmutter ein, mit dem sie zumindest in den kommenden Wochen mehr als genug zu tun haben würde. Eine Wohnung musste aufgelöst, ein mysteriöses Haus in Sussex besichtigt werden. Die Aussicht munterte sie auf. Sie trank das Glas Wasser aus und ging wieder nach oben.
Die Wohnung in Weybridge war vollgestellt mit schweren, dunklen Möbeln und überladen mit Andenken an die Jahre, die Edith Fuller als Frau eines Kolonialbeamten im Ausland verbracht hatte – Drucke von Old Delhi, eine schwarze Holzfigur und, vor dem offenen Kamin, das platt getretene, verblasste Fell irgendeines bedauernswerten wilden Tiers.
Rose nahm zuerst die Schränke in Angriff. Kleider waren etwas so Persönliches, so stark mit Erinnerungen an den verbunden, der sie getragen hatte. Ein weinroter Mantel mit Pelzkragen rief ihr einen Herbstausflug in den Bushy Park ins Gedächtnis, wo in der Ferne die Rehe wie Schatten im Dunst gestanden hatten, während ihre Großmutter von den Safaris in Kenia erzählte und die beiden kleinen Mädchen unter den Bäumen herumtollten. Als sie einen Liberty-Schal zur Hand nahm, der noch zart nach Arpège duftete, dem Parfum ihrer Großmutter, traten ihr Tränen in die Augen.
Richtig kennengelernt hatte sie ihre Großmutter erst vor relativ kurzer Zeit. Als sie ein Kind gewesen war, hatten Edith und ihr Mann Cyril im Ausland gelebt – zunächst in Indien und später, nachdem Britisch-Indien seine Unabhängigkeit erlangt hatte, in Kenia. Regelmäßig zweimal im Monat waren Luftpostbriefe eingetroffen. Wenn ihre Großeltern zu Besuch kamen, wohnten sie im Haus der Familie in Weybridge, in dem damals noch Roses Vater lebte. Meist flogen sie schon einen Monat später zurück nach Afrika, und Rose musste drei Jahre auf ihren nächsten Besuch warten. Nach Cyrils Tod verkaufte Edith das gemeinsame Haus in Nairobi und kehrte nach England zurück. Roses Mutter, Ediths Tochter Louisa, war zu der Zeit schon krank, und Rose und ihre Großmutter versuchten einander Trost zu spenden. Edith war kein Mensch gewesen, der emotionale Nähe suchte oder förderte, dennoch hatten sie einander geliebt und respektiert.
In einer Schublade entdeckte Rose regelrechte Schätze: ein Abendkleid aus minzgrünem Satin, schräg geschnitten, ein Paar blassgraue Glacéhandschuhe und ein zierliches Perlentäschchen. Sie legte die Sachen auf die Seite, um sie mit nach Hause zu nehmen. Die Taschenbücher von Dennis Wheatley und Eric Ambler, beides Autoren, die ihre Großmutter gemocht hatte, würde sie in ein Antiquariat bringen. Mehrere Bände einer Militärgeschichte Indiens beschloss sie aufzuheben. Vielleicht würde ihr Schwiegervater an ihnen Gefallen finden.
Aber was sollte sie mit dem Vogelkäfig aus Elfenbein anfangen und der unglaublich hässlichen Elefantenuhr, die ihre Großmutter so geschätzt hatte? Oder mit dem cremefarbenen Wedgwood-Porzellan und der Midwinter-Teekanne, schön zwar und eng mit der Person ihrer Großmutter verbunden, aber so wertvoll, dass sie jedes Mal zittern würde, wenn Katherine oder Eve ihnen nur nahe kamen? Sie fragte sich, ob das Haus in Sussex – The Egg – ebenso mit Möbeln und Schnickschnack überladen war wie diese Wohnung. Hoffentlich nicht. Wenn es möbliert vermietet gewesen war, würde sie dort wohl eher durchgesessene Sofas und bunt zusammengewürfeltes Geschirr vom Flohmarkt vorfinden. Wie sollte sie mit dieser unerwarteten Erbschaft umgehen? Robert ging davon aus, dass sie beide Immobilien verkaufen würde, sobald das Testament eröffnet war. Rose war sich noch nicht sicher.
Als Nächstes nahm sie sich den Sekretär aus afrikanischem Padouk vor, ein Riesenmöbel, mit vergoldeten Schnitzereien gekrönt, oben und unten Schränkchen und Schubladen und in der Mitte eine Schreibfläche.
Sie klappte die Schreibplatte auf und sah sich den Inhalt der verschiedenen Fächer an: ein grüner Osmiroid-Füller, eine Flasche Quink und eine Handvoll Bleistifte, eine Schere und eine Rolle Tesa, Rechnungen und Quittungen, mit Gummibändern gebündelt.
Als sie an einem kleinen, leicht zu übersehenden Elfenbeinknopf unter den Schreibtischfächern zog, öffnete sich eine flache Schublade, in dem eine Mappe in einem orangefarbenen, mit gelben und goldenen Vögeln bedruckten Einband lag. Briefe und einige Fotografien glitten heraus: ein Mann mit Tropenhelm, hoch auf einem Elefanten, dann ein Säugling, dessen zerknittertes Gesichtchen von Spitzengeriesel umrahmt war.
Auf eine weiße Postkarte hatte jemand mit Tusche die Karikatur einer Frau in einem wadenlangen, pelzbesetzten Mantel und einem Kapotthut gezeichnet. Den Hut tief über die Augen gezogen, stakste sie auf hohen Absätzen unsicher die Straße entlang. Rose drehte die Karte um. „Bin ich nicht der letzte Schrei, Schatz?“, stand auf der Rückseite. „Wenn ich nur sehen könnte, wohin ich eigentlich gehe.“ Unterschrieben mit „S“.
Rose machte sich eine Tasse Nescafé, den ihre Großmutter mit Vorliebe getrunken hatte. Wie oft hatten sie hier mittags bei einer Kanne Nescafé gesessen und dazu die von ihrer Großmutter geliebten Geleefrüchte gegessen, die Rose stets mitbrachte, wenn sie sie besuchte. Und während ihre Großmutter Geschichten aus Indien und Afrika erzählte, behielt Rose ständig Eve im Auge, damit diese keines der kostbaren Objekte im Zimmer hinunterwarf. Edith Fuller hatte eine klare, gebieterische Art zu sprechen. Rose vermutete, dass sie den Ton kultiviert hatte, als sie in den Kolonien über Turban tragende Diener, Boys und Hausmädchen geboten hatte – Zubehör einer anderen, untergegangenen Welt.
Sie stellte die Kaffeetasse auf einen Beistelltisch und setzte sich mit der Schreibmappe aufs Sofa. Eine Fotografie flatterte zu Boden, und sie hob sie auf. Der Schnappschuss in Schwarz-Weiß zeigte zwei junge Frauen, beide in losen, wadenlangen Mänteln, mit Hüten, die – aus irgendeinem festen Material, Samt vielleicht – wie gedrechselt wirkten. Obwohl das Foto sicher fünfzig oder sechzig Jahre alt war, erkannte Rose ihre Großmutter auf den ersten Blick. Mit achtzig war Edith eine große, hagere Frau gewesen, mit schmalem, länglichem Gesicht, aus dem zwischen den hohen Wangenknochen scharf die gebogene Nase hervorsprang. Und so wirkte sie auch auf dem alten Foto, nur eben weit jünger und entsprechend weicher in den Konturen. Und natürlich waren ihre Haare nicht grau, sondern dunkel.
Die junge Frau neben ihr war kleiner und zierlicher. Ihr hübsches, ebenmäßig geschnittenes Gesicht erhellte ein offenes Lächeln. Von der Krempe ihres Hutes hing frech eine Troddel zu ihrer Schulter hinab, und sie hatte eine Hand erhoben, um sich eine helle, windgezauste Haarsträhne aus den Augen zu streichen. Rose drehte das Foto um und las die beiden Namen, die in verblasster Tinte auf der Rückseite standen. „Edith“, bestätigte, was sie schon erkannt hatte: dass die Größere der Frauen ihre Großmutter war. Die andere hieß Sadie. Vielleicht, dachte Rose, war das jene „S“, die die Karikatur auf der Postkarte gezeichnet hatte.
Sie trank einen Schluck Kaffee und sah sich die Briefe in der Mappe an. Neugierig, aber auch mit einem gewissen Widerstreben, im Privatleben ihrer Großmutter zu kramen, entfaltete sie eines der Schreiben. Es war von einer Frau namens Margery Burton, auf den ersten Blick ein freundschaftlicher Gruß, bei näherem Hinsehen eine Bitte um Geld. Ein dickes Bündel Briefe stammte von Cyril, ihrem Großvater. Vielleicht waren es Liebesbriefe. Sie legte sie zur Seite. In einem weiteren Bündel waren mit einem rosa Bändchen einige Briefe von Louisa, ihrer Mutter, zusammengefasst. Rose hatte viele Briefe von ihrer Mutter zu Hause, Briefe, die diese ihr geschrieben hatte, als sie auf dem Internat und an der Universität gewesen war. Seit ihrem Tod konnte Rose sie nicht mehr lesen. Sie war nicht sicher, ob sie es je wieder können würde.
Als sie schon dachte, alle Briefe aus der Mappe genommen zu haben, entdeckte sie in einem flachen Seitenfach doch noch ein dünnes Bündel und öffnete den obersten Umschlag aus schwerem cremefarbenen Papier. Bevor sie zu lesen begann, warf sie einen Blick zum Ende des Texts.
Sadie. Diesen Brief hatte also die hübsche, blonde Sadie geschrieben, die auf dem Foto zu sehen war. Die Schrift war altmodisch, aber sehr klar.
Rose begann zu lesen: „Ich kann unmöglich alle vierzehn Tage zu Philip Sprott nach London fahren, Edith. Das wäre viel zu teuer – bei seinen Honoraren und den Bahnpreisen. Außerdem geht es mir inzwischen wirklich gut. Du brauchst Dir um mich keine Gedanken zu machen, wirklich nicht.“ Man hörte förmlich die Gereiztheit hinter den Worten.
In einem anderen Brief schrieb Sadie: „Ich bin voraussichtlich vom 5. bis zum 9. in der Stadt. Passt es euch, wenn ich vorbeikomme? Ich habe Louisa ja seit Ewigkeiten nicht gesehen. Hat sie schon Schulferien, ist sie zu Hause?“ Und ein Stück weiter unten auf derselben Seite: „Zu dieser Jahreszeit ist es herrlich hier in The Egg, die Schlüsselblumen blühen, und die Vögel zwitschern aus voller Kehle. Ich hoffe sehr, Du kommst mich bald mal besuchen.“
Das war interessant. Sadie hatte also in The Egg gelebt. Der Briefkopf bestätigte es: The Egg, Paley High Wood, Nutcombe, Sussex. Vielleicht hatte Sadie die Wohnung von Edith gemietet – aber nein, der Ton der Briefe deutete auf eine persönlichere Beziehung hin. Vielleicht hatte Edith das Haus eine Zeit lang einer Freundin überlassen.
Rose sah auf die Uhr, es war gleich Viertel nach drei. Höchste Zeit, dass sie losfuhr, wenn sie Katherine und Eve in Walton-on-Thames von der Schule abholen wollte. Als sie begann, die Briefe zu ordnen, fiel ihr Blick auf einen Namen, der als Absender auf einem blauen Luftpostumschlag stand: Sadie Lawless.
Sie kniff die Augen zusammen. Lawless war der Mädchenname ihrer Großmutter gewesen. War Sadie Lawless vielleicht eine Verwandte? Sie überflog den kurzen Brief und las ihn gleich noch ein zweites Mal, um sicherzugehen, dass sie richtig verstanden hatte.
Sadies Schreiben brachte Rose zwei Erkenntnisse: zum einen, dass The Egg nicht immer Edith gehört hatte. In den frühen 1930er-Jahren war das Haus Sadies Eigentum gewesen. Aber – sie schaute auf das Datum – im Oktober 1934 hatte Sadie das Haus Edith überlassen.
„The Egg gehört jetzt Dir, Edith“, schrieb Sadie. „Ich habe die Unterlagen an Mr. Copeland geschickt. Ich will nicht mehr hier sein. Das Haus macht mir Angst, und außerdem war es nicht richtig von Vater, es mir zu vermachen – das weiß ich jetzt.“
Die zweite Erkenntnis war eine Riesenüberraschung. Sadie Lawless war nicht irgendeine Verwandte von Edith.
Sie war ihre Schwester.
Rose hatte gemeint, ihre Großmutter zu kennen, aber das war offenbar nicht der Fall gewesen. Edith hatte eine Schwester gehabt. „Wie groß unsere Differenzen auch sein mögen, Edith“, hatte Sadie Lawless am Ende ihres Briefes geschrieben, „Du bist meine Schwester.“
Robert roch nach Tabak und Alkohol, als er sich in den frühen Morgenstunden leise neben ihr im Bett ausstreckte.
„Ein Kunde“, murmelte er, als sie fragte, wo er gewesen sei. „Tommy Henderson. Du weißt schon, der Besitzer vom Riley’s in Gateshead. Eine Nervensäge.“ Er zog sie an sich, schob seine Hand auf ihre Brust und schlief augenblicklich ein.
Als Rose am nächsten Morgen das Haus betrat, nachdem sie Katherine und Eve zur Schule gebracht hatte, griff sie beinahe wider ihren Willen in die Taschen seines Trenchcoats, der am Ständer im Flur hing. Was glaubte sie denn zu finden? Heimlichkeiten. Jeder Mensch hatte seine Heimlichkeiten. Ihre Großmutter hatte jede Menge davon gehabt. Roberts würden vielleicht durch einen Brief, eine Rechnung oder ein Taschentuch mit Lippenstiftflecken an den Tag kommen. Vor ein paar Jahren hatte er einen Flirt – er hatte geschworen, es sei nur ein Flirt gewesen – mit der Frau eines Bekannten gehabt. Daran musste Rose jetzt denken. Die langen Abende, seine Zerstreutheit … Er verschwieg ihr etwas, dessen war sie sich sicher.
Die Taschen waren leer. Beschämt vertrieb sie die hässlichen Gedanken.
Was war eine Ehe ohne Vertrauen? Robert hatte geschäftliche Schwierigkeiten. Er würde sie regeln, wie immer. Sie musste ihm vertrauen.
Sie mahlte Kaffee und schaltete die Kaffeemaschine an, dann setzte sie sich mit der orange-goldenen Mappe an den Tisch. Irgendwann in der Nacht war ihr klar geworden, dass sie Sadies Briefe hatte finden sollen. Ihre Großmutter hatte es so beabsichtigt. Sie hatte ihr etwas mitteilen wollen. Oder sie dazu bringen wollen, dass sie etwas tat. Etwas, das mit dem Haus und ihrer Schwester Sadie zusammenhing.
Die Kaffeemaschine blubberte vor sich hin, während Rose die Briefe herausnahm und auf dem Tisch auslegte. Insgesamt waren es fünfundzwanzig, einige auf dem teuer wirkenden cremefarbenen Leinenpapier geschrieben, andere auf dünneren blauen oder weißen Bögen. Sadie hatte jeden ihrer Briefe datiert. Es dauerte eine Weile, sie in chronologischer Reihenfolge zu ordnen, und sie gönnte sich dazwischen eine Pause, um sich einen Becher Kaffee zum Tisch zu holen.
Alle Briefe waren in der ersten Hälfte der 1930er-Jahre geschrieben. Der erste, vom Oktober 1930, war das kurze, gereizte Schreiben, das Rose am Vortag in der Wohnung ihrer Großmutter überflogen hatte. Edith hatte zu der Zeit in London gelebt. Sadies letzter Brief datierte vom Oktober 1934 und war nach Delhi gegangen, wo Edith damals gelebt hatte. Weitere Briefe gab es nicht. Warum? Warum hatte Sadie von diesem Zeitpunkt an ihrer Schwester nicht mehr geschrieben? Was war passiert?
Als Rose den ersten Brief noch einmal las, sah sie, dass im Briefkopf eine Adresse in Cambridge angegeben war. „Ich kann unmöglich alle vierzehn Tage zu Philip Sprott nach London fahren, Edith. Das wäre viel zu teuer – bei seinen Honoraren und den Bahnpreisen. Außerdem geht es mir inzwischen wirklich gut.“
Philip Sprott musste ein Arzt sein. Sadie war krank gewesen und hatte sich von Dr. Sprott behandeln lassen, den sie in jener Zeit – da es den National Health Service noch nicht gab – vermutlich aus eigener Tasche bezahlen musste. Rose las weiter. „Die Meyricks waren unglaublich nett. Toby hat mich in seinem Arbeitszimmer übernachten lassen, und Constance hat mich rührend umsorgt. Es geht mir viel besser jetzt. Jeden Nachmittag mache ich einen Spaziergang im Midsommer Common, ganz egal, wie das Wetter ist.“ Dann ein paar Zeilen über die Bücher, die sie gelesen, ein Nachmittagskonzert, das sie besucht hatte. Weiter unten hieß es:
„Mabel, Horace und Rosalind sind natürlich ganz entzückende Kinder, aber sie lassen einem kaum Zeit, einen Gedanken zu Ende zu denken. Nicht dass ich in letzter Zeit viele Gedanken hervorgebracht hätte, die zu Ende zu denken sich gelohnt hätte, aber ich weiß, ich werde mich von Grund auf erholt fühlen, wenn ich wieder arbeiten kann. Glaub nicht, dass ich mich verkriechen werde. Ich habe vor, so aktiv zu bleiben, dass mir keine Zeit zum Grübeln bleibt. Eine neue Umgebung und die neue Lebensweise werden mich von meinen Erinnerungen ablenken.“
Rose vermutete, dass die Erinnerungen, von denen Sadie sich ablenken wollte, mit dem plötzlichen Tod ihrer Eltern zu tun hatten, die bei dem Flugzeugunglück im Jahr zuvor ums Leben gekommen waren. Sie selbst hatte mit gerade zwanzig mit dem Tod ihrer Mutter fertigwerden müssen. Der Schicksalsschlag hatte eine tiefe Wunde gerissen, die noch heute schmerzte und wohl nie ganz verheilen würde. Der Fotografie nach war Sadie die jüngere der beiden Schwestern. Rose rechnete nach – Edith war zur Zeit ihres Todes achtzig gewesen –, und sie kam zu dem Ergebnis, dass Sadie, wie sie selbst, um die zwanzig gewesen sein musste, als ihre Mutter ums Leben kam. Und sie hatte bei dem Unglück zusätzlich noch den Vater verloren.
Rose nahm sich den nächsten Brief vor, der eine Woche nach dem ersten geschrieben war.
„Nun bin ich also endlich hier. The Egg ist fertig eingerichtet, und es ist eine Pracht. Du hättest die armen Männer sehen sollen, die meine Druckpresse diesen fürchterlichen Matschweg zum Haus hinauftragen mussten. Sie haben sich bitter beschwert, bis ich sie mit Tee und riesigen Stücken Kuchen versorgt habe, danach waren sie viel umgänglicher. Mrs. Thomsett aus dem Laden in Nutcombe hat mir sehr geholfen und empfahl mir Boxells Werkstatt, wo Mr. Boxell persönlich mir versprach, sich nach einem gebrauchten Fahrrad für mich umzuhören. Weißt Du noch, welchen Zauber der Wald im Herbst besitzt, Edith? Du musst mich ganz bald besuchen.“
Das Läuten des Telefons riss Rose aus der Lektüre. Robert wollte wissen, ob es ihr recht sei, wenn er am Abend Gäste mitbrachte. Noch während sie automatisch bejahte, merkte sie, wie erleichtert sie war, dass er nicht wieder einen langen Abend außer Haus verbringen wollte. Er hatte viel zu tun, weiter nichts. Alles war in bester Ordnung.
Sie setzte sich in ihren Mini, und während sie ins Zentrum fuhr, um für den Abend einzukaufen, ging sie in Gedanken das Menü durch.
Melone als Vorspeise, Crêpes zum Nachtisch. Nein, keine Crêpes, das war zu viel Aufwand in letzter Minute. Besser Zitronenbaiser, das konnte sie im Voraus zubereiten. Das Hauptgericht … nicht Bœuf Bourguignon, da reichte die Zeit nicht. Moussaka? Nein, das sah nach schneller Küche aus. Sie entschied sich für Chicken à la King.
Nachdem sie die Läden abgeklappert und alles Nötige besorgt hatte, ging sie in die öffentliche Bibliothek. In verschiedenen Londoner Adressbüchern schlug sie zuerst Sadie Lawless nach und dann, nachdem sie von Sadie keine Spur gefunden hatte, Philip Sprott. Ihrem Gefühl nach konnte er ein Londoner Modearzt gewesen sein, mit einer Praxis in der Harley Street vielleicht.
Sie fuhr mit der Fingerspitze die Spalten des Adressbuchs entlang, die das Gebiet um die Harley Street einschlossen. Kein Philip Sprott. Sie erweiterte die Suche und stieß schließlich auf den passenden Eintrag: „Dr. Philip Sprott“. Nicht in der Harley Street, sondern in der Handel Street in Bloomsbury. Als sie aus der Bibliothek auf die Straße hinaustrat, begann es zu regnen.
Zu Hause machte sie das Zitronenbaiser und stellte es in den Kühlschrank, bevor sie in Roberts Arbeitszimmer ging und die Nummer in der Handel Street anrief.
Eine Frau meldete sich. „Praxisgemeinschaft Handel Street. Guten Tag.“
Rose fragte nach Dr. Sprott. Er habe gerade einen Patienten bei sich, sagte die Arzthelferin. Ob sie ihm etwas ausrichten könne.
Es fiel ihr schwer, ihr Anliegen zu erklären. Es hörte sich abwegig an, selbst für sie. Die Frau am Telefon fand das offensichtlich auch.
„Neunzehnhundertdreißig? Das war vor vierzig Jahren. So lange heben wir unsere Unterlagen nicht auf.“
„Ich habe gehofft, Dr. Sprott könnte sich an sie erinnern.“
„Ich glaube wirklich nicht …“
„Würden Sie ihn bitte fragen? Ich wäre Ihnen sehr dankbar“, sagte Rose mit Entschiedenheit. „Meine Großtante hieß Sadie Lawless.“ Sie nannte nochmals ihren eigenen Namen und ihre Telefonnummer und verabschiedete sich.
Sobald die Mädchen im Bett waren, zog Rose sich um, schlüpfte in ein schmales Maxikleid aus schwarzem Chiffon mit Trompetenärmeln und tiefem V-Ausschnitt. Sie bürstete ihre langen, dunkelbraunen Haare, sodass sie glatt über ihre Schultern fielen, und frischte ihr Make-up auf.
Wo blieb Robert? Es war schon halb acht. Die Gäste waren für acht Uhr angesagt. Sie schaute aus dem Erkerfenster zur Straße hinaus, sah aber nichts, nur die Autos, die durch den Regen rasten, und den schwimmenden Abfall im Rinnstein.
Als das Telefon läutete, lief sie nach unten. Das musste Robert sein. Doch die Stimme, die sich meldete, war fremd.
„Spreche ich mit Mrs. Martineau?“
„Ja. Und wer sind Sie, bitte?“
„Mein Name ist Philip Sprott. Sie haben heute in der Praxis angerufen und nach Sadie Lawless gefragt.“
Rose setzte sich in Roberts Ledersessel. „Danke, dass Sie so schnell zurückrufen, Dr. Sprott. Das ist sehr nett. Soweit ich weiß, war Sadie Lawless eine Patientin von Ihnen. Ich wollte eigentlich wissen, ob Sie sich noch an sie erinnern können.“
„O ja. Als ich von Ihrem Anruf hörte, war plötzlich alles wieder da. Darf ich fragen, welchen Grund Ihr Interesse an Sadie Lawless hat?“
„Sie ist meine Großtante. Von ihrer Existenz habe ich erst vor ein paar Tagen erfahren, nach dem Tod meiner Großmutter, als ich Briefe von Sadie gefunden habe. Ich würde sie gern ausfindig machen, falls sie noch lebt – schon um sie wissen zu lassen, dass ihre Schwester gestorben ist. Und da in einem ihrer Briefe Ihr Name erwähnt wurde, dachte ich …“
„Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht wirklich weiterhelfen.“ Philip Sprott hatte eine tiefe, angenehme Stimme. „Wir haben seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Aber manche Patienten bleiben einem im Gedächtnis, ja, ich erinnere mich an Ihre Großtante. Sie war eine sehr lebendige, intelligente und charmante junge Frau. Aber tief gedrückt von Trauer.“
Durchs Fenster beobachtete Rose den Tanz der Regentropfen auf dem Pflaster. „Wegen des Todes ihrer Eltern?“
Philip Sprott antwortete nicht gleich. Dann sagte er: „Mrs. Martineau, Sie wissen, dass ich Psychiater bin?“
Psychiater. „Nein, ich dachte …“
„Ich praktiziere nur noch eingeschränkt. Ihre Großtante war eine meiner ersten Patientinnen, ich war damals jung und unerfahren. Es ist zwar sehr lange her, aber meines Wissens kennt die ärztliche Schweigepflicht keine Verjährung.“
„Natürlich, das verstehe ich, Dr. Sprott.“
„Sie sagten, dass Ihre Großmutter vor Kurzem gestorben ist?“
„Ja.“
„Das tut mir sehr leid. Tja, was kann ich Ihnen sagen …? Ich erinnere mich, dass die Beziehung der Schwestern schwierig war. Sie waren altersmäßig weit auseinander – zehn Jahre, glaube ich.“
„Und Sadie war die jüngere Schwester?“
„Ja. Sie kam nach einem Nervenzusammenbruch zu mir. Ihr Verlobter hatte sie verlassen. Dieser Bruch, so bald nach dem Verlust der Eltern … die menschliche Seele ist eben nicht grenzenlos belastbar.“ Wieder eine Pause. Dann setzte Philip Sprott hinzu: „An den Namen des Verlobten erinnere ich mich nicht. Immerhin weiß ich noch, dass ich sein Verhalten infam fand. Er war Antiquitätenhändler, was allerdings kaum relevant ist. Ihre Großtante war Lehrerin.“
„Und sie hat gemalt.“ Rose dachte an den zweiten Brief. Du hättest die armen Männer sehen sollen, die meine Druckpresse diesen fürchterlichen Matschweg durch die Bäume zum Haus hinauftragen mussten.
„Ja.“ Er klang amüsiert. „Sie hat während der Sitzungen oft gezeichnet. Sie sagte, das wirke entspannend auf sie. Den offenen Kamin … oder die Platanen vor dem Fenster. Manchmal hat sie auch mich gezeichnet. Eine Skizze hat sie mir geschenkt. Ich habe sie wahrscheinlich noch irgendwo. Sie kam ungefähr ein, anderthalb Jahre lang zu mir. Danach bekam ich ab und zu eine Postkarte, aber das hörte dann auf. Ich nahm an, sie hätte das Vergangene endgültig hinter sich gelassen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr sagen kann, Mrs. Martineau.“
Rose hörte die Haustür zufallen. Sie dankte Dr. Sprott und beendete das Gespräch.
Robert zog gerade im Flur seinen nassen Mantel aus.
„Wo warst du denn so lang?“, fragte sie. „Die Gäste kommen in fünf Minuten.“
„Das weiß ich.“ Es klang verärgert. Dann änderte er den Ton. „Entschuldige. Tut mir leid, Schatz. Es war alles ein bisschen … Die Arbeit, du weißt doch, wie es ist. Wir haben den Gibson-Vertrag nicht bekommen.“
„Das tut mir leid, Robert.“ Sie küsste ihn. „So ein Pech.“
„Ach, klappt das eine nicht, klappt das andere.“ Aber seine unbekümmerten Worte passten nicht zu dem Schatten, der über sein Gesicht flog. Ein Ausdruck von Furcht und Unruhe – so flüchtig, dass sie hätte glauben können, er sei ihrer Einbildung entsprungen.
„Was ist denn?“, fragte sie liebevoll. „Sag’s mir, Liebling. Sag mir, was los ist.“
„Nichts, gar nichts. Ich bin einfach müde.“ Er lächelte halbherzig. „Ich könnte einen Drink gebrauchen. Gib mir zwei Minuten. Ich ziehe mich schnell um.“
Als es läutete, musterte Rose im Flurspiegel kurz ihr Gesicht. Sie setzte ein Lächeln auf und öffnete die Tür.
„Hugh, Vivienne … Wie schön, euch zu sehen. Kommt doch rein.“
„Wer gerne über das Leben mit all seinen Tücken liest, der ist mit dem neuen Buch von Judith Lennox bestens bedient.“
„Eine wunderbare und spannende Geschichte, voller Lokalkolorit und Gefühl, die ich jederzeit wieder lesen würde.“
„Emphatisch, klug und sehr unterhaltsam erzählt, gelingt es der Autorin ihre Leser*innen zu fesseln.“
„Das sagt Chefredakteurin Carla: ›Das Haus der Malerin‹ von Judith Lennox bietet alles, was ich mir an einem kalten Abend von einem Buch wünsche: Spannung, ein bisschen Liebe und schlau miteinander verwobene Handlungsstränge. Herrlich!“
„›Das Haus der Malerin‹ ist eine Geschichte weit ab von 08/15. Mit ihren starken Protagonistinnen hat Judith Lennox einen packenden historischen Krimi geschaffen.“
„Es vereint alles, was ich an einem guten Buch mag: einen historische Hintergrund, eine sehr spannende Familiengeschichte, die ein Geheimnis umgibt, und sich am Ende fast zum Krimi entwickelt.“





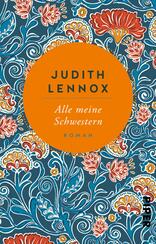









DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.