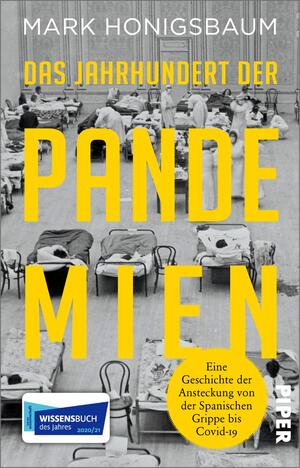
Das Jahrhundert der Pandemien - eBook-Ausgabe
Eine Geschichte der Ansteckung von der Spanischen Grippe bis Covid-19
— Sieger: das informativste Buch des Jahres 2020/21 (bild der Wissenschaft)Das Jahrhundert der Pandemien — Inhalt
Wenn Krankheiten um die Welt reisen
Eine lehrreiche Medizingeschichte über ein Jahrhundert voller Krankheiten und wissenschaftlichen Fortschritts
Medizinhistoriker und Journalist Dr. Mark Honigsbaum blickt auf 100 Jahre Pandemiegeschichte zurück und präsentiert dabei medizinische Höchstleistungen
„Wer sich nicht an seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen.“ Dieser Satz des spanischen Philosophen George Santayana muss heute fast ironisch wirken: Medizinhistoriker Mark Honigsbaum blickt in seinem Sachbuch „Das Jahrhundert der Pandemien“ auf die Epidemien der vergangenen 100 Jahre zurück. Er beschreibt die Ausbrüche der Spanischen Grippe, der sogenannten Papageienkrankheit, der Legionärskrankheit, und verfolgt die Entwicklung von AIDS in Amerika und Afrika, von Ebola und Zika. Mit Covid-19 reicht seine Schilderung bis ins Heute hinein.
Dabei fördert er immer wieder interessante wie tragische Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart zutage. Zu jeder Zeit lassen sich nämlich engagierte Forscher finden, die bei ihrer Bekämpfung einer Seuche durch frustrierende bürokratische Verwaltungsapparate und andere Hindernisse ausgebremst werden.
„Honigsbaum ist nicht bloß ein gründliches Werk jüngerer Medizingeschichte gelungen, sondern auch ein Page-Turner.“ NZZ
Wie in einem spannenden Roman beschreibt Mark Honigsbaum in „Das Jahrhundert der Pandemien“ die immer wiederkehrende Suche nach neuen Krankheitserregern. Die Beteiligten bringen sich dabei sogar selbst in Gefahr, um das Leben Millionen anderer Menschen zu retten – manchmal mit fatalen Folgen.
Ausbruch, Verbreitung und Bekämpfung – die Lehren eines Jahrhunderts voller Epidemien in einem Buch vereint
„Mark Honigsbaum hat ein faszinierendes Buch über ein gerne beiseitegeschobenes Thema geschrieben: Wenn uns die vergangenen 100 Jahre – und nicht nur sie – etwas gelehrt haben, dann, dass neue Krankheiten und Virenstämme uns unweigerlich heimsuchen werden, egal wie hoch entwickelt die Wissenschaft wird.“ ― Deutschlandfunk „Auslese“
Leseprobe zu „Das Jahrhundert der Pandemien“
Prolog
Haie und andere Prädatoren
In den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks greifen Haie Badende niemals an. Und ein Hai kann das Bein eines Schwimmers auch nicht mit einem einzigen Biss abtrennen. So dachten die meisten Haiexperten im glühend heißen Sommer des Jahres 1916, als die Bewohner von New York und Philadelphia an die Strände im Norden von New Jersey strömten, um dort vor der drückenden Hitze im Inland Abkühlung zu finden. Im selben Sommer hatte an der Ostküste eine Polio-Epidemie gewütet, und das hatte zu Warnhinweisen geführt, es bestehe [...]
Prolog
Haie und andere Prädatoren
In den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks greifen Haie Badende niemals an. Und ein Hai kann das Bein eines Schwimmers auch nicht mit einem einzigen Biss abtrennen. So dachten die meisten Haiexperten im glühend heißen Sommer des Jahres 1916, als die Bewohner von New York und Philadelphia an die Strände im Norden von New Jersey strömten, um dort vor der drückenden Hitze im Inland Abkühlung zu finden. Im selben Sommer hatte an der Ostküste eine Polio-Epidemie gewütet, und das hatte zu Warnhinweisen geführt, es bestehe das Risiko, sich in öffentlichen Schwimmbädern mit „Kinderlähmung“ zu infizieren. Die Küste von Jersey galt jedoch als prädatorenfreie Zone.
„Das Risiko, von einem Hai angegriffen zu werden“, erklärte Frederic Lucas, Direktor des American Museum of Natural History, im Juli 1916, „ist ungleich geringer, als vom Blitz getroffen zu werden … die Gefahr eines Haiangriffs an unseren Küsten liegt praktisch bei null.“ Als Beweis verwies Lucas auf die Belohnung von 500 Dollar, die der Millionär und Bankier Hermann Oelrichs „für einen authentischen Fall“ ausgesetzt hatte, „dass ein Mensch in gemäßigten Gewässern [in den Vereinigten Staaten nördlich von Cape Hatteras, North Carolina] von einem Hai attackiert wird“ – eine Summe, die niemals eingefordert worden war, seit Oelrichs dieses Angebot 1891 in der New York Sun gemacht hatte.
Aber Oelrichs und Lucas irrten sich, und das galt auch für Henry Fowler und Henry Skinner, zwei Kuratoren der Academy of Natural Sciences in Philadelphia, die 1916 kategorisch festgestellt hatten, dass einem Hai die Kraft fehle, einem Menschen ein Bein abzubeißen. Das war die bekannte Faktenlage – bis zur ersten Ausnahme am Abend des 1. Juli 1916. Damals entschloss sich Charles Epting Vansant, ein reicher junger Börsenmakler, der mit Frau und Familie in New Jersey Urlaub machte, vor dem Abendessen in der Nähe seines Hotels in Beach Haven noch mal kurz ins Wasser zu gehen. Vansant oder „Van“, wie er von seinen Freunden genannt wurde, hatte 1914 an der University of Pennsylvania seinen Abschluss gemacht; er war ein Nachkomme einer der ältesten Familien des Landes – niederländische Einwanderer, die sich 1647 in der Neuen Welt niedergelassen hatten – und berühmt für seine Sportlichkeit. Wenn er irgendwelche Sorgen gehabt haben sollte, sich an diesem Abend in die kühlen Wasser des Atlantiks zu wagen, so wurden sie vom vertrauten Anblick des Rettungsschwimmers Alexander Ott, Mitglied des amerikanischen olympischen Schwimmteams, und eines freundlichen Chesapeake Bay Retriever vertrieben, der auf ihn zurannte, als er in die Brandung eintauchte. Nach Art junger edwardianischer Männer jener Tage schwamm Vansant aus dem mit Leinen abgetrennten Bereich direkt aufs offene Meer hinaus, bevor er sich umdrehte, um Wasser zu treten und den Hund zu sich zu rufen. Inzwischen waren sein Vater, Dr. Vansant, und seine Schwester Louise an den Strand gekommen und bewunderten vom Rettungsschwimmerhäuschen aus seine gute Form. Zu ihrer großen Belustigung weigerte sich der Hund, ins Wasser zu gehen. Wenige Augenblicke später wurde der Grund dafür klar – im Wasser tauchte eine schwarze Flosse auf, die sich von Osten her auf Vansant zubewegte. Verzweifelt winkte der Vater seinem Sohn zu, zurück an Land zu schwimmen, doch Vansant erkannte die Gefahr zu spät, und als er sich noch rund 50 Meter vom Strand entfernt befand, spürte er einen plötzlichen heftigen Ruck und einen schrecklichen Schmerz. Als sich das Wasser um ihn rot verfärbte, griff Vansant nach unten und stellte fest, dass sein linkes Bein nicht mehr da war, glatt am Oberschenkelknochen durchtrennt.
Inzwischen war ihm Ott zu Hilfe geeilt und zog ihn durch das Wasser in die Sicherheit des Engleside Hotels, wo sein Vater verzweifelt versuchte, die Blutung zu stillen. Aber es war zwecklos – die Wunde blutete zu stark –, und zum Entsetzen seines Vaters und seiner jungen Frau starb Vansant an Ort und Stelle, das erste bekannte Opfer eines Haiangriffs im Nordatlantik. Von diesem Moment an würde keiner von beiden jemals wieder auf den Atlantik am Strand von New Jersey blicken können, ohne sich das mörderische Gebiss vorzustellen, das unter der Oberfläche lauerte.
Sie waren nicht allein. Innerhalb von zwei Wochen wurden vier weitere Schwimmer an der Küste von New Jersey angegriffen und drei getötet, was eine geradezu hysterische Furcht vor „menschenfressenden“ Haien auslöste, die bis heute anhält. Dabei spielt es kaum eine Rolle, dass Sichtungen von Weißen Haien und anderen großen Haiarten im Nordatlantik selten und Angriffe auf Schwimmer noch seltener sind. Strandbesucher wissen inzwischen, dass sie sich beim Schwimmen besser nicht zu weit von der Küste entfernen, und sollten sie die Risiken unterschätzen oder die Gefahr mit einem Achselzucken abtun, so gibt es stets eine Wiederholung von Der weiße Hai oder eine Folge von Shark Week auf Discovery Channel, um ihnen den Kopf zurechtzurücken. Daher fürchten sich viele Kinder und auch zahlreiche Erwachsene davor, in der Brandung zu spielen, und selbst diejenigen, die sich hinter die Brecher wagen, wissen, dass es ratsam ist, die Wasseroberfläche immer wieder nach einer verräterischen Rückenflosse abzusuchen.
Auf den ersten Blick scheinen die Haiangriffe in New Jersey wenig mit der Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 oder der Zika-Epidemie zu tun zu haben, die im Folgejahr in Brasilien ausbrach. Doch das ist ein Irrtum, denn genauso, wie sich die meisten Biologen keinen Haiangriff in den kalten Gewässern des Nordatlantiks vorstellen konnten, konnten sich die meisten Experten für Infektionskrankheiten im Sommer 2014 nicht vorstellen, dass Ebola, ein Virus, dessen Vorkommen sich zuvor auf abgelegene Waldregionen in Zentralafrika beschränkt hatte, eine Epidemie in einer Großstadt in Sierra Leone oder Liberia auslösen könnte, noch viel weniger jenseits des Atlantiks, in Europa oder den Vereinigten Staaten. Aber genau das geschah, als das Ebolavirus kurz vor Januar 2014 aus einem unbekannten Tierreservoir auftauchte, im Dorf Méliandou im Südosten von Guinea einen zweijährigen Jungen infizierte und von dort auf dem Landweg nach Conakry, Freetown und Monrovia und weiter auf dem Luftweg nach Brüssel, London, Madrid, New York und Dallas gelangte.
Und etwas sehr Ähnliches geschah 1997, als ein bislang obskurer Stamm aviärer Influenzaviren namens H5N1, der zuvor in Entenvögeln und anderem wilden Wassergeflügel zirkuliert hatte, plötzlich begann, große Mengen an Geflügel in Hongkong zu töten, und eine weltweite Panik vor der Vogelgrippe auslöste. Auf die Furcht vor der Vogelgrippe folgte 2003 die Panik vor dem Schweren Akuten Respiratorischen Syndrom (SARS), auf das 2009 wiederum die Schweinegrippe folgte – ein Ausbruch, der in Mexiko begann und Angst vor einer weltweiten Influenza-Pandemie auslöste, die die Lagerbestände antiviraler Arzneimittel schrumpfen ließ und zur Produktion von Impfstoffen im Wert von vielen Milliarden Dollar führte.
Die Schweinegrippe entwickelte sich nicht zu einem „Menschenfresser“ – die Pandemie tötete weltweit weniger Menschen, als gewöhnliche Influenzastämme in den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den meisten Jahren an Opfern fordern –, im Frühjahr 2009 wusste das aber noch niemand. Während sich Infektionsfachleute auf das Wiederauftauchen der Vogelgrippe in Südostasien konzentrierten, hatte tatsächlich niemand mit dem Auftauchen eines neuartigen Schweinegrippevirus in Mexiko gerechnet, geschweige denn eines Virus mit einem ähnlichen genetischen Profil wie dem des Erregers der sogenannten Spanischen Grippe von 1918 – einer Pandemie, die Schätzungen zufolge mindestens 50 Millionen Menschen weltweit tötete und zu einem Symbol für ein virales Armageddon geworden ist.
Im 19. Jahrhundert gingen medizinische Experten davon aus, ein besseres Verständnis der sozialen und umweltspezifischen Bedingungen, die zu Infektionen führten, würde sie in die Lage versetzen, Epidemien vorherzusagen und „die Panik zu bannen“, wie es der viktorianische Epidemiologe und Sanitärexperte William Farr 1847 ausdrückte. Als Fortschritte in der Bakteriologie jedoch zur Entwicklung von Impfstoffen (Vakzinen) gegen Typhus, Cholera und Pest führten und die Furcht vor den großen epidemischen Seuchen der Vergangenheit allmählich nachließ, gerieten andere Erkrankungen ins Blickfeld, und neue Ängste entwickelten sich. Ein gutes Beispiel ist die Poliomyelitis, kurz Polio genannt. In dem Monat, bevor die Haiangriffe auf Badende an den Stränden von New Jersey begannen, war in der Nähe des Hafengebiets in South Brooklyn eine Polio-Epidemie ausgebrochen. Mitarbeiter der New Yorker Gesundheitsbehörde beschuldigten sofort italienische Immigranten, die kürzlich aus Neapel eingewandert waren und in einem Bezirk namens „Pigtown“ in höchst beengten, unhygienischen Mietskasernen lebten, für den Ausbruch verantwortlich zu sein. Als sich die Poliofälle häuften und die Zeitungen sich mit herzzerreißenden Berichten über gelähmte oder verstorbene Kinder füllten, führte diese öffentliche Aufmerksamkeit zu einer wahren Hysterie und der Flucht wohlhabender Einwohner aus der Stadt (viele New Yorker machten sich an die Küste von New Jersey auf). Innerhalb von Wochen hatte die Panik auch die Nachbarstaaten an der Ostküste ergriffen, was zu Quarantänemaßnahmen, Reiseverboten und Zwangseinweisungen in Krankenhäuser führte. Diese hysterischen Reaktionen spiegelten zum Teil die damals vorherrschende medizinische Überzeugung wider, dass es sich bei Polio um eine Atemwegserkrankung handele, die durch Husten und Niesen sowie Fliegen weiterverbreitet werde, die sich inmitten von Abfall vermehrten.
In seiner Geschichte der Poliomyelitis beschreibt der Epidemiologe John R. Paul die Epidemie von 1916 als „den Höhepunkt bei den Versuchen zur Durchsetzung von Isolations- und Quarantänemaßnahmen“. Als die Epidemie mit den sinkenden Temperaturen im Dezember 1916 allmählich abklang, zählte man in 26 Bundesstaaten insgesamt 27 000 Fälle und 6000 Tote, was die Epidemie zum größten Polio-Ausbruch der damaligen Zeit machte. Allein in New York wurden 8900 Fälle und 2400 Tote registriert; die Mortalitätsrate betrug also rund eins von vier Kindern.
Die Größenordnung des Ausbruchs ließ Kinderlähmung als ein spezielles amerikanisches Problem erscheinen. Was die meisten Amerikaner aber nicht wussten, war, dass Schweden fünf Jahre zuvor einen ähnlich verheerenden Ausbruch erlebt hatte. Während dieses Ausbruchs hatten schwedische Wissenschaftler wiederholt Polioviren aus dem Dünndarm der Opfer isoliert – ein wichtiger Schritt zur Erklärung der wahren Ursachen der Entstehung (Ätiologie) und Krankheitsverläufe (Pathologie) der Krankheit. Den Schweden gelang es überdies, das Virus in Tieraffen zu kultivieren, die den Absonderungen von asymptomatischen menschlichen Trägern des Virus ausgesetzt worden waren. Das nährte den Verdacht, das Virus könne die Zeit zwischen den einzelnen Ausbrüchen in „gesunden Überträgern“ überdauern. Diese Erkenntnisse wurden jedoch von führenden Polio-Experten ignoriert. Deshalb sollte es bis 1938 dauern, bis Forscher der Yale University die schwedischen Studien aufgriffen und bestätigten, dass asymptomatische Überträger häufig Polioviren mit dem Stuhl ausschieden und die Viren bis zu zehn Wochen in unbehandelten Abwässern überleben konnten.
Wie wir heute wissen, bestand in der Ära vor Entwicklung eines Poliovakzins die größte Hoffnung, Lähmungserscheinungen zu vermeiden, darin, bereits in früher Kindheit eine immunisierende Infektion durchzumachen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Polio schwere Komplikationen hervorruft. So gesehen war Dreck ein Freund der Mütter, und man konnte es als rationale Strategie ansehen, Babys mit poliokontaminiertem Wasser und Lebensmitteln in Kontakt zu bringen. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren die meisten Kinder aus Nachbarschaften, in denen arme Einwanderer lebten, auf genau diese Weise immun gegen den Erreger geworden. Das höchste Risiko, die paralytische Form der Erkrankung zu entwickeln, trugen die Kinder aus gepflegten Mittelklassewohngegenden – Menschen wie Franklin Delano Roosevelt, der künftige 32. Präsident der Vereinigten Staaten, der dem Polio-Erreger in seinen Teenagerjahren entkam, nur um sich 1921 als 39-Jähriger bei einem Urlaub auf Campobello Island, New Brunswick, mit dem Virus zu infizieren.
In diesem Buch geht es darum, wie wachsendes Wissen über Viren und andere Krankheitserreger (Pathogene) medizinische Forscher blind für diese ökologischen und immunologischen Erkenntnisse sowie für die Epidemie, die direkt um die Ecke lauert, machen kann. Seit der deutsche Bakteriologe Robert Koch und sein französischer Kollege Louis Pasteur in den 1880er-Jahren die „Keimtheorie“ von Krankheiten aus der Taufe gehoben hatten, indem sie zeigten, dass Tuberkulose eine bakterielle Infektion war, und Impfstoffe gegen Anthrax (Milzbrand), Cholera und Tollwut entwickelten, haben Wissenschaftler – und die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, deren Arbeit auf den Methoden der Forscher fußten – davon geträumt, alle pathogenen Mikroorganismen zu besiegen. Aber während die medizinische Mikrobiologie und damit verknüpfte Gebiete, wie Epidemiologie, Parasitologie, Zoologie und in letzter Zeit auch Molekularbiologie, neue Möglichkeiten schufen, die Übertragung und Ausbreitung neuartiger Pathogene zu verstehen und sie für Kliniker sichtbar zu machen, stellten sich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden allzu oft als nicht ausreichend heraus. Das liegt nicht einfach nur daran, dass Mikroorganismen ständig mutieren und sich weiterentwickeln, was unsere Fähigkeit überfordert, mit ihrer sich pausenlos wandelnden Genetik und ihren Übertragungsmustern Schritt zu halten, wie manchmal argumentiert wird. Tatsächlich liegt es auch daran, dass Medizinforscher dazu neigen, Gefangene bestimmter Paradigmen und Theorien zu Krankheitsursachen zu werden, was sie blind für die Gefahren bekannter und unbekannter Pathogene macht.
Nehmen wir zum Beispiel Influenza, das Thema des ersten Kapitels. Als in der Endphase des Ersten Weltkriegs, im Sommer 1918, die Spanische Grippe ausbrach, nahmen die meisten Ärzte an, sie werde sich ähnlich wie vorangegangene Grippe-Epidemien verhalten, und taten sie als lediglich lästig ab. Nur wenige glaubten, der Erreger könne eine tödliche Bedrohung für junge Erwachsene darstellen, noch viel weniger für Soldaten auf dem Marsch zu den alliierten Linien in Nordfrankreich. Schließlich hatte niemand Geringerer als Kochs Schützling Richard Pfeiffer die Ärzteschaft darüber informiert, dass Influenza von einem winzigen, gramnegativen Bakterium übertragen werde und es nur eine Frage der Zeit sei, bis in deutschen Labormethoden ausgebildete Bakteriologen einen Impfstoff gegen den Influenza-Bazillus liefern würden, genauso wie es ihn schon gegen Cholera, Diphtherie und Typhus gab. Aber Pfeiffer und all diejenigen, die auf seine experimentellen Methoden vertrauten, irrten sich: Der Erreger der Influenza ist kein Bakterium, sondern ein Virus, zu klein, um durch die Linse eines normalen Lichtmikroskops gesehen zu werden. Überdies passierte das Virus problemlos die Porzellanfilter, die damals verwendet wurden, um Bakterien zu isolieren, wie man sie häufig im Nasen- und Rachenraum von Grippekranken fand. Auch wenn einige britische und amerikanische Forscher bereits früh den Verdacht hegten, der Influenza-Erreger könne ein „Filterpassierer“ sein, sollte es viele Jahre dauern, bis Pfeiffers Fehleinschätzung korrigiert und die virale Ätiologie des Influenza-Erregers deutlich wurde. In der Zwischenzeit wurde viel Forschungszeit verschwendet, und Millionen junger Menschen starben.
Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, dass es ausreicht, die Identität eines Erregers und die Ätiologie einer Krankheit zu kennen, um eine Epidemie unter Kontrolle zu bringen, denn auch wenn die Präsenz eines Infektionserregers eine notwendige Bedingung für Krankheit ist, ist sie selten hinreichend. Mikroorganismen interagieren auf verschiedene Weise mit unserem Immunsystem, und ein Erreger, der bei einer Person zu einer Erkrankung führt, lässt eine andere vielleicht unbeeinflusst oder löst nur leichte Symptome aus. Tatsächlich können viele bakterielle und virale Infektionen jahrzehntelang in Zellen und Geweben „schlafen“, bevor sie durch äußere Ereignisse oder Prozesse (re-)aktiviert werden, ob durch eine Koinfektion mit anderen Mikroorganismen, durch einen plötzlichen systemischen Schock aufgrund eines äußeren Stressors oder durch ein Nachlassen der Immunabwehr im höheren Alter. Noch wichtiger ist aber: Indem wir uns auf spezifische mikrobielle Prädatoren konzentrieren, riskieren wir, das größere Ganze aus dem Blick zu verlieren. Beispielsweise gehört das Ebolavirus vielleicht zu den tödlichsten Erregern, die uns bekannt sind, doch nur wenn tropische Regenwälder abgeholzt und die Fledermäuse, die vermutlich das Reservoir des Virus zwischen den Epidemien bilden, aus ihren Unterschlüpfen vertrieben werden oder wenn Jäger Schimpansen töten und zerlegen, um sie als „Bushmeat“ (Fleisch von Wildtieren) zu verkaufen, kommt es dazu, dass Ebola auf Menschen überspringt und sich verbreitet. Und nur wenn die via Blut übertragene Krankheit durch schlechte Krankenhaushygiene weiteren Schub erhält, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich weiter ausbreitet und schließlich auch urbane Regionen erreicht. Unter solchen Umständen lohnt es, sich an das zu erinnern, was George Bernard Shaw 1906 in Des Doktors Dilemma ausdrückte: „Es war auch klar, dass die charakteristische Mikrobe einer Krankheit ebenso gut ein Symptom wie eine Ursache sein kann.“ Wenn man Shaws Axiom aktualisiert, könnte man in der Tat sagen, dass Infektionskrankheiten fast immer breiter gefächerte umweltbedingte und soziale Ursachen haben. Solange wir die ökologischen, immunologischen und verhaltensbiologischen Faktoren, die das Auftauchen und die Verbreitung neuartiger Pathogene beeinflussen, nicht mitberücksichtigen, wird unser Wissen um solche Erreger und ihre Verbindungen zu Krankheiten zwangsläufig bruchstückhaft und unvollständig bleiben.
Um fair zu sein, hat es immer medizinische Forscher gegeben, die bereit waren, einen nuancierteren Blick auf unsere komplexen Wechselbeziehungen mit Mikroorganismen zu werfen. Beispielsweise wetterte René Dubos, Forscher am Rockefeller Institute, auf dem Höhepunkt der Antibiotikarevolution 1959 heftig gegen kurzsichtige technische Lösungen medizinischer Probleme. Zu einer Zeit, als die meisten seiner Kollegen die Überwindung von Infektionskrankheiten für selbstverständlich hielten und glaubten, die Ausrottung der häufigen bakteriellen Infektionsursachen stehe kurz bevor, warnte Dubos, der 1939 das erste kommerzielle Antibiotikum isoliert hatte und wusste, wovon er sprach, vor der allgemeinen medizinischen Hybris. Er verglich die Menschheit mit dem „Zauberlehrling“ und mahnte, die medizinische Wissenschaft habe „potenziell zerstörerische Kräfte“ in Gang gesetzt, die eines Tages den Traum von einem medizinischen Utopia zunichtemachen könnten. „Der moderne Mensch glaubt, dass er sich zum fast völligen Herrscher der Naturkräfte aufgeschwungen habe, die seine Evolution in der Vergangenheit geformt haben, und dass er nun sein eigenes biologisches und kulturelles Schicksal kontrollieren könne“, schrieb Dubos. „Aber das könnte sich als Illusion erweisen. Wie alle anderen Lebewesen ist er Teil eines ungeheuer komplexen ökologischen Systems und durch unzählige Verbindungen mit all seinen Komponenten verknüpft.“ Ein vollständiges Freisein von Krankheiten, so Dubos, sei eine „Fata Morgana“, und die Natur werde „zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt und in unvorhersehbarer Weise zurückschlagen“.
Aber obwohl Dubos’ Schriften in den 1960er-Jahren in der amerikanischen Öffentlichkeit ungeheuer populär waren, wurden seine Warnungen vor einem kommenden Krankheits-Armageddon von seinen wissenschaftlichen Kollegen weitgehend ignoriert. Daher war die medizinische Welt auch völlig überrascht, als die Centers for Disease Control and Prevention (CDC, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, die sich auf Infektionskrankheiten konzentriert) kurz nach Dubos’ Tod 1982 das Akronym AIDS für eine ungewöhnliche Autoimmunkrankheit prägten, die plötzlich in der Homosexuellengemeinschaft in Los Angeles aufgetaucht war und sich nun auf andere Teile der Bevölkerung auszubreiten begann. Aber die CDC hätten eigentlich nicht überrascht sein sollen, denn etwas ganz Ähnliches war erst acht Jahre zuvor geschehen: Damals hatte der Ausbruch einer untypischen Lungenentzündung (Pneumonie) bei einer Gruppe von Kriegsveteranen, die an einem Treffen der American Legion in einem Luxushotel in Philadelphia teilgenommen hatten, eine allgemeine öffentliche Hysterie ausgelöst. Epidemiologen bemühten sich verzweifelt, den „Philly Killer“ zu identifizieren. Zunächst verblüffte der Ausbruch die Infektionsdetektive der CDC, und erst einem Mikrobiologen gelang es, den Erreger, Legionella pneumophila, zu identifizieren, ein winziges Bakterium, das in wässriger Umgebung gedeiht, so auch in den Kühltürmen einer Klimaanlage des Hotels. In diesem Jahr (1976) kam es nicht nur zu einer Panik aufgrund der Legionärskrankheit, sondern auch wegen des plötzlichen Auftretens eines neuen Schweinegrippestamms auf einer Basis der US-Armee in New Jersey – ein Ereignis, auf das die CDC und die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden gleichermaßen unvorbereitet waren und das schließlich zu der unnötigen Impfung von Millionen Amerikanern führen sollte. Und etwas ganz Ähnliches wiederholte sich 2003, als ein älterer chinesischer Professor für Nephrologie im Metropole Hotel in Hongkong eincheckte und damit für grenzüberschreitende Ausbrüche einer schweren Atemwegserkrankung sorgte, die anfangs dem Vogelgrippevirus H5N1 zugeschrieben wurde, doch, wie wir inzwischen wissen, von einem neuartigen, SARS-ähnlichen Coronavirus ausgelöst wurde. In diesem Fall wurde eine Pandemie durch raffinierte mikrobiologische Detektivarbeit und eine beispielhafte Kooperation zwischen Netzwerken von Wissenschaftlern verhütet, die ihre Informationen miteinander teilten, aber es war eine knappe Sache, und seitdem gab es noch mehrere weitere unerwartete – und anfangs fehldiagnostizierte – kritische Infektionsereignisse.
In diesem Buch geht es um diese Ereignisse und Prozesse und um die Gründe, warum sie uns immer wieder überraschen, obwohl wir uns doch nach Kräften bemühen, sie vorherzusagen und vorbereitet zu sein. Einige dieser Geschichten, wie die Panik im Rahmen der Ebola-Epidemie 2016–18 oder die AIDS-Hysterie in den 1980er-Jahren, werden den Lesern bekannt sein; andere, wie der Ausbruch einer Pneumonie-Seuche im mexikanischen Viertel von Los Angeles 1924 oder die große Psittakose-Panik, die ein paar Monate nach dem Wall-Street-Crash von 1929 über die Vereinigten Staaten fegte, wohl weniger. Aber ob vertraut oder nicht – all diese Epidemien zeigen, wie rasch das anerkannte medizinische Wissen durch das Auftauchen neuer Pathogene auf den Kopf gestellt werden kann und wie ungewöhnlich erfolgreich solche Epidemien beim Verbreiten von Panik, Hysterie und Furcht sind, solange es keine Laborergebnisse, effektiven Impfstoffe und wirksamen Arzneimittel gibt.
Statt die Panik zu bändigen, können besseres medizinisches Wissen und eine bessere Überwachung von Infektionskrankheiten aber auch neue Ängste schüren und Menschen übersensibel auf epidemische Gefahren reagieren lassen, deren sie sich zuvor gar nicht bewusst waren. Genauso, wie Rettungsschwimmer das Meer nach bedrohlichen Rückenflossen absuchen, um Badende warnen zu können, durchsucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nämlich routinemäßig das Internet nach Berichten über ungewöhnliche Ausbrüche und testet Mikroorganismen auf Mutationen, die das Auftauchen des nächsten Pandemievirus signalisieren könnten. Bis zu einem gewissen Grad ist diese Hypervigilanz sinnvoll, aber der Preis, den wir zahlen, ist ein Zustand ständiger latenter Angst vor dem nächsten „Big One“, der nächsten großen Pandemie. Die Frage ist nicht, ob es zur Apokalypse kommt, hören wir immer wieder, sondern wann. In dieser fiebrigen Atmosphäre ist es nicht überraschend, dass sich Experten für öffentliche Gesundheit manchmal irren und den Panikknopf drücken, wenn tatsächlich gar kein Anlass zur Panik besteht. Oder sie verstehen die Bedrohung, wie im Fall der westafrikanischen Ebola-Epidemie, völlig falsch.
Um es deutlich zu sagen: Die Medien sind Teil dieser Prozesse – schließlich verkauft sich nichts so gut wie Furcht –, aber auch wenn Nachrichtenkanäle, die 24 Stunden lang sieben Tage die Woche senden, und die sozialen Medien dazu beitragen, Panik, Hysterie und die Stigmatisierung zu schüren, die mit dem Ausbruch von Infektionskrankheiten einhergehen, sind Journalisten und Blogger meistenteils lediglich Boten. Ich argumentiere, dass die medizinische Wissenschaft – und insbesondere die Epidemiologie –, die uns auf neue Infektionsquellen aufmerksam macht und bestimmte Verhaltensweisen als „riskant“ bezeichnet, letztendlich auch die Quelle dieser irrationalen und oft schädlichen Urteile ist. Niemand bestreitet, dass ein besseres epidemiologisches Verständnis für die Ursachen von Infektionskrankheiten zu großen Fortschritten geführt hat, was das Vorbereitetsein auf Epidemien angeht, oder dass sich unsere Gesundheit und unser Wohlergehen dank technischer Fortschritte in der Medizin immens verbessert haben; dennoch sollten wir nicht vergessen, dass aus diesem Wissen ständig neue Sorgen und Ängste erwachsen.
Jede in diesem Buch diskutierte Epidemie illustriert einen anderen Aspekt dieses Prozesses und zeigt, wie der Ausbruch jedes Mal das Vertrauen in das vorherrschende medizinische und wissenschaftliche Paradigma untergrub, was die Gefahr von blindem Vertrauen in bestimmte Technologien auf Kosten eines umfassenderen ökologischen Verständnisses für die Ursachen von Krankheiten unterstreicht. Dabei stütze ich mich auf soziologische und philosophische Einsichten in die Struktur naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und argumentiere, dass sich das, was vor dem Auftauchen (Emergenz) der neuartigen Infektion „bekannt“ war – dass Kühltürme und Klimaanlagen kein Risiko für Hotelgäste und Krankenhauspatienten darstellen, dass Ebola nicht in Westafrika zirkuliert und keine Großstadt erreichen kann, dass Zika eine relativ harmlose, von Stechmücken übertragene Krankheit ist –, als falsch herausstellte, und ich erkläre, wie all diese Epidemien in der Rückschau eine intensive Gewissenserforschung über „bekannte Bekannte“ und „unbekannte Unbekannte“ auslösten und was Wissenschaftler und Gesundheitsexperten tun sollten, um solche erkenntnistheoretisch blinden Flecken in Zukunft zu vermeiden.
Die in diesem Buch diskutierten Epidemien unterstreichen überdies die Schlüsselrolle, die umweltbedingte, soziale und kulturelle Faktoren dabei spielen, die Prävalenz- und Emergenzmuster einer Infektion zu verändern. Eingedenk von Dubos’ Erkenntnissen über die Ökologie von Pathogenen argumentiere ich, dass sich die Emergenz von Krankheiten in den meisten Fällen auf Störungen des ökologischen Gleichgewichts oder Veränderungen der Umwelt zurückführen lässt, in der der Erreger gewöhnlich heimisch ist. Das gilt besonders für Viren tierischen Ursprungs oder zoonotische Viren (die von Tier zu Mensch und umgekehrt übertragen werden können) wie das Ebolavirus, aber auch für kommensale (schmarotzende, aber nicht schädigende) Bakterien wie Streptokokken, die Hauptursache für ambulant erworbene Pneumonie. Der natürliche Wirt des Ebolavirus ist vermutlich ein Flughund. Aber obwohl Antikörper gegen das Ebolavirus in verschiedenen in Afrika heimischen Fledertierarten gefunden wurden, sind aus ihnen noch nie vermehrungsfähige Viren isoliert worden. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass das Ebolavirus, wie andere Viren, die sich im Lauf einer langen gemeinsamen Evolution an ihren Wirt angepasst haben, vom Immunsystem der Fledertiere sehr rasch aus dem Blutstrom eliminiert wird, aber vermutlich nicht, bevor es auf ein anderes Fledertier übertragen wurde. Das führt dazu, dass das Virus ständig in Fledertierpopulationen zirkuliert, ohne dass Virus oder Wirt geschädigt werden. Etwas Ähnliches geschieht bei Viren, die sich im Lauf ihrer Evolution ausschließlich auf den Befall von Menschen spezialisiert haben, wie Masern- und Polioviren: Eine Erstinfektion in der Kindheit führt gewöhnlich nur zu einem leichten Verlauf der Erkrankung; anschließend erholen sich die Betroffenen und sind lebenslang immun. Aber von Zeit zu Zeit wird dieser immunologische Gleichgewichtszustand gestört. Das kann natürliche Ursachen haben, zum Beispiel wenn eine genügend große Anzahl von Personen in der Kindheit nicht erkrankt, sodass die Herdenimmunität schwindet, oder wenn das Virus plötzlich mutiert – wie es beim Influenzavirus häufig vorkommt – und es zur Zirkulation eines neuen Virenstamms kommt, gegen den die Population kaum oder gar keine Immunität besitzt. Aber so etwas kann auch passieren, wenn wir uns unabsichtlich zwischen das Virus und seinen natürlichen Wirt stellen. Das war vermutlich beim Ebolavirus 2014 der Fall, als Kinder in Méliandou begannen, Angola-Bulldoggfledermäuse zu necken, die in einem hohlen Baum in der Mitte des Dorfes lebten. Und vermutlich löste ein sehr ähnliches Ereignis in den 1950er-Jahren den Spillover („Übersprung“) des HI-Vorläufervirus von Schimpansen auf Menschen im Kongo aus. Im Fall von AIDS besteht kaum Zweifel, dass die Einführung des Dampfschiffsverkehrs auf dem Kongo um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und der Bau neuer Straßen und Schienenwege in der Kolonialzeit eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Virus spielten, ebenso die Gier von Holzfällern und Holzfirmen. Aber auch soziale und kulturelle Faktoren hatten Einfluss: Wäre es nicht allgemein üblich gewesen, Bushmeat zu verzehren, und hätte die Prostitution rund um die Lager der Schienen- und Holzarbeiter nicht derart floriert, hätte sich das Virus wahrscheinlich nicht so weit verbreitet und so rasch vervielfältigt. Und hätte es nicht so tief verwurzelte kulturelle Überzeugungen und Gepflogenheiten in Westafrika gegeben – vor allem das Festhalten der Einheimischen an traditionellen Begräbnisriten und ihr Misstrauen gegenüber wissenschaftlicher westlicher Medizin –, hätte sich das Ebolavirus wohl kaum zu einer großen regionalen Epidemie entwickelt, geschweige denn zu einer globalen Gesundheitskrise.
Die vielleicht wichtigste Erkenntnis, die uns die Medizingeschichte vermitteln kann, ist jedoch die lange und enge Verbindung zwischen Epidemien und Krieg. Spätestens seit der attische Staatsmann Perikles den Athenern befahl, die spartanische Belagerung ihrer Hafenstadt 430 v. Chr. „auszusitzen“, gelten Kriege als Vorläufer tödlicher Ausbrüche von Infektionskrankheiten (was zweifellos auch 2014 in Westafrika der Fall war, wo ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg und bewaffnete Konflikte dazu führten, dass die Gesundheitssysteme in Liberia und Sierra Leone am Boden lagen und völlig unzureichend ausgestattet waren). Auch wenn der Erreger, der für die Seuche in Athen verantwortlich war, niemals identifiziert wurde und vielleicht auch niemals identifiziert werden wird (zu den Kandidaten zählen unter anderem Anthrax, Pocken, Typhus und Malaria), bestehen kaum Zweifel, dass der entscheidende Faktor die drangvolle Enge war, die hinter den Langen Mauern der griechischen Stadt herrschte, denn dort suchten bis zu 300 000 Athener und Flüchtlinge aus ganz Attika Schutz. Dieses erzwungene Zusammenleben auf engstem Raum schuf ideale Bedingungen für die Verbreitung des Virus – wenn es denn ein Virus war – und verwandelte Athen in ein Leichenhaus (wie Thukydides schreibt, gab es keine Häuser, um die Flüchtlinge aus dem Umland zu empfangen, daher „mußten sie in der heißen Jahreszeit des Jahres in stickigen Kabinen untergebracht werden, wo die Sterblichkeit ungehemmt wütete“ ). Das führte dazu, dass Athen nach der dritten Infektionswelle um 426 v. Chr. ein Viertel bis Drittel seiner Bevölkerung verloren hatte.
Im Fall der Attischen Seuche verschonte die Krankheit aus ungeklärten Gründen die Spartaner und breitete sich offenbar auch nicht weit über die Grenzen Attikas aus. Doch vor 2000 Jahren waren Städte und Dörfer stärker isoliert, und es gab weitaus weniger Ortsbewegung von Menschen und damit von Pathogenen zwischen Ländern und Kontinenten. Leider ist das heute nicht mehr der Fall. Dank des weltweiten Handels und Reiseverkehrs überqueren neue Viren und ihre Überträger (Vektoren) ständig Grenzen und Zeitzonen, und an jedem Ort treffen sie auf eine andere Mischung von ökologischen und immunologischen Bedingungen. Das galt ganz besonders für den Ersten Weltkrieg: Damals boten das Zusammentreffen von zigtausend jungen amerikanischen Rekruten in Ausbildungslagern an der Ostküste der Vereinigten Staaten sowie ihre anschließende Überfahrt nach Europa und wieder zurück ideale Bedingungen für den bislang tödlichsten Ausbruch einer Pandemie in der menschlichen Geschichte.
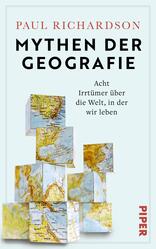








DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.