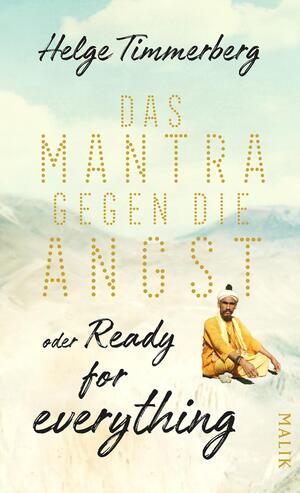
Das Mantra gegen die Angst oder Ready for everything - eBook-Ausgabe
Neun Tage in Kathmandu
„Der asienkundige Reiseschriftsteller Helge Timmerberg erzählt unterhaltsam und selbstkritisch von seiner neuen, verrückten Reise nach Nepal. (…) Es ist wunderbar mit ihm durch Kathmandu zu fahren.“ - Volksstimme
Das Mantra gegen die Angst oder Ready for everything — Inhalt
Fünfzehn Jahre ist es her, seit Helge Timmerberg im Annapurna-Massiv pilgerte. Damals vertraute ihm ein Yogi das Mantra gegen die Angst an. Ein Geschenk, das sich als überaus hilfreich erwies - gegen Helges Angst vor großen Hunden und vor Türstehern, vor Talkshow-Moderatoren und vor den Lesern seiner Bücher. Jetzt ist Timmerberg zurück in Kathmandu und muss den Yogi Kashinath wiederfinden. Er braucht Antwort auf die Frage, wie geheim das Mantra eigentlich ist. Darf er darüber schreiben, es mit anderen teilen, oder verliert es dann seine Wirkung? Wird er Kashinath, den Wandermönch und gepflegten Asketen, überhaupt noch einmal treffen? Die Suche nach dem Yogi treibt den Autor an und um. Sie mündet in ein starkes, ehrliches, pointenreiches Buch über Glückszustände, die Abwesenheit von Angst und das Versprechen absoluter Freiheit. Und darüber, welche Kraft wenige Worte entfalten können, wenn man fest genug an sie glaubt.
Leseprobe zu „Das Mantra gegen die Angst oder Ready for everything“
1. Kapitel
1. Tag in Kathmandu
Touchdown in Kathmandu.
Es ist 6.30 Uhr. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ich bin nicht in Form für die Einreiseformalitäten. Am Visaautomaten fühle ich den Schweiß auf meiner Stirn. Man bekommt das Visum entweder bei der nepalesischen Botschaft im Heimatland oder hier. Ich war mal der Meinung, hier gehe es schneller, aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Ich stehe vor dem Computer und gebe die Daten ein, die er von mir verlangt. Er verlangt zu viel. Die Adresse des Hotels? Ich habe kein Hotel. Ich wohne bei Scarlett. [...]
1. Kapitel
1. Tag in Kathmandu
Touchdown in Kathmandu.
Es ist 6.30 Uhr. Ich habe zwei Nächte nicht geschlafen. Ich bin nicht in Form für die Einreiseformalitäten. Am Visaautomaten fühle ich den Schweiß auf meiner Stirn. Man bekommt das Visum entweder bei der nepalesischen Botschaft im Heimatland oder hier. Ich war mal der Meinung, hier gehe es schneller, aber das glaube ich jetzt nicht mehr. Ich stehe vor dem Computer und gebe die Daten ein, die er von mir verlangt. Er verlangt zu viel. Die Adresse des Hotels? Ich habe kein Hotel. Ich wohne bei Scarlett. Ihre Adresse habe ich allerdings auch nicht. Und keine Telefonnummer. Ich habe nur einen vor drei Tagen abgerissenen Mailwechsel mit ihr. Sie schickt mir einen Fahrer, weil in Kathmandu Adressen nichts nützen, schrieb sie, und das war der letzte Stand der Dinge. Sie war in London und wollte zwei Tage vor mir los. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht ist sie gar nicht geflogen, vielleicht hat sie ihr Haus in Kathmandu nicht wieder- oder ganz anders vorgefunden, als sie es vor Monaten verließ, vielleicht hat sie auch keine Lust mehr auf mich oder generell auf Besuch, sie ist Wassermann, wie ich, bei uns weiß man selten, was als Nächstes passiert. Für Antworten wie diese gibt es auf dem Monitor des Visacomputers kein Kästchen und auch keine Möglichkeit, sie zu formulieren. Hinter mir wächst die Schlange.
Aufgeben. Wie schön wäre es jetzt, sich einfach umzudrehen und nach Haus zu gehen. Ich bin zu alt für diesen Scheiß und für den, der noch kommt. Überschwemmungskatastrophe im Süden, 1800 Tote, weggeschwemmte Straßen, halb Nepal ohne medizinische Versorgung, ein Land im Ausnahmezustand, nur Kathmandu funktioniert noch halbwegs normal, was aber auch kein Trost ist, denn normal heißt hier: Staus, Smog, Schlamm und Pfützen. Und jede Menge Unfälle. Schreibt unser Auswärtiges Amt. Es empfiehlt, Nepal derzeit zu meiden oder nur nach Kathmandu zu reisen, wenn es wirklich zwingend ist.
Wie zwingend ist das Mantra gegen die Angst? Wie zwingend ist der Yogi Kashinath? Wie zwingend ist mein Aufbruch in die Freiheit? Wie zwingend ist mein nächstes Buch? Und wie zwingend ist noch dazu der Augenblick? Soll ich zur Seite treten, mich in irgendeine Ecke setzen und so lange weinen, bis mich die Putzfrau nach draußen fegt?
Was machen sie eigentlich mit den Visa? Was erhoffen sie sich davon? Mehr Informationen, mehr Kontrolle, mehr Sicherheit? Ich glaube, das alles interessiert sie einen Dreck. Sie wollen Geld. Und ich gebe es gern einem der ärmsten Länder der Welt, auch ohne den Stress am Automaten oder in den Botschaften, einfach so, 40 Dollar für 30 Tage, cash auf Tatze und Namaste. Was tut weniger weh? Korruption oder Bürokratie? Teufel oder Beelzebub? Terror oder Anarchie? „Man muss den Einzelfall prüfen“, sagt mein neuer Freund dazu.
Ich treffe ihn, als ich mit allem durch bin und vor dem Flughafen stehe. Freund ist natürlich übertrieben, Schicksalsgenosse stimmt. Sein Fahrer ist wie meiner nicht gekommen. Seiner, weil ihm auf der Fahrt zum Flughafen der Wagen zusammenbrach und erst ein neuer organisiert werden muss, von meinem Fahrer weiß ich nichts. Keinen Namen, keine Nummer, und ich weiß auch nicht, sollte er doch noch kommen, was er von mir weiß. Hat ihm Scarlett ein Schild mitgegeben, auf dem mein Name steht? Und wenn ja, welcher? Helge? Tim? Mein Familienname? Kennt sie den überhaupt? Oder hat sie ihm nur gesagt, der Typ sieht aus wie Jesus, aber dicker?
Das Wetter: kein Regen, aber auch keine Sonne und kein noch so flüchtiger Ausblick auf die Gipfel des Himalaja. Die Berge sind über den Wolken, darunter sehe ich im fahlen Morgenlicht auf Taxischrott, eine nasse Fahrbahn, und ab der anderen Straßenseite beginnt viel Lehm. Wäre ich auf einem Acker gelandet, würde es ähnlich aussehen. Nachdem alle anderen Passagiere irgendwie abgeholt und abgerollt waren, blieben da nur noch ich und dieser gut gekleidete Herr mit den freundlichen Augen, und so kamen wir ins Gespräch. Er ist Nepali, lebt in Washington, und seine Branche ist „Energie“. Er elektrifiziert die dunklen Flecken der Erde. Mal in Pakistan, mal auf Kuba, auch hier in Nepal. Ich weiß noch nicht und werde es vielleicht auch nie in Erfahrung bringen, ob als Wissenschaftler, Ingenieur oder Manager, aber er ruht in der Ausgeschlafenheit der Businessclass. Da ruhe ich nicht. Ich bin ein Economy-Schriftsteller.
Aber immerhin.
Ob groß oder klein, alt oder jung, klug oder dumm, arm oder reich, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, ob Kapitalist, Kommunist, Anarchist oder Monarchist, gläubig oder Nihilist, Feigling oder Held, egal, es ist immer dasselbe. Wie beim Diesel. Dass ich Bücher schreibe, bringt die Leute zum Vorglühen, und sobald sie erfahren, dass ich davon leben kann, springt ihre Zündung an. Das ist mehr als Interesse, sogar mehr als Respekt. Das ist schon Liebe. Wollte ich deshalb seit frühester Kindheit Schriftsteller werden? Dann habe ich meine Zeit verschwendet. Wer sich nicht selbst lieben kann, ist wie ein schwarzes Loch, in dem alles Licht verschwindet. Aber praktische Vorteile hat das Ansehen meines Berufs natürlich ohne Ende.
In fast regelmäßigen Intervallen kommen Taxis vorbei, um uns abzufischen, und auch neben uns stehen Männer mit Pappen in der Hand, auf denen „Pilgrims Inn“ oder „Buddha Lodge“ zu lesen ist.
Ich glaube nicht mehr an Scarletts Fahrer. An die Verheißungen der Pappen glaube ich aber auch nur bedingt. Deshalb frage ich den nepalesischen Energieexperten aus Washington, ob er mich mit zu seinem Hotel nehmen kann, sobald sein Wagen gekommen ist, und er sagt Ja. Es wird ihm eine Freude sein. Und er will versuchen, dass auch ich ein Zimmer zum verbilligten Preis bekomme, wie er und die anderen Teilnehmer der Energiekonferenz, für die er hierhergeflogen ist.
„Sind Sie zum ersten Mal in Nepal?“, fragt er.
„Zum zweiten Mal. Vor 15 Jahren bin ich mit einem Yogi im Annapurna-Massiv unterwegs gewesen. Bis Muktinath.“
„Oh, ich war auch in Muktinath.“
„Als Pilger?“
„Nein, wir haben die heiligen Quellen nützlich gemacht. Das Wasser verrohrt, damit es Turbinen antreiben kann. Seitdem haben sie im Dorf Strom.“
Und ich wunderte mich damals, warum das Wasser, unter dem sich Kashinath die Sünden abwusch, aus Rohren sprudelte. Sie ragten ein paar Zentimeter aus dem Berg heraus. Und es sah etwas unheilig aus.
„Aber Turbinen brauchen sie heute nicht mehr. Inzwischen haben sie Masten da oben und sind voll elektrifiziert. Und es gibt auch eine Straße nach Muktinath. Sogar einen Helikopter-Shuttle. Sie können von Pokhara direkt bis zu den Quellen fliegen. Wollen Sie das?“
„Nein, ich will nur den Yogi wiederfinden. Er hat mich sehr fasziniert.“
„Was war seine Philosophie?“
„›I’m ready for everything.‹“
Der Nepali lächelt. Das kann ich so oder so verstehen. Um sicherzugehen, dass er mich nicht für leichtgläubig hält, erzähle ich ihm, a) wie ich diesen Satz interpretiere und b) wie der Yogi gecheckt wurde. Zu a: Bereit für alles zu sein bedeutet, keine Angst mehr zu haben, und wer keine Angst hat, keine einzige, auch nicht die klitzekleinste, ist frei, und wer frei ist, hat alle Kräfte, die von der Angst absorbiert werden, zur freien Verfügung. Um, zum Beispiel, noch tiefer in die Angstlosigkeit zu gehen. Zu b: Am Ende unserer Wanderschaft flogen wir von Jomson nach Pokhara zurück, und die Maschine wäre auf ihrem kurzen Flug drei Mal fast abgestürzt. Es war ziemlich krass. Beim ersten Mal lachten noch einige der etwa 30 Passagiere, beim zweiten Mal nicht mehr, und beim dritten Mal war die Hölle los. Panik. Alle schrien in Todesangst, auch ich, nur der Yogi neben mir blieb so tiefenentspannt mit allem einverstanden, wie ich ihn seit zwei Wochen erlebt hatte.
„Welche Fluggesellschaft war das?“
„Shangri-La Air.“
„Aber die ist doch wirklich abgestürzt.“
„Ja, ein Jahr später. Ich habe die Fotos von der zerschellten Maschine in den Zeitungen gesehen. Sie können mir glauben, das war unheimlich.“
Sein Fahrer ist da.
Die in den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes beschriebenen Straßen von Kathmandu sind leider schlimmer als beschrieben. Das liegt, glaube ich, nicht an den mangelnden Fähigkeiten des Verfassers, sondern daran, dass sie unbeschreiblich sind. Das Hotel befindet sich etwa zehn Kilometer außerhalb der Metropole, aber wir sind noch immer in einem Randbezirk und nicht etwa in der Wildnis. Auf einer der Hauptverkehrsadern der Stadt quälen wir uns im Schneckentempo über eine eigentlich unbefahrbare Piste, aber alle befahren sie. Alle gegen einen und einer gegen alle. „No rules“, sagt der Fahrer. Jeder nutzt seine Chancen, obwohl keiner eine hat. Schlaglöcher, Mulden, Querrinnen und Gräben lösen sich quasi ohne problemfreie Übergänge ab, und alle sind mit schlammigem Wasser gefüllt, man sieht nicht ihre Tiefen. Was vom großen Erdbeben übrig blieb, wird nun vom Monsun gefressen.
Dass der erste Wagen für meinen Flughafen-Freund zusammenbrach, wundert mich jetzt kein bisschen, mich wundert nur, dass der zweite noch fährt. Unermüdlich arbeitet die Straße an seiner Ruinierung, die Stoßdämpfer sind, wie mir scheint, schon weg. Es schockiert mich nicht, es belustigt mich eher, aber als ich spüre, dass meine Bandscheiben nun die Stoßdämpfer sind, erkenne ich den Ernst der Lage. Es braucht ein neues Reisekonzept. Über diese Straßen kann ich auf meiner Suche nach Kashinath nicht lange fahren. Und gehen auch nicht. Es regnet grad nicht, aber fast wünschte ich es, damit der Regen die Luft rein wäscht. Die Fenster unseres Kleinwagens sind geschlossen, und die Aircondition ist an, darum rieche ich den Smog nicht. Ich kann ihn nur sehen. Das ist nicht schön. Eine Welt ohne Licht, und auch die Farben haben gegen das Grau verloren. Die Reklameschilder der Läden, Werkstätten und Chaibuden knallen nicht mehr, den Saris der Frauen ist der Zauber genommen, das bunte Asien ist weg. Auch das Lächeln ist verschwunden. Jeder Zweite trägt eine Atemmaske aus einem dünnen weißen Stoff oder hat einen Schal um Mund und Nase geschlungen. Und wer darauf verzichtet, schaut so traurig aus der Wäsche wie die Frau, an der wir gerade vorbeifahren, eine junge, schöne Frau mit ihrem Baby im Arm. Vielleicht ist es auch ihr Mann, der sie traurig macht, oder jemand ist gestorben, es gibt viele Gründe, warum eine junge Mutter schlecht drauf sein kann, aber für mich ist das ein Smog-Gesicht.
Wir fahren über eine Brücke, unter der ein dunkler Fluss Abwasser und Unrat transportiert, danach sind wir nicht mehr in Kathmandu, und die Straße wird noch schlechter, aber auch grüner zu beiden Seiten. Da ist ein Wald, es stellt sich heraus, dass er zum Hotel gehört. Ein Schlagbaum öffnet sich, ein Wachmann salutiert. Es geht bergauf, die Straße wird gut, von dem Horrorverkehr ist nichts mehr zu sehen. Nur noch Bäume und hier und da Orchideen. Ich wusste es. Mein Flughafen-Freund ist eine Qualitätsbekanntschaft. Er führt mich an genau den Ort, den ich jetzt brauche. Das Hotel hat fünf Sterne und eine zehn Kilometer lange Golfwiese.
„Namaste.“
Die Empfangsdame schmilzt dahin vor Freude, ihren Job machen zu dürfen. Synchron dazu schmilzt der Preis für mein Zimmer. Von 250 auf 150 Euro in maximal 60 Sekunden. Aber es ist in einem Nebengebäude, und der Weg dahin ist manchen Gästen zu weit. Darum ist es billiger. Spricht sie von Trekking? Nein, von etwa 200 Metern. Es wird ein schöner Spaziergang durch die kultivierte Natur des Himalaja in 1400 Meter Höhe. Ein paar Äffchen und der Page begleiten mich. Aber nicht nur der Weg, auch das Ziel lohnt sich. Ein Fünfsterne-Reiseschriftstellerzimmer, mit hohen Wänden, vielen Fenstern, großem Bett und einem Schreibtisch, dem zuzutrauen wäre, dass er ein Buch selbst verfasst. Man braucht nur Platz zu nehmen, und aus dem Holz steigen Sätze empor.
„Darf ich rauchen?“
„Natürlich, Sir“, sagt der Page.
Endlich im Internet, endlich Scarlett. Zwei Mails. Das von vorgestern schrieb sie in der Transithalle von Neu-Delhi und ist wenig hilfreich im Moment, denn sie schwört darin, dass der Fahrer am Flughafen sein wird, doch das Mail von gestern kommt der Wahrheit näher. Nach dreimonatiger Abwesenheit habe ihr Haus sie in einem totalen Chaos empfangen, und es sei vielleicht besser, ich würde für die erste Nacht ein Hotel nehmen. „Ruf mich an.“ Und endlich ihre Telefonnummer.
„Hi, Helge.“
„Hi, Scarlett.“
„Wo bist du?“
„Im Gokarna Forest Resort.“
„Oh, das ist wunderbar.“
„Ja.“
„Komm heute Abend zu mir. Wir gehen mit Freunden essen. Nein, besser, du kommst schon etwas früher. So um fünf oder sechs.“
„Gern. Und schickst du mir wieder einen Fahrer?“
„Oh, Helge, so sorry …“
Erleichterung macht sich breit. Das Wichtigste ist geregelt, und mir bleibt genug Zeit. Als Erstes brauche ich Kaffee und Spiegeleier, dann einen Spaziergang durch das Resort und seine halbwegs frische Luft, vielleicht auch eine Massage oder ein paar Runden im Pool. Was ich aber auf keinen Fall gebrauchen kann, ist das wunderbare große Bett, zu dem es mich zieht wie einen Nagel zum Magnet. Wenn ich jetzt schlafe, bin ich heute Nacht wach. Dann schlafe ich morgen zu lang und krieg auch die nächste Nacht kein Auge zu, nein, den Jetlag sollte man in der ersten Runde ausboxen oder besser: ausschleichen. Wie auf Wolken wandeln und wie in Watte Platz nehmen.
Zurück im Hauptgebäude des Hotels, sitze ich unter den Arkaden des Innenhofs und schaue einem Soldaten zu, der mit seiner Zwille einen Affen vertreibt. Meine Spiegeleier habe ich bereits gegessen, ich trinke Kaffee, rauche und warte auf meine Seele. Man sagt, sie hinkt bei langen Flügen dem Körper etwas hinterher. Stattdessen kommt der Energie-Nepali zu mir an den Tisch.
„Haben Sie ein gutes Zimmer bekommen?“
„Ja, und auch für Ihren Preis. Vielen Dank noch mal. Es ist wirklich ideal. Groß, hell, und vom Balkon sehe ich in den Wald.“
„Sie wissen, dass Sie die Fenster und Türen immer geschlossen halten müssen?“
„Nein, warum?“
„Sonst kommen die Affen rein. Und haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?“
Ich bin froh, dass er wieder da ist, aber vielleicht auch ein bisschen zu müde für seine Intelligenz. Doch er ist genauso müde wie ich und verfolgt denselben Plan. Wach bleiben bis zum Abend, das heißt Kräfte sparen. Wir wollen also das unangestrengte Gespräch und sprechen über Maoisten und Touristen. Er sagt, bis zum Ende des Bürgerkriegs und ihrem Einzug ins Parlament hätten die Maoisten Zehntausende Menschen umgebracht. Darunter war aber nicht ein Tourist. „Niemand erschießt gern seine Milchkuh“, sage ich, und er stimmt dem zu. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle Nepals. Auf den König können sie verzichten, aber nicht auf den Gast. Das große Erdbeben und seine noch immer nicht behobenen Folgeschäden hätten das Land an den Rand des Ruins gebracht, erklärt der Nepali, die Besucherzahlen seien zunächst auf 300 000 jährlich gesunken, aber inzwischen, Gott sei Dank, wieder auf 500 000 gestiegen. Was ihn erleichtert, schockiert mich.
„Ich war neulich in Saint-Tropez. Der Ort hat etwas mehr als 4000 Einwohner und fünf Millionen Touristen im Jahr.“
„Ich weiß, was Sie meinen“, sagt er und senkt den Blick.
Verliert er jetzt etwa das Gesicht? Das muss er nicht. Nepal ist arm, er nicht. Er lebt in Washington, hat schöne Töchter und bringt Licht in die Welt. Und ich? Sagen wir es mal so: Ich suche den Yogi Kashinath. Kashi heißt Licht, und Nath heißt Stadt. Auf ’ne Art sind mein neuer Freund und ich in derselben Branche. Einer für draußen, einer für drinnen. Gemeinsam gegen die Dunkelheit. Aber ich mache einen Fehler. Ich frage ihn nach dem Thema seiner morgigen Energieexpertenkonferenz, und als er antwortet, wird es zu kompliziert für meine Schwerhörigkeit. Hellwach wäre das kein Problem, aber hellwach war vorvorgestern. Wenn ich mein Gegenüber nicht schon beim ersten unverstandenen Satz unterbreche, mache ich das auch beim zweiten und dritten nicht, und ab dem fünften wäre es endgültig peinlich, sich ihm zu offenbaren, weil es das Geständnis beinhalten würde, dass man seine Zeit verschwendet hat.
Deshalb gebe ich mich weiter dem wohligen Gefühl hin, müde einer Stimme zu lauschen, die wie Hintergrundmusik funktioniert. Ich habe das mittlerweile so perfektioniert, dass man glauben könnte, dem besten Zuhörer der Welt begegnet zu sein. Einem, der nichts versteht, aber ständig nickt. Der Nepali macht eine Pause und schaut mich an. Ich nicke. Vielleicht ist es auch keine Pause, sondern das Ende seines Vortrags. Ich nicke. Nein, es war doch eine Pause, er redet weiter. Aber nur kurz. Dann schaut er mich wieder an. Ich nicke. Weil er weder erneut zu sprechen beginnt noch den Blick von mir nimmt, nicke ich ein weiteres Mal, und jetzt hat er mich durchschaut. Seine Pupillen ziehen nach oben, seine Augen werden kalt. Er wendet sich ab, und es tut mir leid, wie jedes Mal, wenn ich zu spät verstehe, dass mir Fragen gestellt wurden, die man nickend nicht beantworten kann. Dafür hätte es eine nachdenkliche Gestik gebraucht, die Abwägen vortäuschte, und auch diese durchaus sympathische Zögerlichkeit, These und Antithese unverzüglich der Synthese zuzuführen.
Wie zu erwarten war, verabschiedet er sich nun bald und wünscht mir einen guten Tag, den ich wunschgemäß im Tal der Könige in Angriff nehme. Es war ihr Jagdrevier, von alters her. Ein gemütlicher Weg führt zu ihm hinab. Eingebettet zwischen bewaldeten Hügelketten, ist es jetzt der größte Golfparcours Asiens. Wie ein breiter grüner Fluss liegt ein Teilabschnitt der perfekt gemähten, zehn Kilometer langen Wiese unter mir. Kein Mensch, kein Affe ist auf ihr zu sehen. Das beflügelt meine Fantasie, in der weder Golfspieler noch jagende Könige eine Rolle spielen, sondern Krishna, der Gott der Liebe, der dort unten mit seinen Groupies und zahmem Rotwild spazieren geht.
Zurück auf den Straßen Kathmandus, ist das Taxi, das mich zu Scarlett bringt, in einem schlechteren Zustand als der Wagen meines Ex-Flughafen-Freunds, er ist auch kleiner und bescheidener ausgestattet, und sollte es mal Haltegriffe für die Passagiere neben der Rückbank gegeben haben, sind sie längst abgerissen. Es würde mich nicht wundern, wenn von der Klapperkiste alle 20 Meter etwas abfiele, eine Reifenkappe hier, ein Kotflügel da, bis am Ende nur noch ein Skelett mit Fetzen der Karosserie übrig bliebe. Aber all das passiert nicht. Es gibt anscheinend zwei Möglichkeiten, was die Schlaglöcher von Kathmandu mit Kleinwagen machen. Entweder sie zerlegen sie, oder sie rappeln, stauchen und schlagen das Fahrzeug in einer Art und Weise zusammen, dass eine Bergziege draus wird. Hinten ist das nicht mehr länger auszuhalten, darum steige ich nach vorne um. Jetzt habe ich wieder einen Haltegriff über der Seitentür und mehr Beinfreiheit, bin aber auch dem Husten des Fahrers näher. Er hustet durchgehend. Nur weil ich ein Hypochonder bin, heißt das nicht, dass der Typ keine Tuberkulose hat. Derzeit hustet er in mein Handy, denn am anderen Ende der Leitung beschreibt Scarlett ihm den Weg zu ihr. Das dauert, weil er so viel hustet, und das Roaming geht dabei vermutlich über die Schweiz.
Wir sind mittlerweile in ihrem Stadtteil. Er heißt Bodnath, und die Straße, auf der wir unser Glück versuchen, heißt Bodnath Main Street. Auch sie ist nicht besonders attraktiv. Was das Erdbeben zerstört hatte, wurde zwar wieder aufgebaut, aber anders als vorher. Auch mit anderen Materialien. Alles in allem sieht es deshalb zu beiden Seiten der Bodnath Main Street nicht mehr so aus wie in der märchenhaften Hauptstadt eines Himalaja-Königreichs, sondern wie in jedem Drecksloch Asiens, aber immerhin herrscht in den Geschäften die Warenwelt der Gegenwart, auch wenn die Straße selbst stur im vorindustriellen Zeitalter verbleibt. Doch mein Fahrer ist ein guter Mann. Er findet die kleine Nebenstraße, in die er einbiegen soll, und quält uns durch den Schlamm. Dann bleibt er stehen und ruft noch mal an. Gleich darauf kommt ein gut aussehender Nepali um die 30 zum Taxi und nimmt mich mit einem ehrlichen Lächeln in Empfang. Er ist keine Ausnahme in diesem Land. Im Gegensatz zu Thailand, wo das Lächeln alles oder nichts bedeuten kann, in der Regel aber nichts, lächelt in Nepal der Unfreundliche nicht.
„Namaste“, sagt er.
„Namaste“, sage ich. „Sind Sie Scarletts Fahrer?“
„Nein.“ Er lacht. „Ich bin ein Freund. Ich nutze ein Zimmer in ihrem Haus als Büro. Kommen Sie, ich bringe Sie zu ihr.“
Vorher handelt er den Preis fürs Taxi von 600 Nepalesischen Rupien auf 500 herunter. Das tut mir ein bisschen leid, weil der Fahrer noch immer hustet und 600 Rupien nicht mehr als 4,80 Euro sind. Ich bin in keiner Non-Governmental Organization, und ich spende auch nie etwas für die Armen dieser Welt. Das ist mir zu anonym. Für bürokratisierte Ablasszahlungen gegen das schlechte Gewissen fehlt mir ein Organ, was nicht heißt, dass ich herzlos bin. Es ist nur so, dass mein Mitgefühl den Vollkontakt braucht. Dann aber gebe ich nicht nur gern, sondern auch gern zu viel. Zu hohe Trinkgelder, zum Beispiel, können durchaus die Lebensqualität des Beschenkten versauen, weil er enttäuscht sein wird, wenn das nicht ständig wieder passiert. Und einen unkorrekten Preis aus Mitleid zu akzeptieren, obwohl ein Verbündeter bereits daran arbeitet, ihn auf das landesübliche Niveau zu regulieren, ist auch keine gute Tat, weil der Helfer dann das Gesicht verliert. Außerdem ist „wir helfen“ grundsätzlich etwas anderes als „wir lassen uns verarschen“.
Zufrieden mit seinen 500 Rupien, hustet mein Taxifahrer von dannen, während wir durch ein paar Pfützen auf ein Tor zugehen, hinter dem die Welt schlagartig in Ordnung käme, wenn der Smog nicht wäre. Ein Vorhof, ein Garten, Bäume, Blumen, gemähter Rasen und in der Mitte dieser kleinen Oase ein bezauberndes, aber vor allem solides zweistöckiges Haus mit überdachter Veranda und Balkonen. Wir gehen rein und die Treppe nach oben. Zwei offene Türen. Die rechte führt in das Büro des Nepali, die linke zu meiner allerbesten Freundin.
Scarlett ist eine Misch-Ethnie. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Man stelle sich vor, sie hätte von dem britischen Anwalt das Aussehen und von der indischen Tänzerin die intellektuellen Kapazitäten geerbt. Glücklicherweise verhält es sich umgekehrt. Von beiden nur das Beste, und davon reichlich. Von ihrem Vater hat sie den IQ, den Humor und wahrscheinlich auch die Unmoral, von der Mutter die Schönheit, Anmut und Empathiefähigkeit. Dazu kommt die tiefe Verankerung in zwei großen Kulturen. Kindheit in Indien, eingeschult in London. Materiell und spirituell ist sie bestens aufgestellt. Sie kann denken, und sie kann meditieren. Sie kann sogar schreiben. Weil sie, wie ich, in den 60er-Jahren pubertierte, ist sie, wie ich, ein Hippie geworden und, wie ich, über Land nach Indien gefahren, auch hat sie schnell kapiert, dass Journalismus Reisen finanziert. Alles wie ich, trotzdem kreuzten sich unsere Wege erst, als wir so um die 50 waren. Bis dahin gab es nur einen gemeinsamen Freund, der mir manchmal von ihr erzählte. „Ich kenne einen Menschen, der ist du als Frau.“ Und ihr erzählte er den umgekehrten Sachverhalt. Erst beim Kumbh Mela 1999 war es so weit. Das größte Fest der Hindus, zu dem alle zwölf Jahre über zehn Millionen Inder in die am Fuße des Himalaja liegende indische Stadt Haridwar pilgern, war für sie wie für mich ein Pflichttermin der klassischen, großen Reisereportage, und weil alle Journalisten im Hotel Ganga View abstiegen, konnten wir uns nun nicht mehr verpassen. Der heilige Fluss Indiens stand dem Beginn einer großen Freundschaft Pate. Das daraus nicht eine große Liebe oder eine schlechte Affäre wurde, hatten wir unserem Beziehungsmuster zu verdanken, das sich ebenfalls wie ein Ei dem anderen gleicht und nur jüngere Sexualpartner akzeptiert.
Und da ist sie. Halb indisch, halb britisch und mit neuer Frisur. Na ja, was heißt neu? Wir haben uns sieben Jahre nicht gesehen. Oder zehn? Und wo zuletzt? In ihrer Wohnung in Neu-Delhi? In Marokko? In Brighton? Ich könnte das auf Anhieb nicht beantworten. Aber sie ist schon wieder jünger geworden. Nur kleine Freundschaften muss man pflegen. Große stecken kargen Mailverkehr, und auch den nur sporadisch, locker weg. Nach einer Begrüßung, die ausfällt, als hätten wir uns erst gestern gesehen, halten wir mit Kaffee und im Stehen eine kleine Küchenkonferenz ab. In drei Tagen fliegt sie nach Bangkok und von dort nach Australien. In einem Monat kommt sie zurück. Solange kann ich hier alles haben. In der Zeit, die bis zu ihrem Abflug verbleibt, muss sie mir das Haus erklären und ein ernstes Gespräch mit mir über das Bücherschreiben führen.
„Aber als Erstes brauchst du ein zweites Handy mit einer nepalesischen Nummer“, sagt Scarlett. „Niemand ruft hier eine Schweizer Nummer zurück.“
„Und ich brauche einen Übersetzer oder eine Übersetzerin.“
„Na klar, wer braucht das nicht. Ich kümmer mich drum. Und wir müssen wirklich übers Schreiben reden, Helge, ernsthaft.“
„Gern, Scarlett, aber nicht heute.“
„Nein, heute gehen wir essen und haben es nett. Ach ja, dein Zimmer.“
Sie zeigt es mir. Ein großes Bett, ein großer Schreibtisch, zwei Fenster mit Holzlamellen, Blick in den Garten. Fast bereue ich es, nicht heute schon darin zu schlafen, aber wirklich schlimm ist das nicht, denn ich weiß nun, dass alles gut wird.
Noch besser wird es auf den kleinen Wegen, die backstage von der Hauptstraße kreuz und quer durch ihr Viertel führen. Keine Autos, kaum Motorräder, fast nur Fußgänger, viele Tibeter, die meisten entspannt. Mal wenig Licht, mal gar keins, und dann, ohne Vorwarnung, denn ich denke, wir gehen nur zu einem Restaurant, ist Schluss mit der Dunkelheit, und wir stehen vor der Stupa von Bodnath im vollen Lichterglanz. Das Mekka der Buddhisten, wie eine Pyramide gebaut. Seit Jahrhunderten pilgern die Gläubigen aus allen Provinzen des Landes, aber auch aus Tibet und mittlerweile der ganzen Welt an diesen Ort, um ihn im Uhrzeigersinn zu umrunden und dabei Mantras zu murmeln. Sie murmeln im Gehen, sie murmeln im Stehen, sie murmeln im Sitzen, man kann sich diesem Murmeln nicht entziehen. Und ich bin sofort gut drauf.
Um den breiten Pfad der Murmler zieht sich ein noch breiteres Rund, auf dem die Menschen einfach nur bummeln, plaudern, rauchen oder sonst was tun, und da herum, auch fast rund, liegt die Häuserfront mit ihren Devotionaliengeschäften, Souvenirshops, Reisebüros und Restaurants. Scarlett führt mich ins La Casita, ein spanisches Lokal, in dem die Chefin spanischer als die Speisekarte ist, obwohl sie sich Moon nennt, so wie der Mond, der heute fast voll über der Stupa thront. Von der Terrasse im zweiten Stock haben wir einen Logenblick auf alles. Der Rotwein kommt. Außer Moon sind noch ein in Kathmandu lebender englischer Teppichhändler und zwei junge Portugiesen mit zu Tisch, wir ruhen in orientalischen Polstern, Scarlett stellt mich vor.
„Helge ist fast taub. Ihr müsst laut mit ihm reden.“
„Nein“, sage ich, „nicht laut. Nur langsam und deutlich.“
„Ich weiß, wovon du sprichst“, sagt der Teppichhändler. „Ich habe dasselbe Problem.“
Wie viele in meinem Alter. Allerdings ist er zehn Jahre jünger als ich. Aber er war mal Musiker, und der Rock ’n’ Roll hat ihm auf die Ohren gehauen. Trotzdem versteht er mich viel besser als ich ihn, weil mir bei ihm das Lippenlesen auch nichts bringt. Ich habe das nie bewusst gelernt, nur nebenher, eigentlich automatisch, erst während einer Reportage über eine Hüftgelenkoperation bekam ich mit, wie sehr ich bereits ein Lippenleser geworden war, denn alle Ärzte und Assistenten, mit denen ich sprach, trugen Mundschutz. Ich verstand nichts, absolut nichts, und sie konnten das Nichts so oft wiederholen, wie sie wollten, es blieb beim Nichts. Seitdem weiß ich auch, warum ich bei deutschen Filmen die Dialoge verstehe und bei ausländischen nicht. Man wird verrückt, wenn man die Stimme des deutschen Synchronsprechers hört und dazu Lippen liest, die englisch sprechen, französisch, spanisch, italienisch, was weiß ich. Darum sehe ich so gern Actionfilme, da kriege ich alles mit. Der englische Teppichhändler aber trägt weder einen Mundschutz, noch wird er synchron auf Deutsch übersetzt, sein Problem, oder besser, mein Problem ist, dass er einen Londoner Vorortdialekt spricht. Um den Fehler von heute Vormittag nicht zu wiederholen, warne ich ihn rechtzeitig.
„Ich werde lachen, wenn du lachst, und ernst schauen, wenn auch dir nicht nach lachen zumute ist, und wenn du dich mal aussprechen willst, super, ich habe überhaupt kein Problem mit langen Monologen, nein, wirklich, wir werden uns blendend verstehen, solange du keine Fragen stellst.“
Leider versteht nur Scarlett den Witz. Und weil sie weiß, dass es so immer am besten ist, führt sie weiterhin die Kommunikation und erzählt von meiner Mission. „Er sucht einen Yogi, den er mal vor 15 Jahren in Nepal kennengelernt und dann aus den Augen verloren hat, wie hieß er noch, ach ja, Kashinath. Kennt den hier irgendwer zufällig?“
Scarletts Witze verstehen alle. Aber sie hat ja recht. Mein Yogi ist ein Wandermönch, ein frei laufender Asket, ein Permanentpilger, der sein Leben damit verbringt, alle kleinen und großen heiligen Orte des Hinduismus abzuklappern, in Nepal wie in Indien, und wenn er damit durch ist, so erzählte mir Kashinath damals, will er sich zurückziehen. Die Höhle dafür hatte er bereits gefunden, aber er verriet mir nicht, wo sie ist.
„Mission impossible“, sagt Scarlett.
„Vielleicht auch nicht“, sagt Moon.
Ich kann mir denken, warum sie mir eine Chance gibt. Die spanische Chefin des spanischen Restaurants wurde von ihren spanischen Eltern sicher nicht Moon genannt, es ist also ein Künstlername oder ein spiritueller. Einen Künstlernamen aber braucht sie für ein Restaurant nicht, darum tippe ich auf Osho, früher Bhagwan, seine Schüler und Schülerinnen haben alle einen neuen Namen bekommen, und alle hören sich so schön wie Moon an. Wer einen Guru hat, versteht die Suche nach einem Guru, auch wenn sie irrational ist, dabei habe ich in Kashinath nie meinen Guru gesehen, niemals könnte ich seinen Weg gehen und will es auch nicht, ich sehe eher einen Freund und Bruder in ihm, der mir ein Geschenk machte, das sich als sehr wertvoll erwies.
„Was für ein Geschenk?“, fragt Moon.
„Ein Mantra.“
Auch das muss ich ihr und niemandem hier im Angesicht der Stupa von Bodnath und ihren Murmlern näher erklären. Alle wissen, dass ein Mantra kein Opel ist, Mantras sind Worte, die wirken. Nicht durch ihren Inhalt, sondern ihre Lautschwingungen. Sie massieren das Gehirn von innen, sie schwingen die Stressneuronen raus, andere machen das genaue Gegenteil und putschen auf, für jeden ist etwas dabei, sie haben sogar ein Mantra, um Tiger ruhigzustellen.
„Wirklich?“, fragt Moon.
„Das waren die Worte von Kashinath. Er sagte, es wirke bei allen Katzen. Auch bei den kleinen. Aber das habe ich nie gebraucht.“
Ich brauchte damals dringend ein Mantra gegen die Angst. Als ich Kashinath kennenlernte, war ich in einer schwierigen Phase. Ich wurde 50 und stand mit beiden Beinen fest auf den Scherben meines Lebens. Falsche Drogen, falsche Frauen und eine falsche Bewegung beim Anschieben eines Kleinwagens hatten meine Gesundheit, meine Finanzen, meine Karriere und mein Selbstvertrauen gründlich versaut. Die Kombination aus Pleite und Bandscheibenvorfall wäre noch zu meistern gewesen, aber freie Journalisten, die nicht mehr an sich glauben, sind in unserer Branche so begehrt wie Schmeißfliegen. Wenn du nicht an dich glaubst, warum sollen die andern es dann tun? Außerdem hatte ich Feinde.
„Unterm Strich kam Angst dabei heraus. Angst, so groß und schwer wie ein Mühlstein.“
Jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit von jedem hier am Tisch. Ich spüre es energetisch, kann es aber auch sehen. Allen wachsen die Ohren. Und dass nur ich rede, ist die klassische Win-win-Situation. Sie sind gut unterhalten, und ich verstehe endlich mal was.
„Die Angst sah jeder. Sie war in meinen Augen. Und wenn ich eine Sonnenbrille trug, verriet mich meine Stimme. Und wenn ich sie verstellte, verriet mich das auch. Die Angst ist ein großer Verräter. Sie trieb mich die Berge hinauf, und nach der Wanderschaft mit Kashinath war ich zwar schon ein bisschen besser drauf, aber er gab mir trotzdem das Mantra mit nach Haus. Kümmer dich nicht um deine Feinde, sagte er. Und benutz es, wenn du es brauchst. Dann wird alles gut, du wirst sehen.“
„Hat es geholfen?“, fragt Moon.
„Ja.“
„Wie?“
„Stell dir eine nervöse, zackige Stressschwingung im Gehirn vor. Sobald ich das Mantra murmelte, wurde zuerst ein glatter, flimmernder Strich daraus, und dann war auch der weg. Wie auf einem Bildschirm, der ausgeht.“
„Kannst du es uns verraten?“
„Nein, noch nicht. Deshalb bin ich hier. Ich will Kashinath fragen, ob ich es darf. Und ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Er hat es mir ins Ohr geflüstert, und ich höre nicht gut, wie ihr wisst.“
Die Stupa, auf die wir währenddessen schauen, ist von Lichtgirlanden überzogen. Unten, bei den Murmlern, flackern die Butterkerzen, und Moons Terrasse leuchtet orientalisch. Der Abend ist grad wunderschön und Buddha präsent. Seine Augen sind in Wagenradgröße in der Mitte der Stupa angebracht und sehen uns direkt an. Der spanische Rotwein und die Pasta aglio e olio runden das Wohlgefühl ab, nur das Glas mit dem Wasser rühre ich nicht an.
„Du kannst es ruhig trinken“, sagt Scarlett. „Bei Moon ist alles sauber.“
Ich glaube das gern, was alles andere angeht, nur beim Wasser glaube ich es nicht. Es kommt aus der Leitung. Es würde mir noch heute Nacht sehr schlecht gehen, wenn ich es tränke. Das ist in Indien so, das ist in Nepal so, und es dauert bis zu zwei Wochen. „Filtert ihr es?“, frage ich Moon. Sie schüttelt den Kopf. Darum lasse ich auch die Finger von den Oliven. Denn womit sind die gewaschen? Keine Salate, kein ungeschältes Obst, kein Eis in der Cola, kein Eis im Whiskey, selbst die Zähne werde ich mir mit Mineralwasser putzen. Das erinnert Scarlett umgehend an ihr Schicksal.
„Er hat mal ein Buch über Indien geschrieben. Das erste Kapitel hieß ›Die Maus lebt im Wasserfilter‹. Das war mein Filter, in meiner Küche.“
Moon schaut sie erstaunt an.
„Stimmt das?“
„Natürlich nicht.“
Die alte Geschichte. Ich habe sie zur Gefangenen eines Buches gemacht, und darin steht, dass ein Nagetier ihr Wasser filtert. Scarlett trägt es mit Humor. Und so war es ja auch gedacht. Wann immer das Thema hochkommt, geht der Spaß von vorne los. Ich nehme die Nachhaltigkeit meiner Aussage zurück, indem ich sage, dass die Maus vielleicht nicht in dem Filter wohnte, sondern nur kurzfristig darin verschwand und dann vielleicht ertrank, und Scarlett sagt, Bullshit, das geht einfach nicht, die kann da nicht rein, und natürlich gibt ihr Moon recht, und auch alle anderen am Tisch, aber ein Restzweifel bleibt. Nur bei Scarlett nicht. Sie trank, nachdem ich ihr damals beim Frühstück von meinem nächtlichen Erlebnis in ihrer Küche erzählt hatte, sofort von dem besagten Wasser und schmeckte keinerlei Maus-Aroma darin. Auch keine Tote-Maus-Geschmacksnote. Das gibt ihr die Sicherheit.
„Helge spinnt“, sagt sie.
„Wie schön“, sagt Moon.
Fürchtet sie, ein ähnliches Schicksal wie Scarlett zu erleiden? Oder erhofft sie es? Ich glaube nicht, dass sie einen Hypochonder über ihr Wasser berichten lassen will. Aber ich glaube auch nicht, dass sie glaubt, ich würde das tun, so nett, wie ich grad bin. Das ist der Trick der meisten Autoren. Erst am Schreibtisch zeigen sie ihr wahres Gesicht. Doch das weiß sie nicht und muss sie auch nicht wissen, ich würde es eh nicht tun, dafür ist Moon viel zu moon und das La Casita viel zu angenehm, sie hat hier einen wundervollen Platz zum Abhängen mit dem Erleuchteten geschaffen, dafür danke ich ihr. Und meiner besten Freundin bin ich dankbar, weil sie mich gleich am ersten Abend hergeführt hat. Auf Scarlett ist immer Verlass.
„Und jetzt bist du hier, um ein neues Buch zu schreiben?“, fragt Moon.
„Ja, aber heute komme ich erst mal an.“
Das ist ein bisschen unkorrekt. So wie alles ein bisschen falsch und ein bisschen richtig ist. Und dazwischen liegt ein weites Feld, wie Rumi sagt. In meinem Beruf gibt es kein Erst-mal-ankommen-und-dann-an-die-Arbeit. Es gibt auch keinen Feierabend, kein Päuschen zwischendurch, kein Wochenende, keinen Krankenstand, kein Blaumachen. Es gibt nicht mal den Dienst nach Vorschrift. Sobald ein Reiseschriftsteller den heiligen Boden seines Themas betritt, ist Schluss mit lustig. Durchgehend. Vom Start weg bis zur Rückreise ackert er sich durch sein Buch. Vielleicht geht er darin verloren, vielleicht kommt er wieder raus, vielleicht geht er den Weg der Helden. Ich erzähle der Runde gern davon.
„Seit Homer sind alle guten Bücher und seit ›Rocky I‹ alle guten Filme nach demselben archaischen Muster gestrickt. Man nennt es den Mythos des Helden. Erst gammelt er rum, dann kommt die Aufgabe, und er geht los. Als Nächstes hat er es mit Prüfungen zu tun, eine schwerer als die andere, und wenn er sie besteht, fickt er die Prinzessin.“
„Und kriegt das halbe Königreich“, sagt Moon.
„Möglicherweise auch das ganze“, sagt Scarlett, „aber die Prinzessin fickt er auf jeden Fall. Es sei denn, er ist schwul. Dann ist der Prinz fällig.“
Scarletts britischer Humor in Kombination mit einer eigenwilligen Fastenkur, die Essen verbietet, aber Alkohol nicht, ist eine Oase in der Wüste meiner Ernsthaftigkeit. Bin ich wirklich hier, um von Kashinath für ein Buch über sein Mantra gegen die Angst autorisiert zu werden? Oder bin ich hier, weil ich hier sein wollte? Oder, auch das könnte ich mich fragen, bin ich hier, weil ich hier bin? Endlich wieder im Himalaja. Endlich wieder in Götternähe. Endlich wieder zu Haus. In der alten Heimat. Ich war jahrzehntelang davon überzeugt, die Gegend aus einem meiner früheren Leben wie meine Westentasche zu kennen, mittlerweile glaube ich nicht mehr an Reinkarnation, aber sobald ich hier bin, geht es wieder los. Ich will das nicht. Aber ich genieße das Gefühl.
Auf dem Rückweg zum Gokarna Forest Resort verstärkt es sich. In Bodnath klappt man früh die Bürgersteige hoch, es ist noch längst nicht Mitternacht, aber auf der Straße sind nur noch Hunde zu sehen. Menschenleer, kein Verkehr, ein Taxi und ich hintendrin. Für meinen Rücken ist das möglicherweise weiter schlimm, aber ich merke es nicht mehr so sehr, weil ich beschwipst bin. Der Rotwein federt die Schlaglöcher ab, das Heimatgefühl breitet sich wie eine Fruchtblase im Wagen aus, der Fahrer schweigt. On the road again. Und Feierabend. Nach einem erfolgreichen Tag. Ich habe Scarletts Hangout, morgen übernehme ich ihr Haus und das Personal, bis zu ihrem Abflug nach Bangkok sollte ich ihre komplette Infrastruktur im Griff haben, inklusive einem Übersetzer oder einer Übersetzerin, und das kriegt sie mit Sicherheit hin. Peter Scholl-Latour sagte einmal, man solle im Alter nur in Länder reisen, in denen man Kontakt mit jemandem habe, der alle Kontakte habe. Er hatte ja so was von recht.
Weil wir die Einzigen auf der Straße sind, erreichen wir schneller als erwartet den Stadtrand von Kathmandu und halten nun auf das Tal der Könige zu. Die Nacht umarmt mich, und zum ersten Mal seit meiner Ankunft bereue ich den Zeitrahmen, den ich mir gab. Vier Wochen, nicht mehr. Danach habe ich in Deutschland jede Menge zu tun. Doch wie sich das grad anfühlt, könnte es sein, dass ich in einem Monat noch einen Monat bleiben will, mit der Option auf ein, zwei weitere, also open end, denn wenn ich Kashinath nicht in Nepal finde, muss ich nach Indien, und dann gnade Gott meinem Terminkalender. Vielleicht muss ich auf die Berge, vielleicht muss ich in den Dschungel, vielleicht muss ich in die Wüste. Möglich ist vieles, fast möchte ich sagen, alles; auch, dass ich ewig bleiben möchte, ist möglich. Und in der Lobby des Gokarna Forest Resort schmilzt dann die Empfangsdame der Nacht vor Freude dahin, mir zwei Budweiser besorgen zu dürfen.

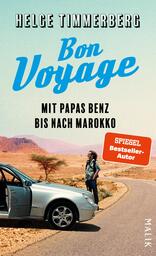


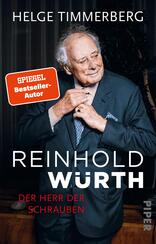

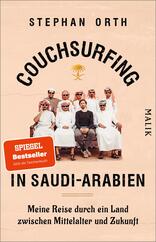
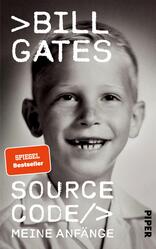
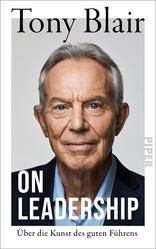





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.