
Der Besucher - eBook-Ausgabe
Roman
„›Die Besucher‹ ist ein überaus kurzweiliges und spannendes Kammerspiel im Weltall.“ - phantastik-couch.de
Der Besucher — Inhalt
Roman Briggs hat acht Tage zu leben. Nach dem Unfall seiner Raumkapsel treibt er schutzlos den Tiefen des Alls entgegen, ohne Hoffnung auf Rettung. Seine einzige tägliche Routine besteht darin, sich von den Vorräten in seinem Raumanzug zu ernähren, die viel zu schnell zur Neige gehen. Bis die Manti auftauchen, eine geheimnisvolle außerirdische Rasse. Briggs darf ihr Raumschiff nicht betreten, sondern ist gezwungen, sich an die Außenhülle zu ketten und dort im Schwerefeld des Schiffs zu überdauern. Durch die zahlreichen Fenster jedoch wird er in das alltägliche Leben seiner fremdartigen Retter hineingezogen. Bis zu dem Tag, als er etwas beobachtet, das er nicht beobachten durfte ...
Leseprobe zu „Der Besucher“
Kapitel 1
Als ich nach dem Schraubenschlüssel griff, explodierte das Schiff.
Quinn und ich waren seit gut einer Stunde im Außeneinsatz, um die Solarzellen zu reparieren, da erschütterte eine gewaltige Explosion im Inneren das ganze Raumschiff. Lautlos barst die Hülle im Weltraum und wir wurden in die Leere geschleudert.
Die an der Hüfte eingehakte Sicherungsleine hielt mich nach zehn Metern abrupt auf, woraufhin ich langsam zum Schiff zurückschwebte. Hektisch fuchtelte ich herum, bis ich mich an einem großen Solarmodul festhalten und das langsame Kreiseln [...]
Kapitel 1
Als ich nach dem Schraubenschlüssel griff, explodierte das Schiff.
Quinn und ich waren seit gut einer Stunde im Außeneinsatz, um die Solarzellen zu reparieren, da erschütterte eine gewaltige Explosion im Inneren das ganze Raumschiff. Lautlos barst die Hülle im Weltraum und wir wurden in die Leere geschleudert.
Die an der Hüfte eingehakte Sicherungsleine hielt mich nach zehn Metern abrupt auf, woraufhin ich langsam zum Schiff zurückschwebte. Hektisch fuchtelte ich herum, bis ich mich an einem großen Solarmodul festhalten und das langsame Kreiseln abbremsen konnte. Quinn rotierte schneller und schwebte strampelnd am Ende seiner Leine.
Ein langer Riss zog sich durch den ganzen Rumpf. Er war höchstens dreißig Zentimeter breit, aber das reichte aus, um die Besatzung zusammen mit der gesamten Atmosphäre und allen losen Gegenständen ins Vakuum zu saugen.
„Mann!“, hallte Quinns Stimme in meinem Helm. „Briggs! Briggs, wie geht es dir?“
„Alles klar“, antwortete ich. „Und dir?“
„Super. Sobald ich aufhöre, mich um mich selbst zu drehen.“ Er schwebte näher an das andere Ende des Solarmoduls heran und hielt sich fest. „Ah, was zur Hölle war das?“
„Unser Schiff ist geplatzt“, erklärte ich.
Wir starrten die Trümmer an – darunter viele Brocken mit menschlichen Formen –, die langsam davonflogen. Quinn fluchte. Ich konnte nur stumm nicken. Es war eine gespenstische, surreale Szene.
Schließlich holte ich Luft. Er suchte meinen Blick.
Wir sind allein. Sie sind alle tot!
„Hast du eine Ahnung, was passiert ist?“, fragte ich.
„Absolut nicht“, erwiderte er. „Aber wir haben ein Problem.“
„Ja“, stimmte ich zu. „Das kannst du wohl laut sagen.“
Ich sah den davonschwebenden Trümmern nach.
Quinn wischte mit der Hand über das Visier seines Helms und verschmierte dabei etwas Flüssiges. „Verdammt, was ist das?“
Irgendetwas im benachbarten Modul sprühte ihn mit einem giftgrünen Dunst ein.
Vorsichtshalber packte ich die Leine, verfolgte sie bis zum Ankerpunkt und zerrte ein wenig, um mich zu vergewissern, dass sie gut befestigt war. Das war der Fall.
Dann stieß ich mich ab und schwebte zu Quinn hinüber. Sobald ich nahe genug war, konnte ich über seine Schulter hinweg die Kühlrippen des Moduls erkennen, an dem wir gearbeitet hatten. Eine Kühlrippe war gerissen und spie erschreckend schnell das Kühlmittel aus.
Nun setzte mein Instinkt wieder ein und ich hangelte mich am Schiff entlang zum Ursprung der Fontäne. „Wir müssen das Loch abdichten!“, rief ich und griff in den Werkzeugbeutel an der Hüfte, um eine Autoklammer herauszuholen.
„Was?“ Er starrte immer noch seine Hände an.
„Es ist Kühlmittel“, antwortete ich. „Und irgendwie habe ich den Eindruck, das ist noch nicht mal der schlimmste Schaden.“
Wieder sah ich ihn an. Wie gebannt betrachtete er die eigenen Hände.
„Quinn!“, rief ich. „Mann, reiß dich zusammen und komm her.“
Schnaufend schwebte Quinn zu mir herüber.
Sobald ich den Riss in einer der Kühlschlangen gefunden hatte, öffnete ich die Autoklammer mittels Knopfdruck. Surrend zogen die Zahnräder die Backen auseinander. Als sie breit genug war, setzte ich die Klammer auf das gerissene Rohr und schob den Regler in die andere Richtung. Wieder arbeiteten die Zahnräder. Eigentlich konnte ich gar nichts hören, sondern spürte nur die Vibrationen im Anzug, als sich die Klammer langsam schloss und die Kühlmittelleitung zusammenpresste.
Da die Leitung jetzt abgeklemmt und der Kühlmittelstrom unterbrochen war, holte ich das Harz aus dem Beutel und ließ etwas auf den Riss tropfen; dann drehte ich die Tube herum. Auf der Rückseite waren zwei winzige Elektroden. Ich hielt sie an den Tropfen und brachte damit die Gerinnung in Gang. Es brutzelte, schließlich erstarrte die Masse und war so hart wie Stahl. Nachdem ich die Autoklammer entfernt hatte, untersuchte ich den Riss, ob immer noch Kühlmittel austrat. Anscheinend war alles in Ordnung.
„Eine Krise bewältigt“, sagte ich, während ich die Autoklammer in der behandschuhten Hand herumwirbelte und wieder in den Beutel steckte.
„Nur noch vierhundert weitere zu überstehen.“ Quinn deutete hinter mich. „Ich fürchte, das da kann man mit ein bisschen Harz nicht mehr flicken.“
Er zeigte auf die zweite Gruppe Kühlrippen weiter unten am Schiff. Oder vielmehr auf die Stelle, wo sich die Kühlrippen hätten befinden müssen. Dort klaffte ein Loch, aus dem ein anscheinend unerschöpflicher Strahl von Kühlmittel in den Weltraum schoss.
Eine zweite Explosion erschütterte das Schiff. Aus dem Spalt züngelten blaue Flammen, die sofort wieder erloschen. Mit verkrampftem Magen und leicht verschwommenem Blick klammerte ich mich an den Sonnenkollektor, der unter mir installiert war.
„SCHEISSE!“, schrie Quinn.
Das große Schott, an dem wir die Sicherheitsleinen befestigt hatten, riss aus den Scharnieren und flog direkt auf mich zu. Ich versuchte, neben dem Solarmodul in Deckung zu gehen, aber das Ding war zu schnell, und ich war im Raumanzug nicht sehr wendig. Der zwei Meter große Metallbrocken traf mich an der Schulter und drückte mich gegen eine Stützstrebe. Der Aufprall trieb mir die Luft aus den Lungen, dann wurde ich in den leeren Raum geschleudert. Sofort danach keuchte ich heftig, weil mir vom Schulterblatt bis zur Niere ein stechender Schmerz durch den Körper fuhr. An der Hüfte spannte sich die Leine und ich spürte einen Ruck, der mich von der Solaranlage wegriss. Unweigerlich geriet ich in Panik, strampelte im Vakuum und fand keinen Halt. Ich war schon viel zu weit draußen. Die verbeulte Schleusentür zog mich stetig weiter hinaus. Das Letzte, was ich sah, ehe ich das Bewusstsein verlor, war Quinn, der auf mich zuflog wie eine träge Abrissbirne.
Als ich zu mir kam, war das Schiff weit und breit nicht mehr in Sicht. Ich war mit der Leine an die verbogene Metalltür gefesselt. Mühsam sah ich mich um, drehte mich und blickte nach hinten.
„Es ist weg“, erklärte Quinn bedrückt.
Wie schön.
Ich tippte auf das Armdisplay, um den Computer zu starten, rief das Notfallmenü auf und schaltete das Notsignal ein. Dann sagte ich Quinn, er solle das Gleiche tun.
„Hab ich schon längst gemacht“, antwortete er. „Aber wer könnte uns hier schon hören?“
Ich zuckte mit den Achseln. Er hatte recht. Wir hatten auf einem Tiefraumforschungsschiff gearbeitet, hier draußen war weit und breit keine Menschenseele unterwegs. Es wird niemand kommen – oder jedenfalls nicht rechtzeitig.
Ich prüfte die Wasserzellen. Sie waren gut gefüllt, beinahe neunundsiebzig Prozent. „Quinn, wie sehen deine Zellen aus? Meine sind noch fast voll.“
Die Anzüge liefen mit Wasser. Einerseits versorgte es den Träger, andererseits konnte es der Anzug auch in Sauerstoff zum Atmen umwandeln und den Wasserstoff benutzen, um Computer, Funk, Heizung, Kühlung und die Abfallentsorgung zu betreiben. Wenn die Wasserzellen voll waren, konnte man im Anzug sieben bis zehn Tage überleben. Danach war man allerdings ziemlich hungrig.
„Das willst du nicht wissen“, antwortete er, nachdem er das Armdisplay konsultiert hatte. „Es war mehr als genug, um die Solaranlage zu reparieren, aber auch nicht viel mehr.“
„Genauer, bitte.“
„Acht Prozent“, sagte er.
Verdammt auch, dachte ich. „Das ist übel.“
Unsere Anzüge waren nicht kompatibel, ich konnte mein Wasser nicht weitergeben. Er trug einen alten Simmons J6, der fast zwei Jahrzehnte älter war als meine Montur. Ganz zu schweigen davon, dass die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Ventilsysteme einsetzten. Wir konnten meinen Wasservorrat nicht teilen.
„Wie effizient ist dein Anzug?“, fragte ich.
Er holte tief Luft und atmete langsam aus. „Mir bleiben noch zwölf bis fünfzehn Stunden. Vielleicht bringe ich es bis auf zwanzig Stunden, wenn ich nichts mehr trinke.“
Tag eins. Wir beschlossen, den Stoffwechsel und den Sauerstoffverbrauch zu reduzieren, indem wir schliefen. Für alle Fälle bestand Quinn darauf, dass wir uns abwechselten. Wir waren beide nicht sehr müde, also spielten wir Schere, Stein, Papier, um zu ermitteln, wer als Erster schlafen sollte. Ich verlor.
Als ich aufwachte, war Quinn tot. Er hatte die Zeit genutzt, um den Geist aufzugeben.
Dieser selbstsüchtige Dreckskerl.
Quinns Helm war offen, der Körper war schutzlos dem Vakuum ausgeliefert. Das Gesicht war aufgedunsen, lila verfärbt und mit Reif überzogen. Die Augen waren mit Blut und Eis verklebt.
Ich tippte auf sein Armdisplay. Die Reserven lagen bei drei Prozent. In einem halben Tag wäre er sowieso tot gewesen, und das hätten wir so oder so nicht verhindern können.
Mir wurden die Augen feucht, ich konnte nicht mehr richtig sehen. Der Anzug hinderte mich daran, sie mir sauber zu reiben. Ich konnte nur blinzeln.
Tag zwei. Ich erwachte mit knurrendem Magen und neben dem verstörend stillen Quinn, der an meiner Seite schwebte. Ein Stoß und unsere Wege würden sich trennen. Zwei Minuten später wäre er nichts weiter als ein kleiner Punkt im schwarzen Weltraum.
Stattdessen zog ich ihn heran und band ihn mit der Sicherheitsleine fest auf die Tür.
„Ich hoffe, das macht dir nichts aus, Kumpel, aber ich sehe mich jetzt nach einer neuen Bleibe um“, erklärte ich kichernd. „Vielleicht finde ich etwas mit Blick aufs Meer.“
Ich schloss seinen Helm. Das hätte ich schon am Vortag tun sollen.
„Mach’s gut, Mann. Du warst in Ordnung.“
Ich bezog mein Quartier auf der anderen Seite der Tür. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hoffentlich.
Tag drei. Der Hunger beherrschte mein ganzes Denken.
Ich schlief jetzt mehr, kam immer nur kurz zu mir und war sofort wieder weg.
Dann träumte ich, ich sei wieder auf meinem Posten und arbeitete mit Quinn zusammen. Wir mussten die Stromversorgung in Korridor 4 überprüfen. Die Wartungsluke war geöffnet, ich lag auf dem Rücken und steckte halb im Zugang, um die richtige Steckverbindung zu suchen.
„Briggs, nimm das mal“, sagte Quinn. Ich hob den Kopf, woraufhin er mir einen Teller mit einem Stück Kuchen in die Hand drückte.
Natürlich, dachte ich. Es war schwierig, den Teller am Oberkörper vorbei in den freien Bereich hinter meinem Kopf zu bugsieren, ohne dass etwas von dem Kuchen vom Teller fiel.
Ich brauchte das Essen, um … um irgendetwas zu tun.
Anscheinend hatte Quinn bemerkt, dass ich momentan ratlos war. „Benutze es, um den Deckel dort aufzuhebeln.“ Er deutete neben meine Schulter.
„Ja.“ Ich nickte, betrachtete den Deckel und den Teller in meiner Hand, dann wieder den Deckel. „Brauche ich dazu nicht eine Gabel?“
Draußen knallte es so laut, dass mir die Ohren klingelten. Dann fiel Geschirr klirrend auf den Boden.
Mühsam kroch ich aus der Zugangsluke und rutschte auf dem Rücken weiter, bis ich den Kopf heben und mich aufrichten konnte.
Etwa zehn Meter entfernt versuchten zwei andere Besatzungsmitglieder, einen großen Longhornbullen zu bändigen. Ein Stapel kleiner Porzellantassen und Untersetzer stand gefährlich schief. Der Bulle stampfte zum Geschirr, die Besatzungsmitglieder schlugen ihm auf die Flanken und riefen „Kusch!“ und „Bleib!“.
„Ist heute Donnerstag?“, fragte Quinn.
„Oh, richtig“, antwortete ich. „Heute muss Donnerstag sein.“ Irgendwie klang das völlig vernünftig.
Da beugte Quinn sich vor und hob eine kaputte Teetasse auf. Sie war weiß und der hübsche Henkel war so zierlich, dass ein Mann kaum den kleinen Finger durchstecken konnte. Seitlich war eine hellrote Rose aufgemalt. Er drehte die Tasse in den Händen herum. Dabei fiel mir auf, dass ihn der Bulle aufmerksam beobachtete. Als die Rose dem Bullen zugewandt war, riss das Tier die Augen weit auf.
„Nein!“, warnte ich Quinn. „Lass sie fallen!“
Es war zu spät. Der Bulle griff an, stieß die Besatzungsmitglieder zur Seite und zertrümmerte das aufgestapelte Porzellan. Es krachte fürchterlich. Ich hörte den Lärm kaum, sondern spürte ihn eher als Erschütterung im Kopf.
Mit drei großen Galoppsprüngen überwand der Bulle die Distanz. Er drehte den Kopf hin und her und griff Quinn an. Das Tier stieß zu, durchbohrte Quinns Rippen und hob ihn von den Beinen.
„Nein!“, rief ich noch einmal und riss den Mund weit auf.
Der Bulle stürmte mit Quinn den Korridor hinunter, krachte gegen die Wand und brach einfach durch. Durch das Loch strömte die Luft ins Vakuum und ich stolperte. Die Crewmitglieder, die den Stier gebändigt hatten, flogen an mir vorbei und folgten Quinn und dem Tier hinaus in den freien Raum. Sie waren steif wie Schaufensterpuppen.
Über das Tier hinweg, das im Weltraum weiterlief, obwohl es nichts mehr unter den Hufen hatte, sah Quinn mich an. Er lächelte und winkte. Ich winkte zurück. Dann wurde seine Hand starr und er winkte wieder, jetzt allerdings so steif wie die englische Queen. Lachend erwiderte ich die Geste.
Dann sah ich mich im Korridor um. Das Geschirr war weg, die Zugangsluke verschlossen. Das Loch im Schiff war noch da, doch jetzt sah ich nur noch den rasenden Stier.
Ich wachte auf.
Tag vier. Ich musste mich zusammenreißen. Die Langeweile war schlimmer, als ich es mir je hätte vorstellen können. Wenn ich wach war, dachte ich über Möglichkeiten nach, mir die Zeit zu vertreiben. Egal wie, solange ich nicht an meine Situation und den Verlust dachte.
Als ich keine Lust mehr hatte, mit der im Anzugcomputer gespeicherten Musik Erkenne die Melodie zu spielen, verband ich die Sterne mit gedachten Linien. Zuerst suchte ich nach Umrissen, die einen Menschen oder ein Tier darstellen konnten, später fand ich alle Buchstaben des Alphabets und noch später ganze Wörter.
Als mir auch dies zu langweilig wurde, öffnete ich den Werkzeugbeutel am Bein und suchte etwas, mit dem ich mich ablenken konnte. Ich entschied mich für den Schweißlaser und schnitt einem Bolzen in der Tür den Kopf ab. Dann bearbeitete ich die Ecken, bis das Ding annähernd einem sechsseitigen Würfel glich. Ich brannte Punkte auf die Seiten des Würfels: die Zahlen von eins bis sechs. Anschließend schnitt ich einen zweiten Bolzen ab und wiederholte den Vorgang. Ich warf die beiden unebenen Metallwürfel hin und her und sah zu, wie sie schwebten und sich zwischen meinen Händen drehten. Schließlich magnetisierte ich die Platte auf dem linken Oberschenkel, wo ich normalerweise loses Werkzeug oder Bauteile ablegte, und warf die Würfel. Sie trafen das Bein und blieben an der magnetischen Fläche haften. Wie wär’s mit einem Spielchen?
Kapitel 2
Tag fünf. Knisternd erwachte mein Com-System zum Leben. „Antworten Sie“, sagte jemand.
„Hier bin ich“, antwortete ich mit steif gewordenen Lippen.
Dann fuhr ich auf und entdeckte keine fünf Meter vor mir ein recht großes, zigarrenförmiges Schiff. Was für ein prächtiger Anblick. Es war so nahe, dass ich die Größe nicht genau bestimmen konnte, aber sicherlich zweihundert Meter lang und fünfzig Meter breit.
„Antworten Sie“, verlangte die Stimme noch einmal.
Mein Mund war ausgetrocknet und geschwollen, die Schleimhaut klebte an den Zähnen. Ich arbeitete heftig mit der Zunge, um den Speichel zu verteilen. Es brannte etwas, als ich den Mund öffnete und krächzte: „Hallo, ich bin hier.“
Gott sei Dank.
Ich schnallte mich von der Metallplatte los, stieß mich ab und landete an der Backbordluke. Hinter dem Fenster der Außentür entdeckte ich eine kleine Schleuse. Durch das zweite Fenster auf der anderen Seite konnte ich das Innere des Schiffs erkennen. Es war keine von Menschen gebaute Schleuse.
Wieder ließ sich die Stimme vernehmen. „Kommen Sie zur Schleuse“, sagte sie sehr steif und förmlich.
„Habe ich gerade gemacht“, antwortete ich. „Ich bin schon da.“
Da erschienen der große, runde Kopf und der Oberkörper meines Retters. Ich erkannte die Spezies sofort. Wir nannten sie die Manti, weil sie den Gottesanbeterinnen der Erde recht ähnlich waren. Sie hatten zwei Arme, vier dünne Insektenbeine, Exoskelette und einen Körper, der in Kopf, Brustkorb und Bauch unterteilt war. Die Köpfe wirkten fast menschenähnlich, die beiden großen Augen waren in jeweils fünf Facetten unterteilt. Sie hatten sehr lange Arme, aber keine Hände, sondern etwa ein Dutzend spitze, gepanzerte Finger an den Seiten der Unterarme.
Das Wesen bewegte die Mandibeln und hielt inne. Dann hörte ich es im Com-System: „Wo ist Ihr Schiff?“
Ah, das erklärte die förmliche Stimme. Es war ein Übersetzungsprogramm.
„Das weiß ich nicht“, antwortete ich. „Ich schwebe seit fünf Tagen im Weltraum.“
„Wo ist Ihr Schiff?“, fragte der Manti noch einmal.
„Das weiß ich nicht, ich habe es schon am ersten Tag aus den Augen verloren.“
„Korrektur. Wie ist der Status Ihres Schiffs?“
„Oh“, antwortete ich. „Vollständig zerstört. Keine anderen Überlebenden.“
„Kann es repariert werden?“
„Nein. Nein, ich glaube nicht“, antwortete ich.
„Verstanden“, sagte die Stimme. „Wie können wir helfen?“
„Äh“, stammelte ich. „Sie könnten mich an Bord nehmen.“
Es gab eine Pause. „Unmöglich. Es tut mir leid“, sagte die Stimme. „Wie können wir helfen?“
„Was meinen Sie damit, dass es unmöglich ist?“, fragte ich. Verdammt, warum denn nicht?
Wieder gab es eine lange Pause, bis die Stimme schließlich sagte: „Unsere Atmosphäre ist nicht mit Ihrer Biologie kompatibel und für Ihren Anzug ätzend. Er würde zerstört.“
Da fiel es mir wieder ein. Die Manti stammten von einem kalten Planeten, der weit von der Wärme ihres Zentralgestirns entfernt war. Ihr Organismus beruhte nicht auf Wasser wie jener der Menschen, sondern auf Methan. In der Kälte und bei dem hohen Druck, der auf ihrem Planeten herrschte, war Methan eher eine Flüssigkeit als das Gas, das wir auf der Erde kannten. Meine Hoffnung sank.
„Wie kalt ist es da drin?“, fragte ich, obwohl mir klar war, dass ich damit auf keinen Fall zurechtkäme.
„Zweifünfzwei Celsius negativ“, antwortete der Manti. „Wie können wir Ihnen helfen?“
Ich betrachtete die Anzeige auf meinem Arm. Der Wasservorrat lag bei dreiunddreißig Prozent. „Sie haben nicht zufällig flüssiges Wasser dabei?“
„Bitte warten Sie.“ Wieder eine lange Pause. Ich konnte beobachten, wie er mit jemandem sprach, der sich außerhalb meines Blickfelds befand. Eine Minute später meldete er sich wieder. „Wir haben die Fähigkeit, Wasser für Sie aufzubereiten.“
„Wunderbar“, sagte ich. Das war schon mal was. Wenn sie meinen Anzug auffüllen konnten, dann hielt ich es vielleicht lange genug aus, um zu verhungern. „Wie sieht es mit Proviant aus?“, fragte ich.
Der Manti betrachtete einen tragbaren Computer und bearbeitete den Bildschirm mit mehreren der an Pinzetten erinnernden Finger. Schließlich sah er mich wieder an. „Ja.“
Ah, jetzt kommen wir weiter. Ich kicherte erfreut.
Der Manti bat mich, ihm das Wasserventil am Anzug zu zeigen. Ich hob den linken Arm und drehte mich, damit er den Anschluss erkennen konnte. Ich musste stillhalten, bis er mich gescannt hatte, dann informierte er mich, dass sie leicht eine Verbindung herstellen konnten. Anschließend verschwand er.
„Hallo?“, sagte ich.
Nichts.
Nach zwanzig Minuten Untätigkeit spürte ich auf einmal eine Erschütterung und zog mich wieder vor das Fenster der Schleuse. Die innere Tür wurde gerade geschlossen.
Wieder meldete sich die Stimme. „Sie können die Außentür öffnen.“
Ich packte den Griff, der sich leicht drehen ließ. Es klickte, das Schott schwang auf. Drinnen stand ein Kanister, der zehn bis zwölf Liter enthielt, daneben lagen mehrere mit silbrigem Material umwickelte Riegel. Ich nahm einen und drückte mit dem Finger darauf. Er gab nach, der Finger hinterließ eine kleine Delle. Notrationen. „Danke“, sagte ich.
Als ich den Kanister mit dem Ventil meines Anzugs verband, rastete der Verschluss sauber ein. Dreißig Sekunden später war mein Anzug voll aufgetankt.
Dann nahm ich eine Ration und trat ganz in die kleine Kammer, drehte mich um und versuchte, die Tür zu schließen. Es war ein sinnloses Unterfangen. Der Raum war zu klein, ich bekam die Außenluke nicht zu.
Also drehte ich mich wieder zum inneren Fenster um. „Wie soll ich hier etwas essen? Haben Sie eine größere Schleuse, in der ich den Helm öffnen kann?“
„Wir haben drei Schleusen“, erklärte die Stimme. „Alle sind gleich groß.“
Das ist nicht gut. „Und jetzt?“ Ich hielt den Riegel vor das Fenster und drehte ihn zwischen Fingern und Daumen hin und her.
„Bitte warten Sie.“ Wieder sprach er mit jemandem, den ich nicht sehen konnte.
„Unser Arzt hat bestätigt, dass Sie den Proviant ohne Gefahr zu sich nehmen können.“
„Was?“, fragte ich. „Ich dachte, das haben Sie längst überprüft. Die Frage ist jetzt vielmehr, wie ich das hier draußen im Vakuum essen soll.“ Ich tippte auf mein Visier, um zu verdeutlichen, was ich meinte.
„Verzeihung“, entgegnete er. „Unser Arzt hat festgestellt, dass Ihre Spezies das Vakuum lange genug aushalten kann, um das Essen in den Mund zu schieben.“
„Ehrlich?“, fragte ich. „Meinen Sie, ich soll den Helm abnehmen, einen Happen abbeißen und den Helm wieder aufsetzen, ehe ich sterbe?“ Der macht wohl Witze.
„Ja“, antwortete er völlig gelassen. Nach einer Pause fuhr er fort: „Es wird sehr kalt, und Sie dürfen nicht den Atem anhalten, weil sonst die Lungen platzen und dann sterben Sie. Ihre Spezies kann es ungefähr fünfzehn Sekunden ertragen, ehe Sie ohnmächtig wird. Wenn Sie ohnmächtig werden, sterben Sie innerhalb von neunzig Sekunden.“
„Die Gefahren sind mir bekannt“, erklärte ich. „Ich bin bisher nur noch nicht auf die Idee gekommen, mein Leben zu riskieren, um einen Happen zu essen.“
„Sind Sie nicht fähig, dies zu tun?“
Ich zuckte mit den Achseln. „Ich würde Ihnen gern sagen, dass ich nicht hungrig genug bin, um es zu versuchen. Aber ehrlich gesagt, kann ich das nicht. Ich bin am Verhungern.“
Dreißig Sekunden lang dachte ich darüber nach. So verrückt es auch klang, es war möglich und ich konnte dadurch vorläufig überleben. Das verbesserte meine Aussichten, doch noch gerettet zu werden, ganz erheblich. Also packte ich den Riegel aus, riss einen Happen ab, der gerade noch in den Mund passte, und stählte mich. Ich tippte auf das Armdisplay, rief das Sicherheitsmenü auf und deaktivierte die Sicherungen des Helms. Dann holte ich tief Luft und atmete langsam durch die Nase aus. Vollständig. Eine Sekunde, zwei Sekunden … nach drei Sekunden fühlten sich meine Lungen leer an und ich musste die restliche Luft mit Gewalt herauspressen. Ich schloss die Augen und öffnete das Visier.
Mit einem Zischen entwich die Luft aus dem Anzug, dann wurde es still. Es knackte zweimal laut, als meine Ohren den Druck ausgleichen wollten. Sofort wurde es schneidend kalt, als hätte ich das Gesicht in eine Schale Eiswasser getaucht. Die scheinbar leeren Lungen fühlten sich gar nicht mehr so leer an, weil sich die Luftreste, die ich nicht ausgeatmet hatte, im Vakuum rasch ausdehnten. Ich atmete weiter aus. Rasch hob ich die Hand zum Mund und versuchte, das Stück des Proviantriegels hineinzustecken. Quasi blind und mit den dicken Handschuhen war das schwieriger als erwartet.
Sobald ich den Riegel auf den Lippen spürte, beförderte ich ihn in den Mund, zog die Hand weg und klappte das Visier wieder zu. Dann übernahm der Anzug und baute den Druck und die Atmosphäre rasch wieder auf. Ich überwand mich und zählte gequält bis zehn, ehe ich den ersten so dringend benötigten Atemzug wagte. Meine Lungen brannten. Sobald ich die Augen öffnete, sprangen die kleinen Eiskristalle, die sich um die Wimpern gebildet hatten, knisternd ab. Ich blinzelte mehrmals, um mich zu vergewissern, dass alles in Ordnung war.
Erst da erinnerte ich mich, dass ich tatsächlich Essen im Mund hatte. Ich kaute und erkundete es mit der Zunge. Noch nie hatte mir etwas so Fades und Saures so gut geschmeckt. Während ich kaute, stellten die Ohren den Druckausgleich her.
Ich sah den Manti an. „Mmm“, machte ich und zeigte ihm einen erhobenen Daumen. Er antwortete nicht, als hätte er die Geste nicht verstanden.
„Bitte warten Sie“, sagte er und verschwand nach links.
Unterdessen musterte ich den Wasserkanister etwas genauer.
Während der letzten fünf Tage hatte ich immer wieder die Leistungsfähigkeit meines Anzugs berechnet. Mit einer vollen Ladung hielt ich etwa acht Tage durch. Wenn ich vom siebten Tag an nichts mehr trank, schaffte ich noch einen weiteren Tag. Das war möglicherweise lange genug, um gerettet zu werden – vorausgesetzt, die Manti begegneten rechtzeitig jemandem, der mich aufnehmen konnte.
Ich musterte die Rationsriegel. Die Dichte und Beschaffenheit ähnelten den Notrationen, die ich kannte, aber der Geschmack war noch unbefriedigender, soweit man das überhaupt sagen konnte. Das Etikett konnte ich nicht lesen, doch die Rationen, die ich kannte, lieferten pro Riegel genügend Kalorien, um einen Menschen mehrere Tage lang zu versorgen. Der große Happen, den ich geschluckt hatte, sollte für annähernd einen Tag reichen. Ich zählte die Riegel. Es waren sechs – nein, sechs und einer, der noch zu zwei Dritteln intakt war. Bei drei oder vier Tagen pro Riegel konnte ich zwanzig bis siebenundzwanzig Tage durchhalten. Also würde ich tatsächlich eher ersticken als verhungern, sofern ich nicht schon vorher an den Riegeln starb. Man musste ja immer das Positive sehen.
Der Manti erschien wieder im Fenster der Luke.
„Könnten Sie den Kanister noch einmal auffüllen?“, fragte ich. „Oder könnte ich sogar mehrere Kanister mitnehmen? Je größer, desto besser.“
„Nein“, antwortete er.
Wie bitte?
„Je mehr ich bekomme, desto länger überlebe ich.“
„Unser Ingenieur hat berechnet, dass wir Sie zu Ihren Leuten transportieren können“, erklärte er.
Oh, wie schön. „Das ist wundervoll.“ Ich strahlte. „Wie ist Ihr Plan? Wollen Sie einen Frachtraum versiegeln oder so?“
„Ich bin angewiesen, Ihnen zu sagen, dass Sie das Geschirr an der Außenhülle des Schiffs befestigen sollen“, antwortete er. „Das Antiträgheitsfeld reicht weit genug über die Außenhülle hinaus, um auch Ihre Sicherheit zu gewährleisten.“
Der machte schon wieder Witze. Aber diese Käfer hatten keinerlei Humor.
„Also wollen Sie mich auf die Schiffshülle kleben wie ein totes Tier?“
Es dauerte eine Weile, bis ich überzeugt war, aber schließlich zog ich an der Sicherungsleine und holte die große Metalltür heran, die mir fast eine Woche lang als Rettungsfloß gedient hatte. Ich band Quinn los und stieß die Metalltür weg vom Schiff in den freien Raum. Dann suchte ich mir eine Stelle, wo mehrere große externe Leitungen zusammenliefen und eine Nische bildeten, die an drei Seiten geschützt war. In diesen Alkoven schob ich Quinns Leiche und zurrte ihn mit der Sicherheitsleine fest.
Anscheinend war das Schiff weitgehend symmetrisch konstruiert, daher zog ich mich an der Außenhülle entlang zur anderen Seite, wo ich eine zweite Nische fand. Ich band mich fest und informierte den Manti, dass ich bereit war.
Die Sterne wanderten zum Heck des Schiffs. Je näher und heller sie waren, desto schneller flogen wir. Die fernen und trüben Sterne bewegten sich überhaupt nicht. Wir waren unterwegs.
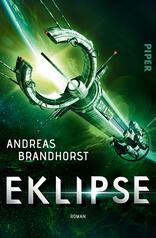
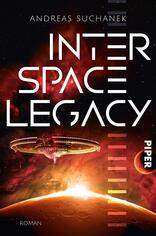



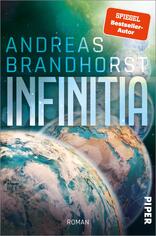




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.