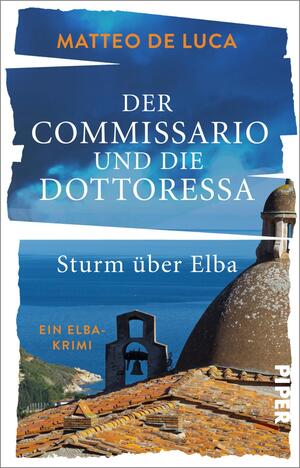
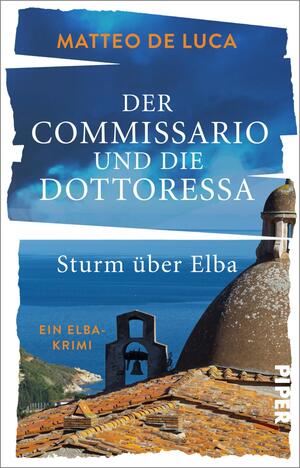
Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba (Ein Fall für Berensen & Luccarelli 1) Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba (Ein Fall für Berensen & Luccarelli 1) - eBook-Ausgabe
Ein Elba-Krimi
— Krimi mit italienischem Inselflair„Ein ganz starkes Debüt, das viel Lust auf mehr Fälle macht.“ - Westfalen-Blatt
Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba (Ein Fall für Berensen & Luccarelli 1) — Inhalt
Malerische Traumstrände, tödliche Klippen und ein Ermittlerteam, das eigentlich gar keines ist
Elba – drittgrößte Insel Italiens, beliebtes und idyllisches Urlaubsparadies sowie neue Heimat von Hagen Berensen. Der Deutsche hat seinen Job bei der Kripo gekündigt und sich in einer Villa mit Traumblick an Elbas Küste niedergelassen.
Seine neue Haushaltshilfe Fiorina Luccarelli ist für seinen Geschmack zwar etwas zu temperamentvoll, aber immerhin spricht sie dank ihres Psychologiestudiums in Frankfurt fließend Deutsch. Nach dem rätselhaften Tod eines Bekannten gerät ihr Bruder in Gefahr – da kommt es ihr gerade recht, dass ihr neuer Arbeitgeber früher Commissario war.
Auch der Mafioso Rossi, der Hagen die leider marode Villa angedreht hat, scheint seine Finger im Spiel zu haben. Kurzerhand fälscht Hagen einen Europol-Ausweis, gibt Fiorina als seine Dolmetscherin aus, und sie beginnen zu ermitteln …
„Ein flotter, spannender Krimi mit viel Selbstironie.“ BR Buchtipp
Matteo De Luca ist das Pseudonym der Bestsellerautoren Wolfgang Burger und Hilde Artmeier. Mit ihren Krimireihen rund um den Heidelberger Kripochef Alexander Gerlach und die Regensburger Privatdetektivin Anna di Santosa waren sie bereits einzeln sehr erfolgreich, jetzt hat das Autoren-Ehepaar sich zusammengetan und lässt gemeinsam ein sympathisches neues deutsch-italienisches Duo ermitteln.
Leseprobe zu „Der Commissario und die Dottoressa – Sturm über Elba (Ein Fall für Berensen & Luccarelli 1)“
1
Mamma mia, schon wieder war das Kloschild weg …
Fiorina Luccarelli hatte zunächst gar nicht bemerkt, dass an der Fassade neben der Haustür wieder der hässliche Fleck prangte, der normalerweise unter dem Schild in den traditionellen Flaggenfarben Elbas verborgen war. Vermutlich, weil der Wind ihr die Handtasche in genau jenem Moment von der Schulter gerissen hatte, als sie den Haustürschlüssel herausziehen wollte.
Doch nun, da sie die Tasche in festem Griff hielt und mit dem Schlüsselbund in der Hand vor dem Eingang stand, sah sie den Fleck umso [...]
1
Mamma mia, schon wieder war das Kloschild weg …
Fiorina Luccarelli hatte zunächst gar nicht bemerkt, dass an der Fassade neben der Haustür wieder der hässliche Fleck prangte, der normalerweise unter dem Schild in den traditionellen Flaggenfarben Elbas verborgen war. Vermutlich, weil der Wind ihr die Handtasche in genau jenem Moment von der Schulter gerissen hatte, als sie den Haustürschlüssel herausziehen wollte.
Doch nun, da sie die Tasche in festem Griff hielt und mit dem Schlüsselbund in der Hand vor dem Eingang stand, sah sie den Fleck umso deutlicher. Hatte der Sturm das Schild davongeweht?
Sie strich sich die feuchten Ponyfransen aus dem Gesicht, ein sinnloses Unterfangen angesichts des anhaltenden Sturzregens und der peitschenden Böen, und warf einen Blick zurück auf den Asphaltbelag der Gasse, durch die sie soeben gerannt war. Der Sturm heulte wie in einem Gruselkabinett, die Straßenlaterne, die wild hin und her schaukelte, verbreitete ein wenig Licht. Doch weit und breit keine Spur von dem fehlenden Schild.
Außer Fiorina war zu so früher Stunde noch niemand auf der Straße. Es war erst halb sechs Uhr morgens, die meisten Bewohner von Elbas Hauptstadt Portoferraio schliefen noch. Nur im Haus gegenüber brannte schon Licht, der alte Nunzio war wie immer zeitig auf den Beinen.
Rasch betrat Fiorina das vierstöckige Gebäude, in dem sie mit ihrer Familie wohnte, und schloss hinter sich die Tür ab, die wie üblich nicht zugesperrt gewesen war. Seufzend schüttelte sie das Wasser von ihrer taubengrauen Steppjacke, durchquerte den eiskalten dunklen Korridor und stieg die knarzenden Holzstufen in den ersten Stock hinauf. Dabei überlegte sie, wie sie ihrer Mutter Teil zwei ihrer heutigen Neuigkeiten beibringen sollte, der wesentlich schwerer wog als das wieder einmal geklaute Schild mit der in Deutsch und Englisch verfassten Aufschrift: „Im Jahr 1814 benutzte Napoleon Bonaparte mehrfach die Toilette dieses Hauses. Besichtigung jederzeit möglich gegen eine Gebühr von € 2.“ Darunter die Handynummer ihres Bruders Federico.
Als Fiorina die Fünfzimmerwohnung ihrer Mutter betrat, seufzte sie ein zweites Mal – auch diese Tür war wie so oft nicht abgeschlossen. Sie schlüpfte aus der Jacke, die immer noch vor Nässe triefte, und hängte sie an einen Haken der winzigen Garderobe.
Aus der geräumigen Küche duftete es schon nach Kaffee. Rosetta Luccarelli, eine kleine, rundliche Frau Anfang sechzig, goss sich gerade ein erstes Tässchen ein. Beim Anblick ihrer Tochter holte sie wortlos eine weitere Espressotasse aus dem wurmstichigen Büfett und füllte sie fast bis zum Rand.
„Tutto a posto?“ Sie stellte die verbeulte Macchinetta zurück auf den Herd und drehte das Gas herunter, um sie warm zu halten. Ihre trotz ihres Alters immer noch beneidenswert glatte Stirn legte sich in Falten. „Alles in Ordnung? Du siehst kaputt aus, Carissima.“
„Mamma, so geht das einfach nicht.“
Während ihre Mutter sich gegen den altersschwachen Herd lehnte und sie mit hochgezogenen Brauen musterte, ließ Fiorina sich auf einen der sechs Holzstühle fallen, die um den langen Holztisch gruppiert waren. Gierig trank sie von dem starken schwarzen Caffè, den sie nach einer Nachtschicht immer besonders nötig hatte.
„Wenn du nie das Haus und die Wohnung absperrst“, sie gähnte hinter vorgehaltener Hand, „klauen sie uns eines Tages mehr als nur das dumme Kloschild.“
„Wir sind hier nicht in Livorno, Carissima, sondern auf Elba“, erwiderte ihre Mutter entrüstet. „Außerdem schließt ja immer du ab, also was jammerst du?“
In der Küche zog es fürchterlich, trotz der geschlossenen Fensterläden. Durch jede Ritze zwischen dem krummen Mauerwerk und den schlecht isolierten Fenstern des dreihundert Jahre alten Hauses pfiff und fauchte der Wind, während der Regen so heftig gegen die flaschengrün gestrichenen Holzläden trommelte, dass man fürchten musste, die Glasscheiben dahinter könnten jeden Moment zerspringen.
„Das Schild ist schon wieder verschwunden, sagst du?“ Fiorinas Mutter rührte drei gehäufte Löffel Zucker in ihren Espresso – im Gegensatz zu ihrer Tochter fand sie ihn ungesüßt ungenießbar – und leerte das Tässchen in einem Zug. „Madonna santa! Und das im März, wo es noch kaum Touristen gibt.“
Je nachdem, in welcher Branche man arbeitete, liebte oder hasste man auf der Insel die Urlauber, die im Sommer die Städtchen, Straßen und Strände Elbas überfluteten und beim überwiegenden Teil der Einheimischen für ein regelmäßiges Einkommen sorgten. Nach dem ruhigen Trott in der kalten Jahreszeit sehnten die meisten Inselbewohner die Zeit herbei, wenn wieder die ersten Touristen anreisten und die Kassen füllten. Rosetta Luccarelli arbeitete in einem Supermarkt, der so versteckt am Rand von Portoferraio lag, dass sich selbst in der Hochsaison kaum ein Fremder dorthin verirrte. Deshalb betrachtete sie die Menschen, die nicht von Elba stammten, als Ursprung allen Übels, das die drittgrößte Insel Italiens in ihrer wechselvollen Geschichte heimgesucht hatte. Wenn sie aber durch die Via del Carmine stolperten, die Gasse, in der ihr Haus stand, und Napoleons Toilette gegen einen kleinen Obolus besichtigen wollten, waren die Touristen auch ihr willkommene Gäste. Manch einer hatte es allerdings schon übertrieben und das Kloschild als Andenken mitgehen lassen.
„Vielleicht weiß Nunzio was.“ Fiorina nippte an ihrem brühheißen Caffè. „Bei ihm brennt schon Licht. Ich frag ihn später mal, ob er was gesehen hat.“
„Der arme Federico.“ Mit theatralischem Stirnrunzeln goss Rosetta Luccarelli sich Kaffee nach und bekreuzigte sich. „Zum dritten Mal in diesem Jahr muss er ein neues machen … Oddio, wenn das bloß kein Unglück bringt.“
Das Schild hatte Fiorinas Bruder in Anlehnung an Elbas Flagge mit drei gelben Bienen verziert, die über einen roten Streifen auf weißem Grund flogen. Angeblich hatte Napoleon Bonaparte höchstpersönlich sie auf seiner Überfahrt nach Elba entworfen, wo er sein erstes Exil verbrachte. Der verbannte Kaiser hatte damals keine zweihundert Meter vom Haus der Luccarellis entfernt gelebt. In der Villa dei Mulini, an einem der höchsten Punkte der Altstadt und zwischen den beiden Festungen Forte Stella und Forte Falcone.
Die Idee mit dem Napoleon-Klo stammte von Federico, der auf diese Weise – zumindest während der Touristensaison – auch etwas zum Familieneinkommen beitrug, was leider selten genug vorkam. Er hatte die angebliche Toilette in einem alten Verschlag im Hof eingerichtet. Das Brett mit dem Loch stammte von einem abgebrannten Bauerngehöft bei San Martino, und das Arrangement sah ziemlich echt aus. Natürlich war an den zwei Euro Eintrittsgeld nicht viel zu verdienen. Der Trick waren die verstaubten Radierungen an den Wänden des Plumpsklos, die den Kaiser zeigten und angeblich seit Ewigkeiten im Besitz der Familie waren. In Wahrheit fertigte Federico sie selbst an und druckte sie auf würdig vergilbtem Büttenpapier, das er dem Besitzer einer pleitegegangenen Druckerei in Marina di Campo abgeschwatzt hatte. Die alten Rahmen kaufte er bei eBay oder auf Flohmärkten, und wenn an einem guten Tag drei Touristen Napoleons Toilette besichtigten, dann war mindestens einer darunter, der nicht widerstehen konnte und dem scheinbar naiven Besitzer eine der vermeintlich über zweihundert Jahre alten Radierungen abschwatzte. In der Regel verlangte Federico dreihundert Euro dafür, unter hundertfünfzig verkaufte er nicht.
„Der hat ja sonst nichts zu tun“, bemerkte Fiorina, weil ihr der weinerliche Ton ihrer Mutter auf die Nerven ging. Federico war nicht nur acht Jahre jünger als sie selbst und das Nesthäkchen der Familie, sondern ein Mammone, ein Muttersöhnchen par excellence. „Jedenfalls nichts, womit er wirklich Geld verdient.“
Dieser Gedanke erinnerte Fiorina an Teil zwei ihrer morgendlichen Schreckensmeldungen.
Ihre Nachtschicht als Mitarbeiterin der Sozialstation war anfangs ganz normal verlaufen – am Krisentelefon eine einsame Betrunkene, drei Youngsters mit Liebeskummer, die Inhaberin eines Agriturismo, deren Ehemann im Hintergrund noch lauter getobt hatte als der Sturm. Aber dann, kurz nach Mitternacht, hatte Fiorina die Unglücksmail in ihrem Posteingang entdeckt.
„In der Zentrale in Livorno haben sie wieder mal über Rationalisierungsmaßnahmen nachgedacht.“ Sie räusperte sich unbehaglich und zupfte an der Plastiktischdecke herum, die mit Tomaten, Gurken und Karotten in leuchtenden Farben bedruckt war. „Maßnahmen, die sich leider auch auf meine Stelle auswirken.“
Ihre Mutter kramte in einem der Hängeschränke aus kanariengelbem Resopal, holte die Schale mit den Biscotti hervor und stellte das zierliche Porzellangefäß, das noch aus der Aussteuer ihrer Urgroßmutter stammte, auf den Tisch. Dann hob sie die Hände gen Zimmerdecke und die akkurat nachgezogenen kohlschwarzen Brauen. Ihr pausbäckiges Gesicht verzog sich zu der Märtyrermiene, die sie bei den Schicksalsschlägen ihres Lebens zu zeigen pflegte.
„Madonna santa“, klagte sie erneut. „Bitte nicht schon wieder!“
„Leider doch. Die Dienststelle in Portoferraio wird aufgelöst. Ottavia, meine Kollegin von der Tagschicht, hat noch zwei Wochen, um alles zu regeln. Aber die Nachtschicht ist ab sofort gestrichen.“
So, jetzt war es heraus. Fiorina kippte den Kaffee hinunter und stellte die Tasse so unsanft auf den Tisch, dass sie fast lauter schepperte als die Fensterläden, an denen der Wind rüttelte.
„Mi dispiace tantissimo, mamma“, fügte sie grimmig hinzu. „Aber ich bin wieder mal arbeitslos.“
2
Die Wolken rasten dahin wie eine Büffelherde auf panischer Flucht. Tintenschwarz, drohend und so tief hingen sie über der aufgepeitschten See, als wollten sie jeden Augenblick darin versinken. Die Gischt spritzte meterhoch und flog sogar hin und wieder über das Dach des kleinen Toyota, der über die Küstenstraße nach Portoferraio jagte.
Der Mann hinter dem Steuer zog den Kopf ein, als eine besonders hohe Woge einen Schwall Wasser gegen das Blech warf und eine Sturmbö seinen Wagen um ein Haar von der Straße gefegt hätte. Er umklammerte das Lenkrad so fest, dass seine Fingerknöchel im bläulichen Schein der Armaturenbeleuchtung weiß hervortraten. Noch zwei Kilometer. Wegen dieses Katastrophenwetters war er spät dran, viel zu spät. Hoffentlich schaffte er es noch rechtzeitig bis zur Abfahrt der ersten Fähre.
Vor wenigen Minuten hatte es endlich zu regnen aufgehört. Dennoch war die Straße stellenweise noch so überschwemmt, dass er ein ums andere Mal fürchten musste, die Reifen würden die Bodenhaftung verlieren. Jeden Moment konnte er die Kontrolle verlieren, den Steilhang hinabschlittern, auf einem Felsen aufschlagen. Ohne sich umzuwenden, tastete er nach dem Aktenkoffer auf dem Rücksitz, als könnte dieser sich während der Fahrt in Luft aufgelöst haben. Doch der unscheinbare schwarze Koffer lag immer noch dort, wo er ihn hingelegt hatte.
Der Fahrer entspannte sich ein wenig, versuchte, nicht mehr an das schreckliche Wetter zu denken, sondern an seine Zukunft, an all die Möglichkeiten, die das Leben ihm auf einmal bot. Bis zum nächsten Brecher, der die schmale, kurvige, an vielen Stellen schlecht befestigte Straße kurzzeitig in einen wild schäumenden Gebirgsbach verwandelte.
Wieder blitzten die Scheinwerfer im Rückspiegel auf. Der andere war immer noch hinter ihm, hatte es offenbar genauso eilig wie er, wollte vielleicht auch die Sechs-Uhr-Fähre erreichen. Oder verfolgte er ihn etwa? War es möglich, dass seine Flucht schon entdeckt worden war?
Der Mann im Toyota fluchte lauthals, stieg so heftig auf die Bremse, dass der Wagen kurz schlingerte. Vor ihm stand die Straße zentimetertief unter Wasser, es rauschte und spritzte, dann hatte er die Stelle hinter sich und konnte wieder Gas geben. Er schoss am schwärzlichen Dickicht der Macchia vorbei, die die nur schwach besiedelten Hänge an der Nordküste Elbas großenteils bedeckte.
Eigentlich hatte er gedacht, er hätte den Wagen hinter sich längst abgeschüttelt. Schon, als er am Campingplatz bei Acquaviva vorbeiraste, hatte er das zuckende und tanzende Licht hinter sich bemerkt. Ein großer Wagen schien es zu sein, ein teurer Wagen. Mühsam kämpfte er die Angst nieder, die ihm die Luft abschnürte, warf erneut einen Blick in den Rückspiegel. Das Scheinwerferlicht war verschwunden. Er atmete auf.
Endlich erreichte er Portoferraios Stadtgrenze. Hier herrschte plötzlich reger Verkehr, besonders auf der Gegenfahrbahn. Gab es seit Neuestem auch eine Fähre, die vor sechs Uhr morgens anlegte?
Mit viel zu hoher Geschwindigkeit passierte er das Industriegebiet, bog schlingernd in die Zufahrt zum Hafen, sah die Fähre am Pier liegen, Gott sei Dank. Er bremste hart, aber … Aber was war das?
Normalerweise sollte hier jetzt eine lange Schlange von wartenden Fahrzeugen stehen, Berufspendler, die aufs Festland übersetzen wollten. Doch da war niemand, die Schranke an der Zufahrt war geschlossen, die Ampeln alle rot und …
Und die Fähre war dunkel!
Wie ein Schlag in die Magengrube traf ihn die Erkenntnis: Der Fährbetrieb war wegen des Unwetters bis auf Weiteres eingestellt. Die Autos, die ihm vorhin entgegengekommen waren, gehörten Menschen, die wie er selbst am Morgen weder Nachrichten gehört noch ins Internet geschaut hatten.
Langsam, ratlos und in schon wieder hochkochender Panik fuhr er weiter, fand am Rand der Altstadt einen Parkplatz auf der dem Meer abgewandten Straßenseite. Was war er nur für ein Idiot! Es war ja nicht das erste Mal, dass die Fähren nicht ausliefen. Das geschah mehrmals pro Jahr. Er hätte es wissen können, verdammt! Er hätte es wissen müssen.
Was nun?, fragte er sich, als er wie gelähmt bei ausgeschaltetem Motor im Wagen saß.
Die Wellen in der sonst so ruhigen Hafenbucht schäumten und spritzten, als würden übermütige Seeungeheuer ihr Morgenbad darin nehmen. Der kleine Leuchtturm an der Molo del Gallo hingegen blinkte so friedlich und verlässlich, als wäre alles in bester Ordnung.
Erneut fluchte der Mann im Toyota, duckte sich. Ein Wagen kam langsam die Straße entlang, als hielte der Fahrer nach irgendetwas oder irgendjemandem Ausschau. Ein Mercedes, dessen Stern im Licht der heftig schaukelnden Straßenbeleuchtung aufblitzte.
Noch hatte der andere ihn nicht entdeckt. Zufällig hatte er an einer Stelle geparkt, wo die Straßenlaterne kaputt war. Rasch zerrte er den Aktenkoffer und seine Steppjacke vom Rücksitz, riss die Tür auf, die der Sturm ihm wütend entgegenschlug, lief davon, zog dabei die Jacke über. Die Reisetasche mit seinen wenigen Habseligkeiten würde er später holen. Falls es ein Später für ihn geben sollte.
Schwer atmend bog er in eine Seitenstraße ein, die ins Centro storico führte. An heruntergelassenen Rollgittern rannte er vorbei, an geschlossenen Geschäften, zugeklappten Fensterläden. Hinter sich hörte er die Tür eines Wagens zufallen, schnelle Schritte über den Asphalt klappern. Wer immer ihn verfolgte, er war ihm dicht auf den Fersen.
Durch steinerne alte Torbögen lief er, an heruntergefallenen und auf dem Pflaster zerschellten Blumentöpfen vorbei, an einer umgestürzten Vespa. Wahllos bog er abwechselnd links und rechts ab, geriet in immer schmalere Gassen. Der Aktenkoffer, den der Wind unablässig hin und her zerrte, behinderte ihn, aber er packte ihn nur noch fester.
Auf der Piazza Cavour glitt er auf dem nassen Kopfsteinpflaster aus, fing sich mit knapper Not an einem glitschigen Laternenmast ab, horchte in die Nacht. Doch sein eigener Atem, sein rasender Puls überdeckten jedes andere Geräusch.
Bei Salvatores Panetteria, wo er manchmal Panini oder Brot kaufte, wenn er in Portoferraio zu tun hatte, flackerte Licht hinter den Schaufenstern. Der Bäcker war offenbar schon bei der Arbeit, der Laden aber noch geschlossen.
Wieder hörte er von irgendwoher eilige Schritte, dieses Mal aus einer ganz anderen Richtung als vorhin. Gehetzt blickte er sich um, sah etwas aus dem Augenwinkel, das ihm erneut den Atem verschlug. Eine Gestalt trat aus dem Schatten eines Vordachs. Wie konnte sein Verfolger jetzt schon hier sein?
Aber nein, das war doch …?
Sie war ihm so verflucht vertraut, diese Gestalt, allerdings hatte er nicht damit gerechnet, sie hier zu sehen. Wenn es überhaupt die Person war, für die er sie hielt. Aufgrund der großen Kapuze konnte er das Gesicht nicht erkennen.
Ein Blitz durchzuckte ihn. Steckten die beiden, der Fahrer des Mercedes und der Mensch mit der Kapuze, etwa unter einer Decke? Dann war er verloren …
Er wandte sich so ruckartig ab, dass er auf dem nassen und glatten Untergrund erneut ausrutschte. Dieses Mal konnte er den Sturz nicht vermeiden, sondern schlug der Länge nach hin. Mit zusammengebissenen Zähnen rappelte er sich wieder hoch, packte den Aktenkoffer, der ihm aus der Hand gefallen war, stolperte in die nächste Gasse.
Weiter lief er, immer weiter, aufwärts jetzt, bog wieder um eine Ecke und noch eine, hastete eine breite Treppe hinauf, wandte sich an ihrem Ende scharf nach rechts, in die Via Victor Hugo. Wenn er wenigstens den schweren Aktenkoffer nicht schleppen müsste, der ihm bei dem Sturm immer wieder zwischen die Beine geriet. Der Wind zerrte an seinen Haaren, an seiner Jacke, deren Reißverschluss er in der Eile nicht zugezogen hatte. Erst jetzt bemerkte er, dass es wieder zu regnen begonnen hatte.
„Volare, dadada, cantare …“, schmetterte jemand in seiner Nähe mit so volltönender Stimme, dass er sogar das Heulen des Windes übertönte.
Der Mann mit dem Koffer hetzte weiter, seine Lungen schmerzten, der Atem ging keuchend, weiter die Gasse hinauf, an dunklen Häusern vorbei, an geparkten Autos. Da prallte er mit jemandem zusammen.
„Attenzione!“, rief der Mann, der bis eben gesungen hatte. „Wohin denn so eilig?“
Das Gesicht des Sängers schien in den herabstürzenden Wassermassen zu verschwimmen. Doch dann erkannte er ihn.
„Oddio!“ Aufatmend packte er ihn am Arm. „Wie gut, dass ich dich treffe.“
„Äh … Kennen wir uns?“
„Certo, wir sind alte Schulfreunde, weißt du nicht mehr? Hör zu, du musst mir helfen.“
3
„In Cecina suchen sie eine Psychologin“, sagte Fiorina Luccarelli beim zweiten Espresso zu ihrer Mutter. „Zwar nur halbtags, aber immerhin bei der Stadtverwaltung, im Settore sociale, da könnte ich …“
„Was willst du in Cecina?“, wischte Rosetta Luccarelli, die schwungvoll in einem Kochtopf rührte, den Vorschlag zur Seite. „Da bist du jeden Morgen und Abend anderthalb Stunden unterwegs. Allein schon die Überfahrt jedes Mal … Nein, Carissima, schlag dir das aus dem Kopf!“
„Die Stelle wäre perfekt für mich, Mamma. Ich würde gern wieder mit traumatisierten Frauen arbeiten, und nebenbei könnte ich endlich meine Ausbildung zur Psychotherapeutin abschließen.“
Ihre Mutter stemmte eine Hand in die Hüfte und wirbelte mit dem Kochlöffel in der anderen aufgebracht in der dampfgeschwängerten Luft herum. „Und wie sollen Federico und ich zurechtkommen, wenn du jeden Tag das Auto brauchst, eh?“
„Jetzt hör mal, es ist immer noch mein Auto, und …“
„Wir können uns ein zweites Auto nicht leisten. Basta. Du wirst auch auf der Insel wieder eine Stelle finden.“
Der Wind heulte auf, wehte so heftig, als fegte er mitten durch die Küche. Die einfach verglasten Scheiben klirrten und schepperten. Offenbar hatte jemand die Wohnungstür geöffnet, ohne dass sie es gehört hatten.
Schon rumste sie ins Schloss, Schritte schlurften durch den Korridor. Die Anfangsklänge von Zuccheros Ohrwurm Diamante drangen an Fiorionas Ohr.
„Federico!“, rief Rosetta Luccarelli mit einem plötzlichen Strahlen im Gesicht. „Vuoi un caffè? Einen Espresso?“
„Später, Mamma“, tönte es hohl zurück. „Bin hundemüde.“
Wie immer, wenn Fiorinas Bruder so frühmorgens nach Hause kam, klang seine Stimme halb belegt, halb beschwingt. Sie konnte sich schon denken, warum. Natürlich war er wieder bei Andrea gewesen.
„Weck mich zum Abendessen – d’accordo, mamma?“
„Certo, amore, certo. Schlaf gut!“
Die Tür von Federicos Zimmer klappte auf und wieder zu.
Fiorina konnte den feinen, leicht bitteren Geruch erschnuppern, der vom Korridor hereinwehte. Ihre Mutter hingegen schien nichts davon zu bemerken. Allerdings umgab sie ein Duftgemisch aus Oregano und Knoblauch, das den brodelnden Töpfen entstieg.
„Heute gibt’s eine feine Ribollita mit extra viel Fenchel“, rief sie ihrem Sohn nach, der vermutlich längst nichts mehr hörte. „Die magst du doch so gern, Amore.“
Wie immer ärgerte sich Fiorina über Mammas Getue, sobald es um ihren Sohn ging. Während ihr Nichtsnutz von kiffendem Bruder von ihrer Mutter stets „Amore“ genannt wurde, wurde ihr höchstens ein „Carissima“ gegönnt. Das bedeutete zwar „Liebste“, lag aber auf der Skala der Liebesbezeugungen meilenweit unter „Amore“, das durch nichts zu toppen war.
„Ist ja mal wieder spät geworden bei meinem Bruderherz“, brummte Fiorina und überlegte, wie viele Joints er seit dem vergangenen Abend wohl geraucht hatte.
„Der Arme, bestimmt hat er wieder die ganze Nacht gearbeitet.“ Sorgenvoll schüttelte Rosetta Luccarelli die schwarzen, nur da und dort angegrauten Locken und drehte das Gas der Herdplatte herunter, sodass der Gemüseeintopf nur noch leicht köchelte. „Wenn die ihm für dieses Kalenderprojekt auch nur die Hälfte der Zeit bezahlen würden, die er dafür opfert, dann müsste ich mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, wovon wir die neue Waschmaschine bezahlen sollen.“
Fiorina dachte an die Spülmaschine, die in letzter Zeit seltsame Geräusche machte und über kurz oder lang ebenfalls den Geist aufgeben würde. Sie war überzeugt, dass Federico in der Nacht keineswegs Aufnahmen für dieses todsicher niemals zum Abschluss kommende Kalenderprojekt „Elba by night“ gemacht hatte – wie auch, bei diesem Höllenwetter?
Der Sturm schien sich endlich zu legen. Der Regen prasselte zwar nach wie vor gegen die Fensterläden, doch nicht mehr so stark wie noch vor wenigen Minuten.
„Aber so ist es nun mal, und warum, frage ich dich“, fuhr Fiorinas Mutter mit ihrer unerschöpflichen Energie fort, mit der sie alle bisherigen Tiefen ihres Lebens gemeistert hatte, „soll man weinen, wenn man lachen kann?“
Sie setzte sich zu Fiorina an den Tisch und wischte sich die vorbildlich manikürten Hände an der Kochschürze ab, die mit bunten Vögelchen bedruckt war. Darunter trug sie einen perfekt sitzenden, knielangen Rock aus dunkelblauem Feincord, die farblich dazu passende Strickjacke und eine Taftbluse in Alabasterweiß. Auch wenn sie nur als unterbezahlte Kassiererin arbeitete, achtete sie wie die meisten ihrer Landsmänninnen stets auf ein vorzeigbares Äußeres.
„Und deshalb, Carissima, fährst du heute noch nach Porto Azzurro.“
Fiorina fühlte, wie die Müdigkeit sie allmählich übermannte.
„Was soll ich denn da, Mamma?“, fragte sie gähnend.
„Arbeit suchen.“
„Und wo, bitte schön?“
„Renata hat mir von einem Zettel erzählt, im Coop.“ Rosetta Luccarelli tauchte einen Cantuccino in ihren Caffè. Inzwischen war sie bei der dritten Tasse, zusammen mit den Mandelkeksen ihr übliches Frühstück, bevor sie zu ihrer Arbeitsstelle aufbrach. „Da steht, dass ein deutscher Signore eine Haushaltshilfe sucht, die putzen und kochen kann.“
„Als Haushaltshilfe? Bei einem Deutschen?“ Fiorina verdrehte die Augen. „Und seit wann kann ich kochen?“
„Es wird Zeit, dass du es endlich lernst, Cara mia. Jede Frau, die heiraten und Kinder haben will, muss kochen können.“
„Mamma, du weißt doch, der Zug ist für mich abgefahren.“ Fiorina hatte keine Lust auf Streit, erst recht nicht so früh am Morgen. „Schau, ich bin nun mal Psychologin, ist doch logisch, dass …“
„Certo, und zwar eine, die hier auf der Insel bestenfalls als Hilfskraft im Kindergarten unterkommt, wie bei deiner vorletzten Stelle, wo du noch weniger verdient hast als ich, oder die sich als Telefontrösterin jede Nacht mit den Problemen von Alkoholikern, Junkies und anderen Verrückten herumschlagen muss.“ Ihre Mutter schnaubte. „Gut, dass sie die Telefonseelsorge zumachen – endlich muss ich nicht mehr dauernd Angst haben, dass dir einer von diesen Asozialen auflauert, wenn du im Dunkeln nach Hause gehst.“
„Mamma, das sind Menschen in Not und keine …“
„Auf dem Zettel steht, dass der Signore nur jemanden nimmt, der Deutsch spricht. Renata sagt, dass er gut zahlt, das ist sogar rot unterstrichen, und geregelte Arbeitszeiten hättest du auch.“ Rosetta Luccarelli schob ihrer Tochter ein Post-it zu, auf dem sie die Telefonnummer dieses Superarbeitgebers notiert hatte. „Da rufst du nachher an und bewirbst dich, basta!“
Fiorina wusste, es hatte keinen Sinn, noch länger zu diskutieren. Auch wenn sie nicht so müde gewesen wäre, wie hätte sie argumentieren sollen? Sie brauchten das Geld. Und wenn Mamma sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann war Widerspruch zwecklos. Ergeben nickte sie.
„Perfetto, und wenn du dich bei dem deutschen Signore vorstellst, dann zieh dir ausnahmsweise mal was Nettes an.“ Sie ließ einen missbilligenden Blick über Fiorinas Leggings und Schlabberpulli wandern.
Trotz ihrer Erschöpfung raffte Fiorina sich noch einmal auf. „Mamma, warum soll ich mich in Schale werfen, wenn ich den Job sowieso nicht kriegen werde? Ich kann nicht kochen, ich will nicht putzen. Außerdem bin ich dreiunddreißig und weiß selbst …“
„Ja, und vor allem kannst du die Deutschen nicht leiden. So, und jetzt muss ich los, mein Bus geht gleich. Schlüssel, Handy, ich glaube, ich habe alles.“ Rosetta Luccarelli kramte in ihrer Handtasche, die an der Stuhllehne hing. „In zehn Minuten kannst du den Herd ausschalten. Und bring der Nonna ihr Essen rauf, bevor du nach Porto Azzurro fährst, okay?“
Ihre Mutter küsste sie links und rechts auf die Wange, schwang die Handtasche über die Schulter und verschwand im dunklen Flur. Im nächsten Moment rumpelte etwas. Wie üblich hatte sie kein Licht gemacht, um Strom zu sparen.
„Was liegt denn hier herum?“, hörte Fiorina sie schimpfen. „Jetzt hab ich mir auch noch den Strumpf zerrissen, ach herrje. Ist das dein Aktenkoffer, Fiorina?“
„Der muss Federico gehören. Ich weiß nichts von einem Aktenkoffer.“
Sie wunderte sich, wofür er seit Neuestem so etwas brauchte. Für seine Kameraausrüstung, die er meist ohnehin nur zur Tarnung mitnahm, hatte er einen silbernen Metallkoffer.
„Er räumt sein Zeug doch nie weg, Mamma“, rief sie, während ihr wieder die Kündigungsmail durch den Kopf geisterte. Von einem Tag auf den anderen, unfassbar.
„Und eine Riesenschweinerei hat dein Bruder hier gemacht, Madonna santa.“ Die Wohnungstür wurde geöffnet. Wieder fuhr der kalte Wind durch die Küche. „Kannst du die Pfütze bitte gleich aufwischen, Carissima? Ich habe es wirklich eilig. Bis später, ci vediamo.“
Fiorina murmelte etwas, das sehr nach einem derben Fluch klang, verschränkte die Arme auf dem Tisch und legte den Kopf darauf. Und dass ich für einen Deutschen das Dienstmädchen mache, hat mir gerade noch gefehlt, dachte sie. Dann war sie eingeschlafen.
Frau Dr. Luccarelli …
Fiorina Luccarelli: (lacht) Nein, keine Doktorin. Dottore oder Dottoressa wird bei uns in Italien jeder genannt, der etwas studiert hat. Einfach Fiorina, bitte.
Fiorina, wieso sprichst du so gut Deutsch?
Fiorina: Weil ich lange in Frankfurt studiert und später gearbeitet habe.
Herr Berensen …
Hagen Berensen: Hagen bitte, wenn wir schon alle beim Du sind.
Wie hat es dich nach Elba verschlagen? Wie es aussieht, hast du dich hier mit gerade mal Ende dreißig zur Ruhe gesetzt.
Hagen: Na ja. Ich bin zu Geld gekommen, und mein Job bei der Münchner Kripo hat mir sowieso keinen Spaß mehr gemacht. Außerdem die Scheidung von meiner Frau. Ich hatte Lust auf was Neues.
Darf man fragen, wie du zu so viel Geld gekommen bist, dass du dir eine Villa am Meer, eine große Jacht und sogar einen Ferrari leisten kannst?
Hagen: Fragen darf man alles.
Fiorina: (lacht wieder) Mir will er es auch nicht verraten. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nichts Kriminelles hinter Hagens plötzlichem Reichtum steckt.
Bevor ihr mit euren Ermittlungen begonnen habt, hast du bei ihm als Haushälterin gearbeitet.
Fiorina: (nickt nachdrücklich) Für mich als Psychologin ist es wahnsinnig schwer, auf der Insel eine adäquate Stelle zu finden. Immer ist alles befristet, wenn man überhaupt mal etwas ergattert. Vielen jungen Leuten geht es wie mir, sie wohnen mit 30 Jahren immer noch bei Mamma.
So habt ihr euch kennengelernt?
Hagen: Richtig. Anfangs haben wir uns ziemlich gekabbelt, nicht wahr, Blümchen?
Fiorina: (zieht eine Grimasse) Fiorina ist die Verkleinerungsform von Fiore, das bedeutet Blume. Und ich hasse es, wenn er mich so nennt.
Hagen: Alles fing damit an, dass bei Portoferraio eine männliche Wasserleiche angeschwemmt wurde. Dann habe ich Fiorina und ihrem Bruder Federico geholfen, der in einer üblen Bredouille
steckte. Wir hatten ein bisschen Stress mit einem Mafioso …
Fiorina: (fuchtelt wild mit den Händen) Wir waren in einem illegalen Spielcasino in Pisa, fanden am Tag darauf in Livorno die nächste Leiche, gerieten unter Mordverdacht, wurden verhört, Madonna … (mit dramatischer Miene) Und die ganze Zeit über habe ich Todesängste um meine Mamma und Federico ausgestanden …
Bei den Ermittlungen kam dir deine Erfahrung als früherer Kripokommissar sicher sehr zustatten, Hagen.
Hagen zuckt mit den Schultern.
Fiorina: (mit leuchtenden Augen) Er war großartig. Wie gekonnt er die Zeugen aus der Reserve gelockt, wie professionell er sie mit Fragen gelöchert hat. Sogar ich hätte ihm geglaubt, dass er ein echter Commissario von Europol ist.
Hagen: Als Polizei-Dolmetscherin warst du aber auch nicht schlecht, Blümchen. Du hättest Schauspielerin werden sollen. Dazu deine feinen Antennen für die Emotionen anderer – ohne deine weibliche Intuition hätten wir den Fall nie aufgeklärt.
Und jetzt seid ihr ein Paar?
Fiorina und Hagen wechseln einen Blick, sie lacht, er guckt finster.
Hagen: Bei einer Italienerin weiß man das nie so genau … Jedenfalls kabbeln wir uns nicht mehr ganz so oft.
Fiorina: (macht eine große Geste) „Grande amore, grande dolore“, sagen wir in Italien – keine Liebe ohne Schmerz. (tätschelt seine Hand) Mir zuliebe lernt er sogar Italienisch. Ist das nicht süß?Eure Zusammenarbeit hat aber offenbar bestens funktioniert. Würdet ihr noch einmal gemeinsam ermitteln?
Hagen: Na ja, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Das Leben als Millionär kann ätzend langweilig sein.
Fiorina: Wenn, dann aber bitte ohne Leiche. Andrerseits, wenn die Carabinieri mal wieder nicht wissen, wo vorne und hinten ist …
Und deine berufliche Zukunft, Fiorina?
Fiorina: (ein wenig verlegen) Sieht eigentlich ganz gut aus. Während Hagen und ich Federicos Problem gelöst haben …
Wobei ihr en passant zwei Verbrechen aufgeklärt habt …
Fiorina: Allora … (räuspert sich unbehaglich) Aufgrund gewisser Umstände kann ich mich endlich selbstständig machen. Ich werde demnächst eine Praxis für Psychotherapie eröffnen.Dann wirklich als Frau Doktor?
Hagen: (lacht laut) Es nennt sie doch sowieso jeder auf der Insel Dottoressa. Wozu sollte sie sich da die Mühe machen, eine Doktorarbeit zu schreiben?
Fiorina Luccarelli
Fiorina ist eine Vollblutitalienerin, die wegen ihres Psychologiestudiums und späterer beruflicher Tätigkeit in Frankfurt sehr gut Deutsch spricht. Inzwischen lebt sie wieder in Portoferraio, Elbas Hauptstadt,und hungert sich mit ständig wechselnden Jobs unter anderem als Fremdenführerin und Telefonseelsorgerin durch. Sie hat ein feines Gespür für die Nöte anderer, kann Ungerechtigkeit nicht ertragen und sich selten bremsen, wenn es ein Verbrechen aufzuklären gibt. Ihr schauspielerisches Talent kommt ihr dabei sehr zustatten. Da das Geld immer knapp ist und sie keine angemessene Stelle findet, wohnt sie als Frau von über dreißig Jahren wie so viele Italienerinnen wieder bei Mama in einem sanierungsbedürftigen Haus in einer der steilen Gassen der Altstadt Portoferraios.
Hagen Berensen
Ende dreißig, groß und kräftig, eher träge als agil, keinem Genuss abgeneigt. Er hat seinen Beruf bei der Münchner Kripo an den Nagel gehängt, nachdem er auf unklare Weise zu sehr viel Geld gekommen ist. Seine Frau hatte ihn schon zuvor verlassen, was ihn jedoch nicht allzu hart traf, da die Ehe ohnehin nicht mehr so toll war. Er hat einen erwachsenen Stiefsohn aus dieser Beziehung, der sich bei Hagen nur meldet, wenn er wieder einmal Geld braucht. Nun sitzt Hagen in seiner zugigen und feuchten Villa an der Ostküste der Insel in der Nähe von Porto Azzurro, ist zu faul, Italienisch zu lernen, besitzt eine Jacht und einen Ferrari, ernährt sich im Wesentlichen von deutscher Tiefkühlpizza und hat keine Idee, was er mit sich und seiner vielen Freizeit anfangen soll























DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.