
Der Hof der Wunder (Der Hof der Wunder 1) - eBook-Ausgabe
Roman
Das Szenario liest sich frisch und unverbraucht und ließ mich über die ein oder andere Schwäche gern hinwegsehen. Besonders zum Ende hin hatte ich beim Lesen jede Menge Spaß. - Buchwinkel
Der Hof der Wunder (Der Hof der Wunder 1) — Inhalt
In einem alternativen Paris des Jahres 1828 ist die Französische Revolution fehlgeschlagen. Skrupellose Aristokraten teilen sich die Stadt mit neun kriminellen Gilden, die die Unterwelt regieren. Zwischen den Gilden herrscht ein brüchiger Frieden. Nina, Angehörige der Diebesgilde, versucht, das junge Mädchen Ettie zu retten. Denn ausgerechnet Kaplan, der Oberste der „Gilde des Fleisches“, spezialisiert auf Menschenhandel und Prostitution, hat es auf die schutzlose Ettie abgesehen. Doch die verbündeten Diebe wollen sich nicht mit Kaplan anlegen. Nina und Ettie bleibt nichts anderes übrig, als sich den verfeindeten Gilden anzudienen und bis zur großen Zusammenkunft der Gilden, dem legendären Hof der Wunder, zu überleben. Aber als Kaplan auf die Spur der beiden kommt, droht in ganz Paris ein Krieg auszubrechen ...
Leseprobe zu „Der Hof der Wunder (Der Hof der Wunder 1)“
1
Le Debut de l’Histoire
Es ist die Zeit einer Hungersnot, eine Zeit, in der einen das Verlangen nach Nahrung quält und von innen nach außen zu verschlingen droht, das einen nur noch auf den Tod warten lässt. Und Tod, der Endlose, kommt immer.
Lange vor Anbruch der Morgendämmerung ist es dunkel und still. Die Leichen der Verhungerten hat man während der Nacht auf das Straßenpflaster von Paris gelegt, wo sie auf die Karren warten, die sie fortbringen werden. Die Toten haben die Augen weit aufgerissen, sie hören nichts; ihnen ist alles egal, und sie haben [...]
1
Le Debut de l’Histoire
Es ist die Zeit einer Hungersnot, eine Zeit, in der einen das Verlangen nach Nahrung quält und von innen nach außen zu verschlingen droht, das einen nur noch auf den Tod warten lässt. Und Tod, der Endlose, kommt immer.
Lange vor Anbruch der Morgendämmerung ist es dunkel und still. Die Leichen der Verhungerten hat man während der Nacht auf das Straßenpflaster von Paris gelegt, wo sie auf die Karren warten, die sie fortbringen werden. Die Toten haben die Augen weit aufgerissen, sie hören nichts; ihnen ist alles egal, und sie haben keine Angst mehr. Sie erinnern mich an meine Schwester Azelma.
Azelma, die niemals weint, hat zwei ganze Tage lang geweint. Ich habe den Grund dafür nicht begriffen, sie wollte weder essen noch schlafen. Ich habe alles getan, damit sie aufhört. Ich habe ihr sogar gesagt, dass Vater mit zwei Flaschen Schnaps im Bauch und Zorn im Blick kommt. Aber sie hat sich nicht gerührt, hat nicht zugehört, ihr war alles egal. Sie hatte keine Angst mehr.
Am dritten Tag hat sie schließlich aufgehört. Ein paar Stunden lang hat sie auf dem Bett gelegen und in die Ferne gestarrt. Sie reagierte nicht, sah mich nicht einmal an. Ich glaube, das Weinen gefiel mir besser.
Normalerweise hat Azelma mich mit einem gemurmelten „Komm schon, petite chaton“ geweckt, und ich habe mich in ihre Wärme gekuschelt, während sie mir das Haar gebürstet und mir beim Anziehen geholfen hat.
Jetzt schlüpfe ich ohne sie aus dem Bett und ziehe mich in der Kälte an, nehme das Kleid, das mir langsam zu kurz wird.
Ich zerre ein paarmal mit der Bürste an meinem Haar und flechte es zu einem schiefen Zopf. Dann spritze ich mir eiskaltes Wasser aus dem schweren Porzellankrug ins Gesicht und werfe meiner Schwester einen verstohlenen Blick zu. Sie liegt auf der Seite, die Augen weit geöffnet, ohne etwas zu sehen.
Die Schenke ist still zu dieser Stunde. Ich zögere kurz, aber Azelma regt sich nicht, also gehe ich nach unten, schnappe mir einen Eimer und nehme ein verblichenes Schultertuch vom Haken. Es gehört meiner Schwester und ist mir zu groß, aber der Brunnen ist viele Straßen von der Schenke entfernt, und der Weg wird kalt sein. Ich hasse den Weg in der Dunkelheit, und ihn allein zu gehen hasse ich auch, aber ich muss es tun.
Draußen eile ich zum Brunnen und versuche den Blick auf die Leichen auf der Straße zu vermeiden, als ich an ihnen vorbeikomme. Am Brunnen senke ich den Eimer und hieve ihn gefüllt wieder nach oben. Meine eiskalten Finger kämpfen mit der Last.
Der Weg zurück ist gefährlich glatt, und bei jedem vorsichtigen Schritt gefriert mein Atem zu Wolken. Mit jedem Atemzug denke ich an meine Schwester, und wieder nagt die Furcht an mir.
Als ich die Schenke erreiche, sind meine zitternden Finger erleichtert, den Eimer abstellen zu können. Ich schütte etwas Wasser in einen Topf und setze ihn zum Kochen auf, dann blicke ich mich um. Der Boden muss geschrubbt werden, obwohl das den Gestank von altem Wein nicht entfernen wird. Im Dämmerlicht ist der Schankraum ein wahres Chaos aus Tellern, leeren Bechern und Krügen; das alles muss gespült werden.
Ich habe Hunderte Teller gespült und abgetrocknet, habe den Boden Dutzende Male geputzt, und Azelma war immer an meiner Seite. Sie rümpfte die Nase, bespritzte mich mit Seifenblasen und sagte: „Katzen hassen Wasser.“
Mit einem Seufzen entscheide ich mich, mit dem Boden anzufangen. Der Besen ist schwer, er lässt meine müden Arme schrecklich schmerzen, aber ich schiebe ihn energisch über die Bohlen. Vielleicht gelingt es mir ja, die Weinflecken wegzuscheuern. Vielleicht kann ich auch die Worte wegscheuern, die mir unablässig durch den Kopf gehen.
Meine Schwester, meine Schwester.
Gestern Abend hat Vater nichts gesagt, als Azelma schon den dritten Abend hintereinander nicht aus dem Zimmer kam. Als hätte er vergessen, dass es sie gibt. Er hat gesummt, fröhlich mit den Fingern auf den Tisch getrommelt. Er hat mir sogar ein Stück warme Brioche zugeworfen, was so ungewöhnlich war, dass ich mich kaum überwinden konnte, es zu essen. In der ganzen Stadt gibt es kaum genug Mehl für Brot, geschweige denn für Brioche, also weiß ich nicht, wo er sie gestohlen hat. Mein Vater ist ein Dieb. Statt diesem Stück Backwerk hat er sonst funkelnde Juwelen und schwere Börsen voller Gold gestohlen. Aber welchen Nutzen hat Gold schon in Zeiten der Hungersnot?
Bei dem Duft der Brioche hat mein Magen laut geknurrt. Aber die Furcht nagte viel dringlicher an meinen Knochen als der Hunger, also brachte ich Azelma das Gebäck, wo es noch immer auf dem angeschlagenen Teller neben ihrem Bett liegt und vertrocknet.
Meine Hände sind vom Putzen gerötet, auf meiner Stirn perlen Schweißtropfen, aber ich zittere noch immer. Wenn Azelma nicht isst, wird sie schon bald bei den Leichen draußen in der Kälte liegen und darauf warten, dass man sie abholt. Doch sie ist weder krank noch fiebrig, davon habe ich mich überzeugt. Mit ihr stimmt etwas anderes nicht, etwas Schreckliches. Aber was noch viel schlimmer ist, ich kann nichts tun, damit es aufhört. Ich komme mir wie das Kätzchen vor, mit dem Azelma mich immer vergleicht – winzig und zerbrechlich schlage ich mit den Pfötchen gegen den Wind.
Von der Treppe kommt ein Laut. Ich drehe mich um. Dort steht Azelma. Sie hat sich angezogen und das Haar geflochten, sie sieht mich an. Das sollte mich erleichtern, aber ihre Miene ist beunruhigend.
„Ich mache den Rest“, sagt sie tonlos. „Du holst Femi.“
Eigentlich sollte ich froh sein, nicht mehr putzen zu müssen, aber meine Finger fassen den Besenstiel nur noch fester. Ich runzle die Stirn. Warum soll ich Femi Vano holen, den man den „Boten“ nennt? Er kommt und geht, wie er will, flüstert meinem Vater Dinge ins Ohr. Er spricht leise mit Azelma und bringt sie zum Lachen. Aber die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen; Vater schnarcht in seinem Bett. Warum muss ich jetzt Femi holen? Können wir nicht einfach Seite an Seite putzen, wie sonst auch?
Azelma kommt die Stufen herunter und nimmt mir den Besen ab. Meine Schwester kann mit Worten umgehen; ihre Stimme ist wie Honig, und die Gäste lieben sie dafür. Und weil sie hübsch und anschmiegsam ist. Aber auch wenn sie jetzt gedämpft spricht, ihr Tonfall ist befehlend.
„Bring ihn nach hinten und sag es niemandem. Hast du mich verstanden?“
Ich nicke und gehe zögernd zur Tür.
Azelma fragt mich sonst immer, ob ich ein Schultertuch habe. Oder sie erinnert mich daran, dass ich einen Mantel brauche. Sie ermahnt mich, vorsichtig zu sein und nicht zu trödeln. Aber diesmal wendet sie sich ab und sagt kein Wort. Ich werfe ihr einen letzten Blick über die Schulter zu. Dieses harte Mädchen kenne ich nicht. Sie ist nicht meine Schwester. Sie ist etwas anderes, ein hohles Ding, das nur das Gesicht meiner Schwester trägt.
Ich rufe Femi, indem ich auf die Weise pfeife, die er mir beigebracht hat. Plötzlich ist er da, scheinbar wie aus dem Nichts.
„Kätzchen“, sagt er mit einer angedeuteten Verbeugung, aber ich habe keine Zeit für seine Höflichkeiten und zerre ihn am Arm zur Schenke. Azelma schaut mit leblosem Blick zu uns auf und befiehlt mir, das Kerzenwachs von den Tischen zu kratzen und in den Topf zu werfen, in dem man es zu neuen Kerzen schmelzen wird. Als sie aus der Hintertür schlüpft, um mit Femi zu sprechen, schleiche ich auf Zehenspitzen in die Küche und klettere auf den hohen roten Hocker, den ich fürs Spülen benutze. Auf die Zehen gestellt, kann ich durch die zersprungene Scheibe gerade eben den oberen Teil ihrer Köpfe ausmachen. Sie stehen an der Wand, drücken sich dagegen.
„Er kommt dich holen?“, höre ich Femi fragen.
Ein langes Schweigen folgt. Als Azelma endlich spricht, klingt ihre Stimme bitter. „Vater wird noch etwas feilschen, das tut er immer. Du musst sie mitnehmen, solange sie beschäftigt sind. Ihnen wird gar nicht auffallen, dass sie weg ist.“
„Wir können fliehen.“ Femis Stimme hebt sich verzweifelt. „Wir können uns verstecken.“
„Wer ist ihm jemals entronnen? Wie weit werden wir schon kommen, bevor man uns findet? Selbst wenn wir durch ein Wunder entfliehen könnten, würden wir sie verdammen, denn man wird uns mit Sicherheit aufspüren. Und wenn wir sie zurücklassen, wer wird dann wohl den Zorn meines Vaters zu spüren bekommen, was glaubst du? Hast du schon einmal daran gedacht, wen er Kaplan ausliefern könnte, um ihn zu beschwichtigen? Oder mich zu bestrafen?“
Azelma schüttelt den Kopf und blickt zum Fenster, als würde sie mich dort spüren. Ich ducke mich, damit sie mich nicht sieht.
„Du hast mir süße Dinge zugeflüstert, Femi Vano“, sagt sie, und ich hebe gerade rechtzeitig den Kopf, um zu sehen, wie sie ihm sanft die Hand an die Wange legt. „Aber wo ich hingehe, werden die Worte verblassen. Wenn ich Glück habe, werde ich mich an nichts erinnern. Schwöre es mir bei Knochen und Eisen – du wirst einen Beschützer für sie finden.“
Femi hebt die Hand, und nach einer funkelnden Bewegung seines Messers ist die Handfläche von einem langen dunklen Strich gezeichnet. Blutstropfen bilden sich wie schwarze Diamanten.
„Mein Wort, mein Blut“, sagt er. „Ich gebe dir mein Versprechen bei Knochen und Eisen.“
Ihre Stimme wird weicher, sie legt eine Hand auf seine Brust. „Liegt dir etwas an mir?“
„Das weißt du doch.“
„Dann weine nicht um mich. Ich bin bereits tot.“
„Nein, nicht tot. Die Toten sind wenigstens frei …“
Als Azelma zurück ins Haus kommt, ist ihr Gesicht eine kalte Maske. Femi folgt ihr. Wie seine Vorfahren, die Maghrebiner aus Nordafrika, trägt er sein dichtes Haar in Zöpfen. Er hüllt sich immer in einen schweren braunen Umhang, ganz egal, welches Wetter herrscht, der Stoff ist voller Regenflecken, und die Säume sind ausgefranst. Es lässt ihn aussehen, als hätte er große, zusammengefaltete Flügel. Seine dunkle Haut wirkt wie poliertes Kupfer, er hat eine Hakennase, und seine Augen leuchten wild und golden. Und im Moment sind sie rot gerändert.
Azelma bedeutet mir, zu ihr zu kommen. Ich nehme ihre Hand, meine kleine Hand liegt in ihrer kalten, als sie mich die Treppe hinauf in unser Zimmer führt.
Auf dem Bett liegen ein paar alte Kleidungsstücke, Jungenkleidung, viel zu groß und seit Ewigkeiten weitergereicht.
Ihr Blick wandert erbarmungslos über meine dürre Gestalt. Bei meinem Gesicht hält sie inne und mustert mich, als würde sie nach etwas suchen. „Dieu soit loué, wenigstens bist du nicht hübsch.“ Ihre Stimme bricht.
Sie hat recht. Wo sie nur aus weichen Kurven besteht, bin ich eckig und knochig. Wir haben nur unsere olivfarbene Haut gemeinsam, das Erbe der Pieds-noirs aus Algerien, denen unsere Mutter angehörte. Als ich noch klein war und der Winterwind rachsüchtigen Geistern gleich an unseren Schlagläden rüttelte, legte Azelma die weichen Arme um mich und erzählte mir Geschichten. „Welche möchtest du hören, kleine Katze?“
„Erzähl mir von unserer Mutter.“
Vater behauptet, sie sei eine Ratte gewesen, weil sie uns bei ihm gelassen hat.
„Die Frau, die uns zur Welt gebracht hat, ist nicht unsere wahre Mutter“, pflegte Azelma zu sagen. „Unsere Mutter ist die Stadt.“
Aber selbst ich wusste, dass nicht die Stadt uns unsere olivfarbene Haut und das rabenschwarze Haar zum Geschenk gemacht hat.
Jetzt fällt Azelmas Blick auf den dicken Zopf, den ich mühsam allein geflochten habe. Sie streckt die Hand aus, und ich komme zu ihr. Mit sanften, aber energischen Fingern löst sie den Zopf und fängt an, ihn auszukämmen.
„Unsere Mutter, die Stadt, ist keine mitfühlsame Mutter“, sagt sie, während sie mein Haar mit einer Hand zusammenfasst. „Es ist gefährlich, in dieser Stadt ein Mädchen zu sein. Sie wird böse Dinge auf dich herabbeschwören. Und die Stadt ist nicht gnädig zu jenen, die sich nicht verteidigen können. Sie schickt Tod den Endlosen, um die Schwachen von den Starken zu trennen. Das weißt du.“
Ich höre den Laut, bevor mir klar wird, was da passiert. Ein scharfes, schneidendes Geräusch und ein plötzlich leichtes Gefühl im Nacken. Ich reiße die Augen auf, aber bevor ich etwas sagen kann, landet ein dunkler Haarschopf lautlos neben meinen Füßen. Azelma legt die Schere an den Rest meines Kopfes und schneidet das Haar ganz kurz.
„Halte es immer kurz.“ Als sie fertig ist, sagt sie: „Zieh das Kleid aus.“
Verwundert gehorche ich, meine Hände zittern, als ich die Knöpfe öffne, die sie dort angenäht hat. Früher hat sie mich immer gezwungen, wie eine Statue mit ausgebreiteten Armen dazustehen, während sie mir eines ihrer alten Kleider anpasste, den Mund voller Stecknadeln. Ich habe dann die Augen immer fest zugekniffen, weil ich Angst hatte, die verrosteten Nadeln würden mich stechen und bluten lassen. Das ließ sie nur hinter den gespitzten Lippen mit der Zunge schnalzen. „Bis jetzt habe ich dich noch nie gestochen, kleines Kätzchen.“
Jetzt streckt sie die Hand aus, während ich das Kleid vom Körper schäle und ihr gebe. Ich stehe in dem oft geflickten Leinenhemdchen vor ihr.
„Das auch.“
Nun, völlig nackt, lassen mich Kälte und Furcht frieren.
„Höre meine Worte, denn sie sind das Einzige, was ich dir noch geben kann. Lege sie wie eine Rüstung um dein Fleisch. Du darfst mein Gesicht und meine Stimme vergessen, aber nie die Dinge, die ich dir sage.“
„Das werde ich nicht.“ Ich versuche, nicht zu zittern.
„Iss nur genug, um am Leben zu bleiben. Du musst dich an den Hunger gewöhnen, damit er dich nicht brechen kann. Bleib klein, zwänge dich in enge Räume, damit sie dich immer brauchen werden.“
Ich will sie fragen, wer sie sind und wozu sie mich brauchen werden, aber ihr Ton ist ernst, und die Zunge klebt mir am Gaumen fest.
„Keine Kleider mehr. Lass nicht zu, dass Männer dich mit Verlangen ansehen.“ Sie wickelt ein Stück dünnen Stoff um meine Brust und bindet ihn so fest, dass ich kaum Luft bekomme. „Schlinge Stoffbahnen um jeden Teil von dir, der weich ist.“
Sie gibt mir ein zu großes Paar Hosen, das so verblichen ist, dass man ihm nun keine besondere Farbe mehr zuschreiben kann. Ich ziehe sie schnell an, dann lasse ich ein weites Hemd folgen.
„Trage Kleidung wie eine Maske, damit dich niemand wahrnimmt. Verstehst du? Trage sie, um dein wahres Gesicht zu verbergen. Du bist nicht Nina, das Kätzchen, du bist die Schwarze Katze. Zeige bei jeder Gelegenheit deine Zähne und Krallen, damit die anderen nicht vergessen, dass du gefährlich bist. Erst dann wirst du eine gewisse Sicherheit haben. Ein Auge voll Schlaf.“
Ich schnüre ein paar dicke Stiefel zu, die bereits mehrere Besitzer gehabt haben, dann setze ich eine große Mütze auf, die mein kleines Gesicht in Schatten hüllt.
„Vater mag vielleicht seine Silberzunge an mich weitergegeben haben, aber dir gab er seinen scharfen Verstand. Du bist schlau, Nina, und das ist eine Waffe. Du bist klein, und du bist schnell. Und auch das sind Waffen.“ Sie schnappt sich meine Handgelenke und blickt mir ins Gesicht. „Sei nützlich, sei klug und allen anderen immer einen Schritt voraus. Sei tapfer, selbst wenn du Angst hast. Vergiss nie, jeder hat Angst.“
Jetzt habe ich Angst vor ihr. Vor den zwei Tagen des unablässigen Weinens und der leeren Blicke und dem Feuer, das nun in ihren sonst so sanften Augen lodert. Was ist mit meiner Schwester geschehen?
„Wenn du glaubst, dass die Finsternis dich holen will, wenn du dich klein und schwach fühlst und befürchtest, dass unsere Mutter, die Stadt, dich vernichten will, darfst du das nicht zulassen. Hast du mich verstanden? Du musst überleben!“
„Das w…werde ich, ich schwöre es.“ Meine Stimme zittert.
Wir gehen nach unten, wo Femi Vano in den Schatten wartet.
„Du wirst Femi begleiten und tun, was er dir sagt.“
Neue Angst lässt mein Herz rasen. „Aber ich will bei dir bleiben!“
Dieser ausgeschnittene Schatten von Schwester beugt sich vor und schaut mir in die Augen. Ihre Stimme klingt hohl.
„Manchmal müssen wir einen schrecklichen Preis zahlen, um die Dinge zu beschützen, die wir lieben.“
Ich verstehe nicht, was sie meint, und ich will ihr hundert Fragen stellen, aber ich finde nicht die richtigen Worte. Sie bleiben mir im Hals stecken, während mir Tränen über die Wangen laufen. Azelma ignoriert sie.
„Von nun an musst du auf dich selbst aufpassen.“ Sie sieht Femi an, ihr Blick ist wie Eis. „Bring sie weg.“
Es gibt keinen Abschied, keine Umarmung, sie verkündet nicht ihre Liebe für mich. Stattdessen stößt sie mich fort, als würde sie mich nicht länger wollen.
„Zelle?“
Sie fängt an, die Tische zu wischen.
„Zelle …“ Ich will zu ihr gehen, aber Femi hält mich davon ab.
„Sei still.“ Sorge liegt in seiner Stimme. Er hat Angst, aber ich verstehe den Grund nicht.
Dann höre ich es. Über dem lauten Trommeln meines Herzens höre ich Stiefel auf dem Kies knirschen. Draußen ertönen Stimmen.
„Geht jetzt!“, zischt Azelma.
Femi nimmt mich auf den Arm, drückt mich an sich. Ich fühle, wie seine Furcht auf mich übergreift.
Er zerrt mich in die Küche, fort von Azelma, die den Bruchteil einer Sekunde einen gequälten Blick über die Schulter in unsere Richtung wirft. Dann wendet sie sich ab und richtet sich auf. Ihr Kopf ist hocherhoben, ihre Hände ballen sich zu Fäusten.
Ich will ihren Namen rufen, aber Femis Hand legt sich fest auf meinen Mund.
„Thénardier!“ Ein Brüllen vor dem Eingang der Schenke zerbricht die Stille, ein geknurrter, durchdringender Befehl. Femi erstarrt. Über uns höre ich unbeholfenes Gepolter. Der Ruf scheint Vater aus seinem Schlummer gerissen zu haben. Es erstaunt mich, dass, wer auch immer dort unten steht, ihn mit einem Wort aus dem betrunkenen Schlaf holen konnte.
Femi wagt einen Blick aus dem Fenster; er sieht nach, ob jemand auf dem Hof steht.
Ich höre, wie sich die Schenkentür öffnet.
Dann ertönt die honigsüße Stimme meines ausgesprochen verkaterten Vaters oben an der Treppe. Ich höre die Unsicherheit, die darin steckt. „Gildenherr Kaplan?“
Der Besucher ist eingetreten, während Femi uns in den Schatten der Küche lautlos zur Hintertür zerrt. Jeder Schritt ist winzig und genau berechnet, versucht so lautlos wie möglich zu sein.
„Vergebt mir“, fährt mein Vater fort, „ich hätte nicht gedacht, dass Ihr Euch selbst um diese unbedeutende Angelegenheit kümmern würdet.“
„Eine unbedeutende Angelegenheit, Meister der Tiere?“, erwidert die knurrende Stimme, die das Schenkendach selbst zum Erzittern zu bringen scheint. „Hast du vergessen, wer ich bin? Hast du vergessen, warum ich hier bin? Ich wollte sehen, ob du es tatsächlich tust – ob selbst ein Mann wie du wirklich sein eigenes Fleisch und Blut verkauft.“
Sein eigenes Fleisch und Blut verkauft? Die Erkenntnis trifft mich wie eine Faust und raubt mir den Atem.
Azelma … Vater will Azelma verkaufen?
„Ich habe hier zwölf Goldstücke, Thénardier.“
„Zwölf …“, wiederholt Vater, aber seine Stimme ist berechnend. Zorn steigt in mir auf, denn ich kenne diesen Ton. Er tut, was er immer tut. Er feilscht um einen besseren Preis für seine eigene Tochter.
Ich beiße in Femis Hand, aber er lockert seinen Griff nicht und zieht mich hinaus in die Dunkelheit.

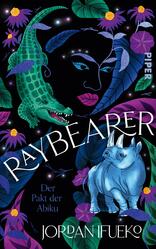


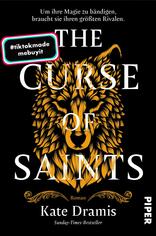





DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.