
Der Kuss des Engels (Engel 1) - eBook-Ausgabe
Roman (Engel 1)
„Nach den Vampiren sorgen jetzt Engel für Herzflattern bei Fantasy-Fans. (…) In ›Der Kuss des Engels‹ heißt der gefallene Engel Rafael und die Frau, die sich auf eine verbotene Liebe mit ihm einlässt, Sophie. Autorin Sarah Lukas geht der Frage, ob das Böse in der Welt Gottes Werk oder Teufels Beitrag ist, noch raffinierter nach.“ - Brigitte
Der Kuss des Engels (Engel 1) — Inhalt
Sarah Lukas hat mit ihrem Debüt einen romantischen Paris-Reiseführer mit Engeln und Dämonen erschaffen. Die Geschichte mit Sophie und Rafael findet in „Der Kuss des Jägers“ seine Fortsetzung.
Leseprobe zu „Der Kuss des Engels (Engel 1)“
Leseprobe
Der klapprige alte Jeep rumpelte über die Schlaglöcher und warf Rafael auf dem Sitz herum wie auf einem bockenden Pferd.
„Hell of a bumpy ride.“ Jack grinste, ohne die Straße aus den Augen zu lassen. Seine von der kolumbianischen Sonne gebräunten Hände umklammerten das Lenkrad, um nicht die Kontrolle über den Wagen zu verlieren.
Ein verdammt holpriger Trip – in der Tat. Rafael erwiderte das Grinsen, obwohl der Engländer es nicht sehen konnte, weil sein Blick konzentriert nach vorn gerichtet war. Dabei hatten sie Glück, denn die Piste war im April [...]
Leseprobe
Der klapprige alte Jeep rumpelte über die Schlaglöcher und warf Rafael auf dem Sitz herum wie auf einem bockenden Pferd.
„Hell of a bumpy ride.“ Jack grinste, ohne die Straße aus den Augen zu lassen. Seine von der kolumbianischen Sonne gebräunten Hände umklammerten das Lenkrad, um nicht die Kontrolle über den Wagen zu verlieren.
Ein verdammt holpriger Trip – in der Tat. Rafael erwiderte das Grinsen, obwohl der Engländer es nicht sehen konnte, weil sein Blick konzentriert nach vorn gerichtet war. Dabei hatten sie Glück, denn die Piste war im April selten so trocken und damit passierbar. Andere freiwillige Helfer in der Krankenstation hatten ihm erzählt, dass sich die Straßen in der Regenzeit oft in Schlammbäche verwandelten, in denen auch die modernsten Fahrzeuge stecken blieben. Dann gab es kein Durchkommen zum Flugplatz mehr, und die Ärzte mussten mit den verbliebenen Vorräten auskommen, bis der Weg zum Nachschub wieder frei war.
Rafael warf einen Blick hinter sich auf die Kisten und Kartons, die sie geladen hatten. Waren die Verpackungen genug gepolstert, um die Medikamente und medizinischen Geräte zu schützen? Jack musste es wissen, denn der wettergegerbte Tropenarzt mit den tiefen Lachfalten war schon seit ein paar Monaten im kolumbianischen Hinterland und fuhr die Strecke nicht zum ersten Mal. Er hatte auch ihn zehn Tage zuvor vom Flugplatz abgeholt, der eigentlich nur eine von Häusern und Hütten umstandene Schneise im Dschungel war.
„Goodness“, entfuhr es Jack. Er trat so heftig auf die Bremse, dass Rafael in den Sicherheitsgurt geworfen wurde. Hinter einer Kurve war ein zerbeulter, blauer Laster in Sicht gekommen, der die Fahrbahn blockierte. Dunkelhaarige Männer in olivgrüner Armeekleidung hatten sich davor und auf der Ladefläche aufgereiht und richteten schwarze Gewehrläufe auf den Jeep, der in einer Staubwolke zum Stehen kam.
Rafael schluckte. Noch nie hatte jemand mit einer Waffe auf ihn gezielt. Nervös sah er zu Jack hinüber. Sollten sie nicht wenden und versuchen zu fliehen? Nein, in einem offenen Jeep war das wohl keine gute Idee.
Der Engländer musterte die Guerilleros. Oder waren es Paramilitärs? Rafael hatte sich über die Lage in Kolumbien informiert, bevor er nach Bogotá geflogen war, und wusste, dass sie in diesem Krieg keiner Seite vertrauen konnten. Doch was nützte ihm das jetzt?
„Stay calm, Rafe“, wies Jack ihn an. „Bleib ruhig. Die haben es nur auf die Medikamente abgesehen.“
Einer der Fremden, ein drahtiger Kerl mit Schnurrbart, trat einen Schritt vor, fuchtelte mit seinem Revolver herum und brüllte: „Bajan del coche! Fuera! Fuera!“
Rafael musste kein Spanisch verstehen, um zu kapieren, dass sie aussteigen sollten. Sicher war es das Beste, diese Leute nicht durch Widerstand zu provozieren.
„Get out of the car“, bestätigte ihm Jack. „Aber langsam. Ich werde ihnen diesen Geleitschein von Don Esteban zeigen. Dann werden wir sehen, was der wert ist.“ Der Engländer öffnete die Fahrertür und schob sich vom Sitz.
Widerstrebend folgte Rafael seinem Beispiel. Es fiel ihm schwer, den vermeintlichen Schutz des Wagens aufzugeben. Fast wie in Zeitlupe stieg er aus und entfernte sich von der Autotür, während Jack mit beschwichtigend erhobenen Händen spanisch auf die Guerilleros einredete.
„Rápido, rápido!“, blaffte der Anführer. Der Rest blieb für Rafael ein unverständlicher Wortschwall. Er konnte nur zwischen Jack und dem Fremden hin- und herblicken, den überhaupt nicht zu interessieren schien, was der Engländer von sich gab. Der Name Esteban fiel. Jack wollte in die Innentasche seiner Jacke greifen, wo Rafe die fragwürdigen Schutzpapiere des einflussreichen Don wusste. Sofort rissen die Bewaffneten alarmiert die Augen auf, griffen ihre Gewehre fester.
„No!“, brüllte ihr Anführer noch lauter. „No la toques!“
Jack hielt inne, sprach mit einer Ruhe weiter, die Rafe in seiner wachsenden Panik nicht fassen konnte. Unbeirrt näherte sich die Hand des Engländers erneut dem Revers.
„Nein, tu’s nicht!“, schrie Rafael in das Gebrüll des Guerilleros. Das letzte Wort ging bereits in einem Schuss unter, dann sprachen nur noch die Waffen. Im nächsten Moment schlug Rafe schon der Länge nach auf den harten, staubigen Boden und spürte seinen Körper nicht mehr. Seine Augen starrten in den wolkigen Himmel, doch was er sah, war Sophies trauriges Abschiedslächeln.
Auf diesem Stuhl hatte er gesessen. Plötzlich sah Sophie ihn so deutlich, dass sich ihr Herz schmerzhaft zusammenzog. Er trug seine Brille anstelle der Kontaktlinsen, um unter den Studenten der Sorbonne, die dieses Café gern besuchten, intellektueller zu wirken. Sie hatte gelacht, als sie ihm auf die Schliche gekommen war, und er hatte ausgelassen eingestimmt. Nichts hätte ihm an jenem Tag die Stimmung verderben können, das wusste sie. Er war glücklich gewesen, weil sie seinen Heiratsantrag angenommen hatte – oben auf dem Rundgang um die weiße Kuppel von Sacré-Cœur, das Häusermeer von Paris zu ihren Füßen und den Sommerwind in ihrem Haar. Selbst durch das Brillengestell und die Gläser, die seine Augen ein wenig verkleinerten, hatte sein Lächeln so viel Liebe ausgestrahlt, dass es sie jetzt noch wärmte. Sie spürte ihre Mundwinkel sich wie von selbst aufwärts biegen, als sei ihr Gesicht ein Spiegelbild dessen, was die Erinnerung ihr vorgaukelte.
„Un café?“ Ein Kellner, der die weiße Schürze lässig um die Hüfte geschlungen hatte wie ein Handtuch nach dem Duschen, schob sich zwischen sie und den Stuhl, der nun wieder leer im ansonsten voll besetzten Lokal stand. Der Anblick wischte das Lächeln von ihren Lippen.
„Non, merci.“ Sophie sah zu dem jungen Asiaten auf, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Ein Kaffee hätte sie geweckt, ihre Gedanken geklärt, ihr die Wahrheit mit einer Schärfe bewusst gemacht, der sie sich nicht gewachsen fühlte. „Die Rechnung, bitte.“
„Natürlich“, erwiderte der Kellner, während er mit geübten Griffen Teller und Besteck auf das bereits waghalsig auf seinem Arm verteilte Geschirr stapelte und in einem Triumph über die Schwerkraft davontrug. Er hatte es nüchtern gesagt, aber Sophies Ohren war der missbilligende Unterton nicht verborgen geblieben. Die Ablehnung, das Unverständnis, die dahinter standen, hätte sie an jedem anderen Abend mit einem Schulterzucken abgetan, doch jetzt drangen sie wie ein giftiger Stachel in ihre schutzlose, wunde Seele. Unwillkürlich ließ sie Kopf und Schultern hängen, während sie sich tiefer in ihr Inneres zurückzog. Es gab auf dieser Welt einfach keinen Platz mehr für sie. Niemand begriff, was sie verloren hatte, nicht einmal ihre Mutter. Am allerwenigsten ihre Mutter. Sie hatte Rafael nie gemocht.
Wortlos stellte der Kellner im Vorübergehen den kleinen Teller mit dem Kassenbon auf dem Tisch ab. Mechanisch kramte Sophie ihr Portemonnaie aus der Jackentasche und legte das abgezählte Kleingeld auf die Scheine, damit sie nicht heruntergeweht werden konnten. Sie war nun lange genug in Paris, um sich wieder an die Tücken des französischen Alltags zu erinnern, die sie als Ausländerin verraten konnten. Nicht, dass es darauf angekommen wäre, unerkannt zu bleiben, aber als Fremdsprachenkorrespondentin hatte sie den Ehrgeiz, Land und Leute so gut zu kennen, dass sie nicht als Deutsche auffiel. Täglich besuchte sie die Sprachschule, um jeden Rest eines Akzents abzustreifen.
Eine Französin hätte Kaffee getrunken, dachte sie melancholisch und stand auf. Der Kellner nickte ihr zu, während sie sich zwischen den Gästen hindurchschlängelte, die die viel zu kleinen, viel zu eng aufgestellten Tische umlagerten. Selbst wenn er ihr noch einen Gruß zugerufen hätte, wäre seine Stimme im Lärm der Menge untergegangen. Sophie erwiderte die Geste mit einem erzwungenen Lächeln und ging hinaus.
Obwohl die Tür des Cafés offen stand, war die Luft auf der Straße spürbar frischer. Regen hatte Hitze und Staub des hektischen Julitags in den Rinnstein gewaschen und davongeschwemmt. Fröstelnd sah Sophie auf. Ihr Blick glitt an den Fassaden der hohen, grauen Häuser empor, denen verschnörkelte, schmiedeeiserne Balkongeländer nur wenig von ihrer Strenge nahmen. Darüber gaben Dächer und Kamine die Sicht auf einen wolkenschwarzen Streifen Nachthimmel frei, aus dem noch immer vereinzelte Tropfen fielen. Nasses Laub glitzerte, wo der Schein der Straßenlaternen auf die Bäume traf, die den Boulevard Saint-Michel flankierten, doch jenseits des Lichts verschwammen die Blätter zu umso dunkleren Schattengebilden.
Sophie blinzelte erschreckt, als ein dicker, kalter Tropfen auf ihre Wange klatschte. Wie Tränen rann das versprengte Wasser hinab. Als ob sie nicht genug geweint hätte. Als ob sie jemals damit aufhören würde …
Neue Gäste, die auf die Tür des Cafés zusteuerten, starrten sie neugierig an. Errötend gab sie ihnen den Weg frei, so gut es zwischen den aufgestapelten Tischen und Stühlen ging. Was stehe ich auch so sinnlos hier herum?
Erneut fröstelnd zog sie ihre Jacke an und streifte die Kapuze über. Der schwarze Stoff beschirmte sie vor mitleidigen Blicken, sperrte Regen, erdrückende Häuserwände und finstere Baumwesen aus. Die Augen auf den glänzenden Asphalt gerichtet, schlug sie den Weg zur Seine ein. In der Sprachschule hatten andere Kursteilnehmer von einer Bar im Marais-Viertel geschwärmt, wo sie ihre Abende verbrachten. Vielleicht würde sie dort Tereza aus Prag oder die lustige Italienerin Francesca treffen – irgendjemanden, der sie eine Weile von dem Abgrund weglockte, an dem sie entlangbalancierte.
Sie musste den Blick nicht heben. Zur Brücke Saint-Michel ging es immer geradeaus. Gedankenverloren nahm sie die hinter einem mannshohen Gitterzaun und ein paar Bäumen versteckten Ruinen der römischen Thermen nur aus dem Augenwinkel wahr, bevor die klobigen Bordsteine sie ermahnten, den auch bei Nacht belebten Boulevard Saint-Germain nicht blindlings zu überqueren. Ab hier kannte sie sogar die Reihenfolge der Schaufenster und Straßenlokale auswendig, weil sie jeden Morgen auf dem Weg zur Métro an ihnen vorüberkam.
Sie hatte gehofft, dass die Sprachschule und die Suche nach einem Job sie von ihrer Trauer ablenken, dass sie ihr helfen würden, die Zeit mit Rafe zu vergessen und ein neues Leben anzufangen. Stattdessen fühlte sie sich einsamer denn je. Wie hätte sie ahnen sollen, dass so vieles in dieser Stadt sie an den einen kurzen Urlaub erinnerte, den sie hier mit ihm verbracht hatte? Sie hörte den Springbrunnen am Place Saint-Michel auf der anderen Straßenseite rauschen, und schon stieg das Foto aus ihrem Gedächtnis auf, das Rafe dort von ihr gemacht hatte.
Im Nachhinein betrachtet kam ihr das Bild beinahe prophetisch vor. So klein und verloren hatte sie zwischen den beiden geflügelten Drachen gestanden, die Wasser statt Feuer spien und gegen den schwertschwingenden Erzengel Michael in ihrer Mitte dennoch nur wie gehorsame Wachhunde wirkten. Hoch ragte der bronzene Streiter hinter ihnen auf, und Sophie fühlte sich wie die hingestreckte Gestalt zu seinen Füßen – von den Mächten des Schicksals geschlagen, besiegt und in den Staub geworfen. Was blieb ihr denn noch?, fragte sie sich, während sie über die Brücke zur Île de la Cité ging. Der Tod hatte ihr die Liebe ihres Lebens entrissen. Sie hatte Wohnung und Job in Stuttgart gekündigt, um nach der Hochzeit mit Rafe nach Hamburg zu ziehen. Nach der Hochzeit, die niemals stattgefunden hatte. Statt als Braut in Weiß vor den Altar zu treten, hatte sie in Schwarz vor einem Sarg gestanden, mit einem Rosenstrauß in der Hand.
Sophie kämpfte die aufsteigenden Tränen nieder. Was sollten Tereza und Francesca denken, wenn sie mit verheulten Augen in der Bar auftauchte? Die beiden nutzten ihren Fortbildungsurlaub, um sich kopfüber ins Pariser Nachtleben zu stürzen. Mit geröteten, von Müdigkeit umschatteten Augen saßen sie tagsüber in ihren Kursen und kämpften gegen die einschläfernde Wirkung von Monsieur Oliviers Stimme an, wenn er sich in ausufernden Reden über die wachsende Bedeutung der internationalen Finanzmärkte für die französische Wirtschaft verlor.
Sophie nahm an, dass die anderen auch sie für übernächtigt hielten, wenn sie blass und mit verquollenen Lidern in der Schule erschien. Sie wollte nicht mit Fremden über Rafael sprechen, die ihn nicht gekannt hatten und deshalb nicht ermessen konnten, was er ihr noch immer bedeutete. Das hatte sie in den letzten Wochen oft genug erlebt. Wenn die Leute peinlich berührt ihre Anteilnahme versicherten und hinterihrem Rücken mitleidig über sie flüsterten, fühlte sie sich nur noch schlechter.
„Merde!“
Der laute Fluch riss Sophie aus ihren Gedanken. Die Stimme ertönte hinter einem zerfledderten Schirm, der sich umso abenteuerlicher spreizte und verbog, je heftiger sein Besitzer darum kämpfte, ihn zu öffnen. Wie eine Fledermaus aus Draht und Polyester flatterte er an ihr vorüber. Erst jetzt bemerkte Sophie, dass der Regen wieder stärker geworden war. Die Tropfen landeten auf ihrer Kapuze, als würden sie anklopfen, bevor sie sich anschickten, durch den Stoff auf ihr Haar vorzudringen. Besorgt blickte sie auf. War es noch weit bis zur Rue Vieille du Temple? Sie sah sich um, doch die schmale Straße, der sie gefolgt war, ohne darüber nachzudenken, kam ihr nicht bekannt vor. Bars und Cafés, aus denen Musik und Stimmengewirr drangen, reihten sich aneinander, unterbrochen von Hauseingängen und den bunten Fassaden kleiner Geschäfte. Motorroller parkten auf den Gehsteigen, sodass es viele Passanten zu dieser Stunde vorzogen, in der Mitte der gepflasterten Gasse zu laufen. Im Licht der altmodischen Straßenlaternen eilten schrill gekleidete Gestalten lachend durch die Nacht. Andere, weniger auffällige Frauen und Männer hasteten an Sophie vorüber und hielten sich Zeitungen oder große Handtaschen über die Köpfe. Nur zwei junge Männer, die eng umschlungen neben dem Eingang eines Clubs standen, schienen sich nicht am Regen zu stören. Doch auch ohne die beiden hatte Sophie bemerkt, dass sie sich inzwischen im Marais befand, dem schillernden Viertel, das bei Lesben und Schwulen so beliebt war. Demnach hatte sie sich wenigstens nicht völlig verlaufen.
Schon an der nächsten Ecke erkannte sie einige Läden wieder und schlug erleichtert den Weg zur Rue Vieille du Temple ein. Es konnte nicht mehr weit sein. Wie hieß die Bar doch gleich? Les Etrangères? Les Equipages? Sophie beschleunigte ihre Schritte, bog in die von Boutiquen, Kunstgalerien und alten Geschäften gesäumte Straße ab und hielt nach dem hellen, schmalen Haus Ausschau, das Francesca ihr beschrieben hatte.
Les Étages. Natürlich! Tereza hatte doch erzählt, dass sich die Bar über drei Stockwerke erstreckte. Durch die offenen Türen fiel Licht und spiegelte sich schimmernd in den Pfützen auf dem Bürgersteig. Aus ihrem Blickwinkel konnte Sophie nicht sehen, was sich hinter den hohen Fenstern der oberen Etagen verbarg, aber sie war nicht neugierig. Seit Rafes Tod sah für sie eine Bar wie die andere aus.
Mit einem gemurmelten „Pardon“ drängte sie sich an einer Gruppe junger Leute vorbei, die angesichts des Regens zögerten hinauszugehen. Dahinter fand sie kaum mehr Platz, um die mittlerweile vollgesogene Jacke auszuziehen. Warme, parfüm- und schweißgesättigte Luft schlug ihr entgegen, vermengt mit dem Geruch von Wein, Gewürzen und Gebratenem. Cocktails fügten der Mischung süße und hochprozentigere Noten hinzu, während ein Tablett mit Tapas, das eine Kellnerin vor ihr hertrug, einen Hauch von Salz und Oliven verströmte. An den Tischen wurde lauthals erzählt, diskutiert, gelacht; Stimmen und Hintergrundmusik verbanden sich zu einem sinnentleerten Brabbeln und Lärmen. Sophie blendete es aus, während ihr Blick über die Gäste schweifte. Weit und breit war nichts von Francesca und Tereza zu sehen, also stieg sie die Treppe hinauf.
Auch dort ging es laut und fröhlich zu, obgleich das Lokal leerer wirkte als unten. Die Happy Hour war vorüber, aber für echte Nachtschwärmer mochte es noch zu früh sein, hoffte Sophie, als sie wieder kein bekanntes Gesicht entdeckte. Einige Gäste nahmen ihren suchenden Blick wahr und sahen fragend auf, bis sie merkten, dass Sophies Aufmerksamkeit nicht ihnen galt. Mit jedem Augenpaar, das sich abwandte, fühlte sie sich fremder und einsamer als zuvor, obwohl sie gar nicht angesprochen werden wollte.
Halbherzig setzte sie ihren Rundgang fort, doch auch in der obersten Etage hatte sie keinen Erfolg. Am liebsten wäre sie nach Hause gegangen, hätte sich wie so oft in ihrem kleinen Zimmer verkrochen und darauf gewartet, über bittersüßen Erinnerungen einzuschlafen. Aber dazu hätte sie sich aufraffen müssen, wieder in den Regen hinauszugehen. Vielleicht sollte sie doch lieber noch eine Weile auf ihre Freundinnen warten. Sie bestellte den angeblich legendären Erdbeer-Mojito, von dem Tereza geschwärmt hatte, und setzte sich an einen kleinen, freien Tisch, von dem aus sie die Treppe im Auge behalten konnte.
Sophie versuchte so zu wirken, als sei es für sie vollkommen selbstverständlich, spätabends allein in einer Bar zu sitzen und einen Cocktail zu schlürfen. Sie war sicher, dass es ihr gänzlich misslang. Immer wieder ertappte sie sich dabei, wie sie mit den Fingern ihr schulterlanges Haar auflockerte, das die feuchte Kapuze platt gedrückt hatte. Warum konnte sie nicht souverän und entrückt aussehen wie eine Hollywooddiva in einem tragischen Film?
Weil Tragik im wahren Leben nur verschmierte Mascara und die Ausstrahlung eines tristen Regentags bedeutet. Sie nippte an ihrem Drink und rührte mit dem Strohhalm im Eis herum. Die zuckrige Brühe klebte an den Zähnen, ganz gleich, wie oft sie mit der Zunge darüberfuhr. Dass sie dabei Lippen und Kinn verzog, wurde ihr erst bewusst, als sie sich plötzlich beobachtet fühlte. Überrascht sah sie auf, während ihr das Blut in die Wangen schoss. Ihr Blick kreuzte den eines Mannes, der mit dem Rücken zur Wand allein an einem Tisch saß. Leere Gläser deuteten an, dass er seinen Rotwein ursprünglich in Gesellschaft getrunken hatte, und Sophie wünschte augenblicklich, er wäre mit seinen Freunden verschwunden.
Reiß dich zusammen!, ermahnte sie sich. Der Fremde war nicht der erste und würde nicht der letzte Mann sein, der eine junge Frau musterte, die zufällig in derselben Bar saß. Sie musste nur demonstrativ wegsehen und alles unterlassen, was ihn ermutigen konnte, dann würde er sicher bald das Interesse verlieren.
Es kam ihr selbst übertrieben gleichgültig vor, wie sie sich abwandte, um wieder die Treppe ins Visier zu nehmen. Wo steckten die beiden Partylöwinnen nur, wenn man sie brauchte? Krampfhaft vermied sie, erneut in die Richtung des Fremden zu blicken. Schon der Gedanke an sein düsteres Gesicht ließ sie schaudern. Aber weshalb? An matt dunklem, bereits ergrauendem Haar, schlecht rasierten Wangen und dichten Augenbrauen allein war nichts Beunruhigendes. Dennoch meinte sie, seinen bohrenden Blick beinahe körperlich zu spüren. Fahrig zerpflückten ihre Finger die Minzblätter, die den Mojito dekorierten. Der frische Duft, den sie eigentlich liebte, verursachte ihr Übelkeit. Warum war sie nur in diese bescheuerte Bar gekommen? Sie hätte nach dem Abendessen heimgehen und für die Abschlussprüfung lernen sollen.
Verschwommen nahm sie aus dem Augenwinkel wahr, dass der Kerl sie noch immer anstarrte. Die dunkle, bedrohliche Seite der Stadt wurde ihr mit einem Mal wieder bewusst. Sie erinnerte sich an die Schreie, die sie eines Nachts durchs offene Fenster gehört hatte, an die hastigen Schritte und aufgebrachten Rufe. Kein Wort hatte sie verstanden, nur mit pochendem Herzen im Bett gesessen und in die anschließende Stille gelauscht. Sofern man in Paris je von Stille sprechen konnte …
Als die Runde am Nebentisch in Gelächter ausbrach, schreckte sie auf. Ungewollt flog ihr Blick zu dem Mann hinüber, der ihr so viel Furcht einjagte. Seine Augen waren unter den dunklen Brauen unverhohlen auf sie gerichtet, und das war beinahe schlimmer, als wenn er zu ihr gekommen und sie angesprochen hätte. Doch darauf schien er gar nicht aus zu sein. Sophie konnte förmlich vor sich sehen, wie er ihr schweigend folgen würde, sobald sie das Lokal verließ. Irgendwie musste sie ihn austricksen.
Abrupt stand sie auf, schnappte sich ihre Jacke und eilte zur Toilette. Vor dem Waschbecken warf sie einen Blick in den Spiegel. Sie war blass, aber die Angst hatte rote Flecken auf ihre Wangen getrieben. Die dunkelblonden Haare hingen in wirren Strähnen, die Augen wirkten in ihrem müden Gesicht zu groß. Sah so ein leichtes Opfer aus?
Sie atmete tief durch, zog die nasskalte Jacke an und die Kapuze über den Kopf. Als eine Frau hereinkam, verließ sie ihre fragwürdige Zuflucht. Schon zuvor hatte sie beschlossen, nicht mehr an ihren Tisch zurückzukehren. Stattdessen drückte sie einer verdutzten Kellnerin zehn Euro in die Hand. „Pour un mojito à la fraise.“
„Aber …“
„Stimmt so“, fiel sie ihr ins Wort und eilte zum Ausgang. Sie hoffte inständig, dass der unheimliche Kerl noch nichts ahnend im ersten Stock saß, wagte aber nicht, sich umzudrehen, um sich Gewissheit zu verschaffen. Jede Sekunde Vorsprung konnte entscheidend sein.
Draußen rannte sie, bis sie einige Passanten zwischen sich und Les Étages gebracht hatte. Hastig bog sie in die nächste Seitenstraße ab, stoppte und spähte an die Hauswand gelehnt um die Ecke, zur Bar zurück. Nichts. Misstrauisch musterte sie die Gestalten, die sich hinter hochgestellte Krägen und Schirme duckten, doch niemand kam ihr bekannt vor. Eine Frau, die sich bei ihrer Freundin oder Geliebten untergehakt hatte, warf ihr einen halb amüsierten, halb fragenden Blick zu. Sophie rang sich ein Lächeln ab und wich von der Wand zurück. Sie hatte sich den unangenehmen Beobachter nicht eingebildet. Wenn sie ihn durch ihren übereilten Aufbruch losgeworden war, umso besser.
Kopfschüttelnd ging sie weiter und hielt sich vage in Richtung Seine, die sie wieder überqueren musste, um nach Hause zu gelangen. Langsam beruhigte sich ihr Herzschlag. Sie drehte sich ein weiteres Mal um. Kein finsterer Blick, der sie verfolgte.
Der Regen war in ein kaum spürbares Nieseln übergegangen. Die Anspannung wich allmählich der trostlosen Leere, die seit Monaten ihr treuester Begleiter war – seit dem Anruf, der ihr Leben mit einem Schlag zertrümmert hatte. Das schwindende Adrenalin ließ sie müde und ausgelaugt zurück, und aus der klammen Jacke kroch Kälte unter ihre Haut. Ihr Mund war trocken, die Zähne von Zucker und Erdbeersaft pelzig. Ich bin ein Wrack. Was mache ich überhaupt hier? Ich sollte längst zu Hause sein.
Zu Hause. Paris war nicht ihr Zuhause. Auch die leere Wohnung in Stuttgart nicht. Es gab keinen Ort mehr, an den sie gehörte. Ihre Eltern mochten das anders sehen, aber was wussten sie schon? Sie verstanden nicht, dass ihre Heimat an Rafaels Seite gewesen war. Weder ein Zimmer in Stuttgart-Hedelfingen noch im Quartier Latin konnte das jemals ersetzen. Paris, die Lichter, die Gerüche aus den Bistros, das Johlen und Lachen, die verliebten Paare … ihr war, als könne sie das alles nicht länger ertragen. Hektische Dancefloorbeats aus einem Club, magenerschütternde Bässe durch die Scheiben eines vorbeifahrenden Autos, das fröhliche Trällern eines französischen Schlagersängers … Sie versuchte, nichts mehr zu hören, nichts mehr zu sehen, doch das war wohl nur den Toten vergönnt.
Klavierklänge schlichen sich beinahe unbemerkt in ihre Ohren, bevor sie ihre Schritte beschleunigte, um den folgenden Gitarrenriffs zu entkommen, die aus einer weiteren Bar dröhnten. Vom Ufer der Seine, wo tagsüber die letzten Vorbereitungen für die künstlichen Strände des Sommers im Gange waren, drangen afrikanische Trommelrhythmen durch die Bäume herauf. Sophie floh über die Pont Marie auf die Île Saint-Louis, die der einzige Ruhepol dieser vergnügungssüchtigen Stadt zu sein schien.
Endlich wurde es leiser um sie, und das gehetzte Gefühl fiel von ihr ab. Ihre Gedanken wirbelten noch immer haltlos umher, doch sie brüllten nicht mehr, um über den äußeren Lärm hinweg Gehör zu finden. Erneut perlte das Klavier hinein, dieses Mal aus ihrem Gedächtnis, eine melancholische Abfolge von vier Tönen. Die inneren Stimmen verstummten, die Töne wiederholten sich. Sie erinnerte sich an das Lied, die Melodie, hörte den Sänger säuseln. Baby, join me in death. Der Song war ein Ohrwurm gewesen. Sie hatte ihn gemocht, obwohl der Text sie irritiert hatte. Nun fiel er ihr nach und nach wieder ein. Mit jedem Schritt, den sie sich der Brücke auf der anderen Seite der Insel näherte, kehrten weitere Passagen zurück. This world is a cruel place. We’re here only to lose. Damals hatte sie es für übertrieben gehalten. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte noch nichts verloren.
Der Sänger, dessen Namen sie vergessen hatte, heulte Schmerz und Sehnsucht hinaus. Trog ihr Gedächtnis, oder sah er Rafael sogar ein wenig ähnlich? Nicht, dass Rafe je so ausgezehrt ausgesehen oder sich geschminkt hätte, aber entfernt …
Before life tears us apart, let death bless me with you. Wie hatte sie zulassen können, dass das Leben sie auseinanderriss? Warum war sie nicht mit ihm gestorben, als die tödlichen Kugeln getroffen hatten? Sie hatten sich versprochen, für immer zusammenzubleiben, und doch hatte sie ihn allein reisen lassen. Vielleicht wäre er noch am Leben, vielleicht hätte er mit ihr an jenem Tag eine andere Route genommen oder das abgelegene Dorf gar nicht erst verlassen. Vielleicht …
Sie trat aus dem Schatten der Häuser und überquerte die baumgesäumte Uferstraße. Jenseits der Brücke leuchteten ihr die Lichter des Quartier Latin entgegen, doch auf dieser Seite der Pont de la Tournelle war kaum etwas vom fernen Nachtleben zu hören. Dunkel und träge flossen die Wasser der Seine dahin, als ob auch sie nach Sonnenuntergang müde würden und Träumen von stillen Wäldern und Hügeln nachhingen. Das helle, nasse Gestein des Brückengeländers war kalt unter ihren Händen, doch sie spürte es kaum. Es kam nicht mehr darauf an. This life ain’t worth living. So won’t you die?
Schritte hinter ihr ließen ihren Atem stocken. Sie erstarrte, aber wer es auch war, ging nur vorüber. Die Schritte entfernten sich.
Sophie hob den Blick und sah die erleuchtete Stadt, die sich im Fluss spiegelte. Wie herrlich hatte sie das nächtliche Paris bei ihrem ersten Besuch empfunden. Doch damals war Rafe bei ihr gewesen. Jetzt ließ die Schönheit sie so kalt wie das Gestein unter ihren Fingern. Die Spitze des Eiffelturms war nur ein bedeutungsloses Relikt, die Notre-Dame irgendein Bauwerk aus längst vergangener Zeit. Wollte sie sterben? Baby, join me in death. Würde sie dann wieder mit Rafe vereint sein?
Sie starrte auf die angestrahlten Türme der Kathedrale. Gott schätzte Selbstmord nicht sonderlich. Trotzig reckte sie das Kinn. Es gab keinen Gott. Wenn es ihn gäbe, wie hätte er Rafes Tod zulassen können? Ausgerechnet Rafe, der allen immer nur hatte helfen wollen! Stolz hatte er ihr einst erzählt, dass Raphael Gott heilt bedeute und er deshalb zum Arzt berufen sei. Aber Gott hatte ihn nicht geheilt. Und er heilt mich nicht.
Bebend kletterte sie auf das breite Geländer, auf dem sie bei schönem Wetter bequem hätte sitzen und die Beine baumeln lassen können. Vorsichtig schob sie sich näher zum Rand. Jetzt, da nichts mehr zwischen ihr und den grauen Fluten tief unter ihr war, wurde ihr flau im Magen. Behutsam tastete sie mit den Füßen nach dem Sims am Fuß des Geländers und bekam weiche Knie, als der Untergrund unter ihrem Gewicht knirschte und ein wenig nachgab. Eine Metallleiste, die vermutlich irgendwelche Kabel abdeckte, nahm die Hälfte des schmalen Vorsprungs ein. Ängstlich verlagerte sie ihr Gewicht darauf, hielt sich jedoch weiter am Geländer fest. Leise schwappte das Wasser an den gemauerten Brückenpfeiler. Sie stellte sich vor, wie es ihre Kleider durchdringen und sie in die eisige Kälte des Todes hüllen würde.
Als das Stampfen eines großen Dieselmotors in ihr Bewusstsein drang, erwachte sie wie aus einem Traum. Nein! Panisch klammerten sich ihre Finger an die steinerne Kante. Um keinen Preis wollte sie mit gebrochenen Gliedern auf dem Deck eines Ausflugsbootes landen und von Touristen begafft werden, die ihr Bild mit Fotohandys um die Welt schickten.
Doch der Kiel, der seitlich und einige Meter tiefer in Sicht kam, gehörte zu keinem der modernen, fast gänzlich aus Glas bestehenden Schiffe, sondern zu einem älteren, dunkel gestrichenen Kahn, den der Besitzer zu einem schwimmenden Restaurant umgebaut hatte. Die Gäste blieben für Sophie unter dem Dach verborgen, doch durch die Fenster konnte sie Teile der sorgfältig gedeckten Tische sehen. Ihre Finger entspannten sich ein wenig. Sie musste nur noch warten, bis das Schiff ein Stück weg war. Niemand würde sie bemerken.
Schräg unter ihr kam endlich das Heck des Schiffs zum Vorschein. Instinktiv presste sich Sophie enger an das Geländer, als sie die drei Männer entdeckte, die auf einem freien Platz hinter den Aufbauten standen und miteinander sprachen. Das Dröhnen des Motors, das vom Brückenbogen widerhallte, übertönte ihre Stimmen. Einer der drei zückte ein Feuerzeug und zündete sich eine Zigarette an.
Sophies Herz setzte einen Schlag aus. Ungläubig starrte sie auf eines der Gesichter hinab, die im flackernden Lichtschein sichtbar geworden waren. Ihre Lippen bewegten sich, doch es kam kein Laut darüber, während das Boot auf die Durchfahrt zwischen der Île Saint-Louis und der Île de la Cité zuhielt. Als das Feuerzeug erlosch, senkte sich Dunkelheit über die Männer. Aus Sophies rauer Kehle löste sich ein Krächzen: „Rafe!“
Die Lähmung wich so plötzlich aus ihrem Körper, wie sie gekommen war. „Rafe!“, rief sie, dieses Mal lauter, doch es klang noch immer heiser und kläglich gegen das Tuckern des Motors und die zunehmende Entfernung.
Hastig drehte sie sich auf dem schmalen Sims um, schwankte, warf sich mit einem Aufschrei quer über das Geländer und schlang die Arme darum, um sich festzuklammern. Schneller! Das Schiff ist gleich weg! Die Gummisohle ihres Schuhs rutschte ab, als sie ihr Bein aufs Geländer hob.
Aufgeregte Stimmen und rasche Schritte kamen näher, aber Sophie hatte keine Zeit, auf Hilfe zu warten. Plötzlich fand sie doch noch Halt. Mit einer Kraft, die sie selbst verblüffte, zog und schob sie sich über den nassen Kalkstein, kam endlich auf der anderen Seite wieder auf die Füße und lief los, ohne sich nach den herbeigeeilten Leuten umzusehen. Erstaunte Ausrufe drangen an ihre Ohren, doch ihre ganze Aufmerksamkeit galt dem umgebauten Lastkahn, dem die Strömung zusätzlich Fahrt verlieh. Sie rannte die Kaimauer entlang, vorbei an Treppen, die zur Wasserlinie hinabführten, verfluchte im Stillen die Kronen der von dort aufragenden Bäume, weil sie ihr immer wieder die Sicht raubten.
Ihre Lungen begannen zu brennen. Ihr Herz raste. Wie oft hatte sie sich vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Ein gutes Stück vor ihr verschwand das Schiff unter der nächsten Brücke.
Sie hetzte weiter, hing einen Augenblick zwischen Stolpern und Fallen, als ihr eine Unebenheit im Pflaster einen Fuß wegzog. Eine unsichtbare Hand schien sie mit einem Ruck aufzurichten.
Eine Entschuldigung japsend, drängelte sie sich an einem Liebespaar vorbei und querte die Auffahrt zur Pont Saint-Louis, die die beiden Inseln miteinander verband. Vor ihr kam das nun in Dunkelheit gehüllte Heck wieder in Sicht, auf dem sich die drei Gestalten nur mehr erahnen ließen. Sie konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob es noch drei Männer waren.
Im Licht der Straßenlaternen entdeckte sie den mit Sitzbänken versehenen Aussichtspunkt, der das Ende der Île Saint-Louis markierte, und erkannte siedend heiß ihren Fehler. Um das Schiff weiter verfolgen zu können, hätte sie über die Brücke auf die Île de la Cité wechseln müssen. Auf zitternden Beinen kam sie hinter dem Bogen der Kaimauer zum Stehen. Ihr Atem pfiff, und das Herz hämmerte von innen gegen die Rippen wie eine Faust. Niemals hätte sie das Schiff wieder einholen können, selbst wenn sie die richtige Abzweigung genommen hätte. Keuchend beobachtete sie, wie es um die gegenüberliegende Insel bog und hinter der stählernen Pont d’Arcole entschwand.
Als sie sich die letzten ausgetretenen Stufen in den vierten Stock hinaufschleppte, konnte Sophie kaum mehr die Füße heben. Sie war so erschöpft, dass sie nur noch unter ihre Decken kriechen und die Augen schließen wollte. Hoffentlich schläft Madame Guimard schon. So leise wie möglich steckte sie den Schlüssel ins Schloss und öffnete die alte, mit Schnitzwerk verzierte Tür, die prompt in den Angeln quietschte. Das Parkett im hell erleuchteten Flur knarrte unter ihren Schritten, als biege es sich unter dem Gewicht eines Nilpferds. Sophie verdrehte die Augen. So viel zum unbemerkten Ins-Bett-Schleichen.
Es war nach Mitternacht, doch aus dem Wohnzimmer, das Madame Guimard ihren Salon nannte, drang gedämpfte klassische Musik. Jeden Abend hörte die alte Dame ihre beinahe ebenso betagten Schallplatten, deren vergilbte, abgegriffene Hüllen kaum noch verrieten, um welche Komponisten oder Werke es sich handelte. Sophie schälte sich vor der Garderobe aus ihrer nassen Jacke und zerrte ihre Füße aus den Sneakern, ohne die Schnürsenkel zu öffnen. Sie fürchtete, vor Entkräftung umzufallen, wenn sie sich bückte.
„Dank des Regens kommt heute Abend eine herrliche Luft herein“, ließ sich Madame Guimard durch die angelehnte Tür vernehmen.
Sophie seufzte im Stillen. Ihre Vermieterin hätte sich niemals aufgedrängt, indem sie ihr im Flur auflauerte, um sie nach ihrem Tag zu fragen, doch mit ihren subtileren Mitteln erreichte sie denselben Effekt. Da die Höflichkeit gebot, sie nicht zu ignorieren, rang sich Sophie ein Lächeln ab und betrat den Salon. „Bonsoir, Madame.“
Im ersten Moment sah sie nur, was das einfallende Flurlicht beleuchtete. Jenseits dieses hellen Ausschnitts lag der Raum in Dunkelheit.
„Lehn die Tür wieder an, Mädchen. Du lockst mir die Motten herein.“
Insgeheim seufzte Sophie ein zweites Mal und befolgte die Anweisung. Ich hätte einfach „Gute Nacht“ sagen und vorbeigehen sollen, bedauerte sie, doch sie war so müde, dass ihr die Kraft für so entschlossenes Handeln fehlte.
Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das Zwielicht der zwei Stockwerke tiefer leuchtenden Straßenlaternen. Sie konnte die hohe Stuckdecke über sich erahnen und die Umrisse der Möbel vor den mit Stoff tapezierten Wänden. Nippes und Fotorahmen spiegelten das wenige Licht. Madame Guimard saß auf einem ihrer samtbezogenen Sessel am offenen Fenster, das bis zum Boden reichte und mit einer Brüstung aus verschlungenem schwarzem Eisengitter gesichert war. Gegen die kühle Nachtluft hatte sie eine Ajour-Strickjacke übergezogen und hielt sich Tee auf einem Stövchen warm. „Setz dich doch!“ Einladend wies sie auf den Sessel jenseits des kleinen Beistelltischs. „Hattest du …“ Sie unterbrach sich selbst, als Sophie näher kam, und hob überrascht die perfekt gezupften, dezent nachgezogenen Brauen. „Setz dich!“, wiederholte sie, bevor sie aufstand. Für eine alte Frau war sie schlank und hielt sich noch sehr gerade.
Steif nahm Sophie auf dem Sessel Platz, dessen Federn sich bereits spürbar durch das Polster drückten. In dieser Wohnung gab es wenig, das nicht seit mindestens dreißig Jahren in Gebrauch war.
Madame Guimard brachte aus einem Vitrinenschrank ein weiteres Teegedeck aus hauchdünnem Porzellan zum Vorschein und stellte es vor Sophie ab, um ihr einzuschenken. „Trink das, Mädchen, und nimm reichlich Milch dazu!“
Sophie griff nach dem Kännchen, während sich die alte Dame wieder auf ihrem Sessel niederließ. Verwundert über das einsetzende Schweigen gab sie einen großzügigen Schuss Milch in ihre Tasse und rührte um, doch Madame Guimard sah wieder aus dem Fenster. Ein wenig enttäuscht nippte Sophie an ihrem Tee. Interessierte es Madame Guimard überhaupt nicht, was sie so aufgewühlt hatte, dass man es ihr selbst in diesem Dämmerlicht ansah? Aber vielleicht wollte sie einfach nur diskret sein. Es ist besser so. Sie würde mir ohnehin nicht glauben. Niemand würde das. Sie wusste nicht einmal, ob sie es selbst glauben sollte. Wieder sah sie das Gesicht im Schein der Feuerzeugflamme, und die Sehnsucht schnürte ihr die Brust zusammen.
Müdigkeit und die Wärme des Tees lullten sie ein. Eine Weile schwelgte sie zu den leisen Streicherklängen in Erinnerungen an Rafaels Lächeln. Wie schön es wäre, es nur einmal wiederzusehen. Der Mann auf dem Schiff hatte nicht gelächelt, aber wenn es Rafael war, würde er es bei ihrem Anblick sicherlich tun. „Ich habe meinen Verlobten gesehen“, sagte sie wie zu sich selbst.
Erneut hob Madame Guimard die Brauen. „Deinen Verlobten? Sagtest du nicht, er sei gestorben?“
Sophie zuckte beim letzten Wort innerlich zusammen. „Ja.“ Unwillkürlich richtete sie sich auf. „Aber ich habe ihn gesehen! Gerade eben! Als ich auf der Pont de la Tournelle stand.“ Die Erinnerung an ihren Wunsch, sich in die Seine zu stürzen, ließ sie einen Moment lang verstummen. „Er war auf einem Schiff, das unter mir vorüberfuhr.“
Madame Guimard sah sie einen Augenblick zweifelnd an, dann mischten sich Besorgnis und Mitleid in ihren Zügen. „Sophie.“
Der zugleich mitfühlende und ermahnende Tonfall versetzte Sophie einen Stich.
„Wenn wir geliebte Menschen verlieren, glaubt unser Herz ständig, sie in fremden Gesichtern wiederzuerkennen, weil wir sie uns so sehr zurückwünschen. Eine gewisse Ähnlichkeit genügt, und schon lassen wir uns nur zu gern täuschen.“
Nein, nein, nein, nein, nein. „Ich habe ihn gesehen. Ich konnte sein Gesicht genau erkennen.“
„Sophie.“ Die Stimme klang ein wenig strenger. „Es war dunkel. Licht und Schatten spielen uns bei Nacht seltsame Streiche. Wie viele Meter war der Mann von dir entfernt? Zehn? Fünfzehn? Dein Wunsch hat dir vorgegaukelt, was du sehen wolltest.“
Trotzig schüttelte Sophie den Kopf, doch sie wusste nichts zu erwidern. Sie selbst hätte einer Freundin in der gleichen Situation nichts anderes erzählt. Aber ich weiß, was ich gesehen habe.
„Schlaf erst einmal darüber, Mädchen. Viele Männer sehen bei Tageslicht ganz anders aus als in der Nacht zuvor.“
Der kleine Hund lag zusammengerollt auf einem fleckigen Stück Karton, das unter seinem schlafenden Herrchen hervorragte, und hatte die Schnauze mit seinem struppigen Schwanz bedeckt wie ein Husky im arktischen Winter. Mit seinen fest geschlossenen Augen schien er in der morgendlichen Hektik am Boulevard Saint-Michel so entrückt, als stamme er aus einer anderen Welt, einer Paralleldimension zu Paris, in der es weder stinkende Dieselmotoren und fluchende LKW-Fahrer noch gehetzte Gesichter und rasende Motorräder gab. Sophies Herz flog ihm zu, während der Anblick des gesichtslosen Menschenbündels neben ihm eher vages Entsetzen in ihr hervorrief. Sie wusste nicht, was sie von den Clochards halten sollte, die erschreckend zahlreich am Spülsaum der täglichen Menschenströme lagen und in ihrer komatösen Reglosigkeit an Leichen erinnerten.
Schaudernd schüttelte Sophie das Bild des niedergeschossenen Rafaels ab, das sich ihr plötzlich aufdrängte. Es war ein Phantasiegebilde. Sie hatte nie ein Foto vom Tatort gesehen, geschweige denn Rafes Leichnam. Schon den geschlossenen Sarg vor sich zu haben und ihn sich darin vorzustellen, hatte sie bei der Trauerfeier schier zerrissen. Das laute Schluchzen war ihrer Mutter peinlich gewesen. Anfangs wäre sie selbst am liebsten vor Scham im Boden versunken, denn sie scheute davor zurück, in der Öffentlichkeit hemmungslos Gefühle zu zeigen. Doch je mehr sie versucht hatte, das Schluchzen zu unterdrücken, desto heftiger hatte es ihren Körper gebeutelt, bis es ihr vollkommen gleichgültig gewesen war, was irgendjemand über sie denken mochte.
Sophie würgte den Klumpen zurück, den die Erinnerung in ihre Kehle drückte. Das gestern Abend könnte alles verändern, dachte sie, während sie sich an einen freien Tisch vor einer Bäckerei setzte, die zugleich ein Café betrieb. Als sie Kaffee und ein Croissant bestellte, klang ihre Stimme gepresst, aber das hätte ebenso gut daran liegen können, dass sie übernächtigt war. Madame Guimard hatte noch geschlafen, als Sophie aufgestanden war, um rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. Zumindest hatte sie hinter der geschlossenen Schlafzimmertür keinen Laut gehört und es nicht über sich gebracht, die alte Frau durch das Fauchen und Gluckern der Kaffeemaschine und klapperndes Geschirr zu wecken. Nein, wenn sie ehrlich war, hatte sie ihr nicht begegnen wollen. Sie hätte doch nur wieder versucht, ihr auszureden, was sie gesehen hatte.
Auf der Straße hatte sie dieselbe Stimmung wie jeden Morgen erwartet. Nur noch ein paar Pfützen erinnerten an den Regen der vergangenen Nacht. Die Sonne hatte die letzten Wolken vertrieben, und vor dem Café kehrte ein Straßenfeger die letzten Reste des Gestern in den absichtlich gefluteten Rinnstein, wo sie davongespült wurden. Sie gestand sich widerwillig ein, dass Madame Guimard recht behalten hatte. Was ihr am Abend zuvor Gewissheit gewesen war, verblasste im Morgenlicht zu einem fernen Traum. Hatte sie wirklich Rafaels Gesicht gesehen? Wie sollte das möglich sein? Er war tot!
Sie hatte – umringt von seinen trauernden Eltern und Geschwistern – am Familiengrab in Marburg gestanden, seiner Heimatstadt. In goldenen Lettern prangten Name, Geburts- und Sterbedatum auf dem alten Grabstein. Sogar eine Kopie der Sterbeurkunde hatte sie bekommen, um problemlos Dinge wie die gemeinsame Wohnung und den Telefonanschluss kündigen zu können, die auf Rafaels Namen gelaufen waren. Sollte das alles eine Inszenierung gewesen sein?
Aber die Fassungslosigkeit seiner Verwandten, die Verzweiflung der Mutter, all das hatte schmerzhaft echt gewirkt. Sie konnte nicht glauben, dass eine ganze Familie in der Lage sein sollte, so überzeugend Gefühle zu heucheln. Nein, wenn Rafael tatsächlich noch lebte, hatte er sie alle hinters Licht geführt. Rafe? Die ehrlichste Haut, die sie kannte, sollte den eigenen Tod vorgespielt haben? Die Vorstellung war so absurd, dass sie den Kopf schüttelte. Rafe hatte sogar protestiert, wenn ihm die Kassiererin im Supermarkt zu viel Wechselgeld gegeben hatte.
Ihr Blick fiel auf die Uhr an ihrem Handgelenk. O Gott! Vor Schreck verschluckte sie sich am blättrigen Croissant. Rasch zahlte sie, stürzte nebenbei den letzten Schluck Kaffee hinunter und eilte zur Métro-Station. Noch nie hatte sie auf den Treppen gedrängelt, sich stattdessen immer über die Leute aufgeregt, die sich rücksichtslos einen Weg durch die Menge bahnten. Nun hastete sie durch die weiß gekachelten Gänge und konnte gar nicht so oft „Pardon“ rufen, wie sie jemanden anrempelte, nur um auf dem Bahnsteig festzustellen, dass es noch drei Minuten dauerte, bis der nächste Zug kam.
Beschämt und atemlos versuchte sie, mit ihrer Umgebung zu verschmelzen, und hoffte, dass niemand sie wiedererkennen und für blaue Flecken beschimpfen würde. Obwohl sie schon seit über einer Woche in Paris war, konnte sie noch immer darüber staunen, wie viele Kulturen sich hier vermischten. Zu ihrer Linken plauderten zwei stämmige Afrikanerinnen in weiten, bunten Gewändern, während zu ihrer Rechten ein Geschäftsmann in Anzug und Krawatte mit gerunzelter Stirn auf das Display seines Handys starrte. Ein paar amerikanische Touristen diskutierten lautstark, ob dies die richtige Métro nach Montmartre sei, ein Moslem in weißem Kaftan kratzte sich das bärtige Kinn, und zwischen den unauffälligen gewöhnlichen Pendlern schob sich eine bettelnde alte Rumänin hindurch, die in ihren langen Röcken und dem Kopftuch wie eine Wahrsagerin aussah. Sophie flüchtete vor ihr in die endlich eingetroffene Bahn. Natürlich wusste sie, dass diese Frauen das Jammern zur Kunstform erhoben hatten, um arglosen Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen, aber es fiel ihr dennoch jedes Mal schwer, sie abzuwehren.
Eingeklemmt zwischen den vielen Menschen, umklammerte Sophie eine Haltestange und versuchte, die stickige, schweiß- und kreuzkümmelgeschwängerte Luft auszublenden. Ihre Gedanken kehrten zu dem Gesicht im Feuerschein zurück. Konnte Rafes Tod ein Irrtum gewesen sein? Hatte man eine fremde Leiche mit ihm verwechselt, während er von den Rebellen verschleppt worden war? In den Nachrichten hörte man oft genug, dass in Kolumbien Ausländer entführt wurden. Fragte sich nur, warum sie dann nie eine Lösegeldforderung gestellt hatten. Vielleicht weil die kolumbianischen Behörden ihren Fehler vertuschen wollten? Aber weshalb hatte sich Rafe dann nach seiner Befreiung – oder gar einer dramatischen Flucht! – nicht bei ihr gemeldet und trieb sich stattdessen in Paris herum? Wilde Szenarien aus Hollywoodfilmen wirbelten ihr durch den Kopf. Wenn jemand meine Gedanken lesen könnte, würde er mich für völlig durchgeknallt halten.
Mechanisch stieg sie aus und ließ sich von der Menge durch die weißen Röhren zu ihrer Anschlussmétro treiben. War es überhaupt denkbar, dass man ihnen eine falsche Leiche untergeschoben hatte? Rebecca, Rafes ältere Schwester, war extra nach Bogotá geflogen, um ihn zu identifizieren.
Sophie kramte das Handy aus ihrer Umhängetasche. Sie musste sichergehen, dass ein Irrtum ausgeschlossen war. Aber wie sollte sie es Rebecca erklären? Rasch drückte sie auf die Taste mit dem altmodischen Telefonhörer, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Nach einigem Läuten meldete sich eine übertrieben freundliche Stimme: „Sie sind verbunden mit der Mailbox …“
Enttäuscht ließ Sophie das Handy sinken. Sie war zu aufgewühlt, um eine beiläufig klingende Nachricht herauszubringen, und wollte Rebecca nicht beunruhigen. Vermutlich stand sie gerade in irgendeinem OP oder lag nach einer 24-Stunden-Schicht im Tiefschlaf. Für Assistenzärzte gab es eine Menge Gründe, das Handy abzuschalten. Sie konnte nur hoffen, dass Rebecca den entgangenen Anruf irgendwann entdecken und sich bei ihr melden würde.
Den ganzen Vormittag hindurch schweiften Sophies Gedanken immer wieder vom Unterricht ab. Im Vortrag zum französischen Handelsrecht vergaß sie, sich Notizen zu machen. Die Korrekturen im Sprachlabor wiederholte sie wie ein Automat, und im Konversationskurs war sie so abwesend, dass Francesca ihr unterm Tisch einen Wecktritt verpassen musste, als der Lehrer sie nach ihrer Meinung fragte. Dabei drehten sich ihre Überlegungen ständig im Kreis. Die einfachste Erklärung war, dass irgendein Fremder Rafael zum Verwechseln ähnlich sah. Doch so einleuchtend diese Antwort auch war, alles in Sophie sträubte sich, sie zu akzeptieren. Solange auch nur eine winzige Chance bestand, dass sie den echten Rafe gesehen hatte, würde sie nicht so tun können, als sei nichts geschehen.
In der Mittagspause setzte sie sich von den anderen ab, holte sich eine der kleineren, belegten Baguettevariationen, die es an jeder Ecke zu kaufen gab, und setzte sich auf eine Parkbank am Palais Royal. Tauben trippelten zu ihren Füßen, um die Krümel aufzupicken. Wieder und wieder spielte Sophie die Szenarien durch, die Rafe möglicherweise aus Deutschland ferngehalten hatten. Sie kannte ihn – wenn er wirklich noch lebte, musste er sich bewusst dafür entschieden haben, unterzutauchen. Und niemals hätte er ihr und seiner Familie so viel Leid zugefügt ohne einen verdammt triftigen Grund. Vielleicht will er uns schützen. Vielleicht hat er sich mit Drogenkartellen angelegt und will uns nicht in Gefahr bringen. Ein selbstloser Kreuzzug gegen Drogenbosse, ja, das würde zu dem Rafael passen, den sie kannte. Aber er war weder Ermittler noch Geheimagent, sondern angehender Arzt …
Sophie erschrak, als ihr Handy klingelte. Beinahe hätte sie das Brot fallen gelassen. Rasch bettete sie es auf der Serviette neben sich auf die Bank, riss die Tasche auf und das Handy ans Ohr. „Ja, hallo?“
„Sophie? Stör ich gerade? Du hörst dich gehetzt an.“ Rebeccas Stimme klang blechern, als werde sie direkt aus der Raumstation ISS übertragen.
„Nein, alles bestens. Ich sitze im Garten des Palais Royal beim Mittagessen.“
„Ach, stimmt ja!“, rief Rafes Schwester überrascht aus. „Du bist in Paris. Da wär ich jetzt auch gern. Auf unserer Station ist wieder die Hölle los, aber davon hab ich dir ja schon oft genug vorgejammert. Wolltest du nur mal hören, wie’s mir so geht, oder hast du aus einem bestimmten Grund angerufen?“
Sofort regte sich Sophies schlechtes Gewissen, weil sie sich so lange nicht bei Rebecca gemeldet hatte. Einen Bruder zu verlieren, war schließlich auch ein schwerer Schlag. „Ich … wollte mit dir reden. Hier in Paris kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, dass Rafe tot sein soll. Ich …“ Mein Gott, wie verpacke ich es? „Ich glaube, es liegt daran, dass ich ihn nie tot gesehen habe. Verstehst du? Es ist, als könne er hier jeden Augenblick um die Ecke kommen.“
Einen Moment lang herrschte Schweigen im All. Sophie bildete sich ein, Rebecca schwer durchatmen zu hören.
„Das … tut mir leid, Sophie“, brachte sie dann heraus. „Ich hatte gehofft, Paris würde dich ablenken. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn ich bei unseren Eltern in Marburg bin, erwarte ich auch jedes Mal, dass er plötzlich wie immer zur Tür hereinkommt. Es dauert wohl eine Weile, bis man das kapiert.“
Ja. Sophie nickte versonnen, obwohl Rebecca es nicht sehen konnte. „Aber … du hast keine Zweifel daran, dass er gestorben ist, oder?“ Es musste bescheuert klingen, doch wenn sie jetzt nicht fragte, würde sie sich nie mehr trauen. „Als du ihn identifiziert hast, meine ich, warst du da absolut sicher, dass er es ist und nicht irgendein anderer, der ihm bloß ähnelt? Sah er aus wie immer?“
Rebecca seufzte. „Sophie, er ist tot. Sosehr wir beide ihn auch lieber lebendig haben wollen, wir können nichts daran ändern.“
Erneut wallte Trotz in Sophie auf. „Du hast meine Frage nicht beantwortet.“
„Weil ich dir die Details ersparen will und weil es keine Rolle spielt.“
„Für mich spielt es eine sehr große Rolle! Ich muss es genau wissen.“
Wieder seufzte Rebecca. „Also schön, wie du willst. Nein, er sah nicht aus wie immer, weil sich Tote nun einmal verändern. Er sah hagerer aus, seine Haut war teils gelblich, teils bläulich verfärbt, die … Nein, das reicht jetzt. Ich bin Ärztin, Sophie, ich kann so etwas einordnen, du nicht. Was mich mehr verwirrt hat, war, dass er sich wohl seit seiner Ankunft nicht mehr rasiert hatte. Aber so ein Zehntagebart verfälscht keine DNA-Tests, glaub mir.“
Nein. Aber man kann DNA-Tests manipulieren.
Was Rebecca gesagt hatte, ging Sophie nicht mehr aus dem Kopf.
„Une affaire d’amour?“, neckte Francesca sie und gab es auf, ihre Aufmerksamkeit auf den Unterricht lenken zu wollen.
Sophie nickte, aber sie war froh, dass Monsieur Oliviers Vortrag sie davor bewahrte, etwas erklären zu müssen. Francesca hätte sie wahrscheinlich für verrückt gehalten – très romantique, mais folle. Aber ich bin nicht verrückt. Es könnte wahr sein. Rafael hatte sich immer rasiert. Und selbst wenn das allein nicht verdächtig genug war, weil ein Bart hilfreich gegen Moskitos sein mochte, blieb immer noch die Tatsache, dass Rafe Rebecca nie mit mehr als den Stoppeln einer Nacht unter die Augen gekommen war. Was kaum zählte. Sie erinnerte sich an eine Begegnung mit Jürgen, einem früheren Arbeitskollegen, den sie einige Zeit nach seinem Abschied von der Firma zufällig auf der Straße getroffen hatte. Mit Schnurrbart und Koteletten hatte sie ihn zunächst gar nicht wiedererkannt. Also veränderte ein Bart das Gesicht so sehr, dass Rebecca nicht sicher sein konnte, welchen Toten man ihr gezeigt hatte.
Sophies Unruhe wuchs. Das war der Strohhalm, den sie ersehnt hatte. Der Vorwand, mit dem sie vor sich selbst rechtfertigen konnte, nach einem Mann zu suchen, der womöglich nur ein Phantom war.
Doch wie sollte sie Rafael in dieser Millionenstadt wiederfinden? Er würde ihr kaum ein zweites Mal zufällig über den Weg laufen. Sollte sie etwa überall Suchfotos mit ihrer Telefonnummer aufhängen wie bei einer entlaufenen Katze? Ein Anruf der Polizei gehörte dann wahrscheinlich noch zu den harmloseren Reaktionen. Außerdem wusste sie immer noch nicht, warum er untergetaucht war. Womöglich brachte sie ihn in Gefahr, wenn sie die Aufmerksamkeit der falschen Leute auf ihn lenkte. Sie musste behutsamer vorgehen. Seiner Spur folgen. Das Schiff! Sie musste dieses Schiff finden.
Auf der Heimfahrt wäre sie am liebsten schon an der Station Châtelet aus der Métro nach oben geeilt, um am Seineufer rund um die Pont Neuf mit der Suche zu beginnen, denn dort lagen zahlreiche Touristenschiffe und Hausboote vertäut. Doch stattdessen musste sie in Richtung Saint-Michel umsteigen, weil Madame Guimard sie erwartete. Den ganzen Weg von der Métro nach Hause fragte sie sich, wie sie der alten Dame eine Absage erteilen konnte, ohne sie zu verärgern. Es war ihr bereits aufgefallen, dass Madame Guimard selten ausging. Die vielen Treppenstufen hielten sie wohl davon ab, ihre Wohnung öfter zu verlassen, vermutete Sophie, während sie den Briefkasten leerte. Madame Guimard ließ sich sogar die Einkäufe liefern, und vielleicht vermietete sie auch das ungenutzte Zimmer nur, um ein bisschen Gesellschaft zu haben. Abgesehen von einer Nichte, mit der sie einmal zwei Stunden lang in einem Raum verschwunden war, den Sophie noch nicht von innen gesehen hatte, erhielt sie anscheinend auch keinen Besuch.
Und ich will die arme Frau an einem Freitagabend allein sitzen lassen … Bis sie sich die Treppen hinaufgekämpft hatte, war ihr schlechtes Gewissen schon so groß, dass ihre Entschlossenheit wankte.
„Ah, da bist du ja“, rief Madame Guimard, die gerade aus der Küche kam. Der Geruch ihres Nachmittagstees hing noch in der Luft. „Du wirst dich sicher frisch machen wollen und etwas Passenderes anziehen“, fügte sie mit einem strengen Blick auf die Jeans und das bunt bedruckte T-Shirt hinzu.
Überrascht sah Sophie an sich hinab. Eigentlich wollte sie nur ihre Jacke holen und wieder an die Seine verschwinden. „Ähm, ja, aber …“
„Da gibt es kein Aber“, fiel Madame Guimard ihr ins Wort. „So geht man nicht ins Procope.“
„Ins Procope? “, wiederholte Sophie überrascht. Einst hatte sie mit Rafael einen Blick auf die Speisekarte des ältesten Kaffeehauses von Paris geworfen und es für zu teuer befunden. Natürlich beleidigte man dieses Lokal nicht mit unpassender Garderobe, schon gar nicht am Abend. „Aber …“
„Ich will diesen Unsinn vom Bruch mit der Tradition nicht hören! Auch wenn es jetzt als Restaurant geführt wird, ist es immer noch das Procope“, ereiferte sich Madame Guimard. „Ich gehe jeden Freitagabend dort essen. Es gibt ausgezeichneten Fisch.“
Sophie schüttelte verwirrt den Kopf. „Nein, nein, darum geht es nicht. Das Essen ist bestimmt sehr gut. Ich wollte nur fragen, ob wir unsere Verabredung vielleicht auf einen anderen Tag verschieben können.“
Madame Guimard verschränkte die Arme vor der Brust. „Nein. Das wäre äußerst unhöflich gegenüber Madame Clément, denn sie hat sich deinetwegen den Abend freigehalten und uns einen Tisch reserviert.“
Was hatte das nun wieder zu bedeuten? Meinte sie etwa die Kellnerin? Doch die würde sich kaum den Abend freihalten, um sie zu bedienen. „Wer ist Madame Clément?“
Unsicherheit schlich sich in Madame Guimards missbilligende Züge. „Habe ich dir etwa nicht erzählt, dass ich mit ihr telefoniert habe?“
„Nein, mit wem?“
„Das musst du vergessen haben. Ich weiß genau, dass ich es dir erzählt habe.“
Eine Frage des Stolzes, schätzte Sophie und zuckte lächelnd die Achseln, als könne sie die Möglichkeit nicht ausschließen. Sie hatte bei ihrer Großmutter gelernt, dass Widerspruch in solchen Fällen zwecklos war. „Ich kann mich nicht daran erinnern.“
Madame Guimard nickte zufrieden. „Madame Clément ist die Tochter einer alten Kundin. Ihre Mutter kommt heute noch manchmal in den Laden und lässt sich etwas anfertigen.“
Sie hat einen Laden? Sophie war zu verblüfft, um nachzuhaken.
„Sie stammen aus einer guten Familie“, fuhr Madame Guimard fort. „Nicht übermäßig reich, aber wohlhabend. Der Großvater gründete eine Firma, um Wein zu exportieren. Mittlerweile sind sie zu einem großen Unternehmen gewachsen, aber das kann Madame Clément dir besser erklären. Ich dachte nur, du solltest sie kennenlernen, weil du eine Stelle im internationalen Handel suchst.“
„Oh, das …“ Sophie fehlten die Worte. Eine alte Dame, die sie erst seit acht Tagen kannte, sorgte sich um ihre Zukunft, während sie den Schatten der Vergangenheit nachjagte. Beschämt lächelte sie.
O Gott! Ich habe verschlafen! Mit einem Ruck setzte sie sich auf. Sie hatte vergessen, die Fensterläden zu schließen, doch darüber war sie jetzt froh. Die Morgensonne spiegelte sich blendend hell auf den Glaseinsätzen der alten, dunklen Kleiderschranktüren und hatte sie geweckt. Draußen brummte bereits der Verkehr, und die Müllabfuhr polterte mit den Tonnen. Es kam Sophie vor, als würden sie hier täglich geleert. Außer sonntags vielleicht. Sie stutzte, dann sank sie erleichtert auf ihr Kopfkissen zurück. Es war Samstag. Niemand erwartete sie zum Unterricht.
Seufzend kuschelte sie sich wieder in das Laken, das die kratzige Wolldecke von ihrer Haut fernhielt. Sie hatte von Rafael geträumt, dessen war sie sicher, obwohl die Erinnerung an Einzelheiten mit dem Schreck zerstoben war. Vielleicht konnte sie die Bilder erneut heraufbeschwören, wenn sie die Augen schloss. Doch stattdessen sah sie Madame Guimard und Madame Clément am aufwendig gedeckten Tisch im Le Procope sitzen. Der mondänen Einrichtung mit den vielen Spiegeln, Lüstern und in Gold gerahmten Porträts der berühmten Philosophen, die einst dort debattiert hatten, haftete noch der Glanz vergangener Jahrhunderte an. Madame Guimard hatte ein Kostüm getragen, das Sophie an Fotos von Jackie Onassis erinnert hatte, und auch wenn es ebenso alt sein mochte, war es immer noch schick. Die kinnlangen, graublonden Haare perfekt frisiert und das strenge Gesicht dezent geschminkt, hatte sie den Inbegriff einer alten Dame von Welt verkörpert. Auch Madame Clément war in einem wie maßgeschneidert wirkenden Kostüm erschienen, und Sophie fragte sich noch immer, wie es die Französinnen schafften, stets kultiviert auszusehen und trotz des guten Essens schlank zu bleiben. Es war so unfair, dass es nur in den Genen liegen konnte. Neben Madame Clément, die sie auf etwa vierzig Jahre schätzte, und Madame Guimard hatte sie sich wie das hässliche junge Entlein gefühlt, dem erst noch das schöne Gefieder wachsen musste. Dabei hatte sie ihr bestes Sommerkleid getragen und ihr Haar auf Hochglanz gebürstet.
Durch den Türspalt stieg ihr Kaffeeduft in die Nase. Schluss mit der Träumerei! Rafe war irgendwo dort draußen.
Sie schlug die Decke zurück und schwang die Beine aus dem Bett. Ihre Gedanken eilten an die Seine voraus. Den ganzen Tag würde sie Zeit haben, um sämtliche Kais abzulaufen, und wenn das nicht genügte, blieb noch der Sonntag. Falls es schlecht lief, wäre sie viele Stunden unterwegs. Bequeme Schuhe waren Pflicht.
Sie griff nach ihrem Handy, das ausgeschaltet auf dem Nachttisch lag, wobei ihr Blick auf das kleine Blatt Papier darunter fiel. „AKKU LADEN!“ stand in dicken roten Lettern darauf. Zettel! Genau! Daran wollte ich mich erinnern. Madame Clément hatte sie für den kommenden Donnerstag, 15.00 Uhr, zu einem Bewerbungsgespräch in ihre Firma eingeladen. Das durfte sie auf keinen Fall vergessen. Sie riss ein Stück von einem Blatt ihres Schreibblocks ab und kritzelte Datum und Uhrzeit darauf. Die Adresse konnte Madame Guimard ihr später geben.
Nachdem sie die Pin-Nummer eingegeben hatte, verkündete das Handy piepsend den Eingang einer SMS. Neugierig öffnete sie die Nachricht, während sie mit den Füßen nach ihren Pantoffeln fischte. Der Kaffeegeruch riss ein immer größeres Loch in ihren Magen. „Sorry, dass ich grob zu dir war“, schrieb Rebecca. „Rafes Tod ist auch für mich noch ein heikles Thema. Ich mach’s wieder gut! Becca.“
Sophie dachte immer noch über die drei Sätze nach, als sie zwei Tassen Kaffee und eine große Portion Brioche später die Treppen hinunterlief. Aber sosehr sie auch versuchte, verborgene Botschaften hineinzulesen, blieb es doch wahrscheinlicher, dass Rebecca ihren Bruder tatsächlich für tot hielt und sie lediglich auf ein Eis einladen wollte, anstatt ihr die Geschichte über Rafes waghalsige Flucht aus dem kolumbianischen Hinterland zu enthüllen. Es war an ihr, die Wahrheit herauszufinden.
Sie zog den Stadtplan aus der Tasche, um sich noch einmal den Weg anzuschauen. Die Route, zu der sie sich entschlossen hatte, war denkbar einfach, doch die genaue Lage der vielen Brücken rund um die Inseln war ihr noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie sich einzig auf ihren inneren Kompass verlassen wollte. Außer ein paar Schleiern, die sich allmählich auflösten, war keine Wolke am Himmel. Vom Boulevard Saint-Germain dröhnte ihr Verkehrslärm entgegen, und eine Umzugsspedition transportierte mit einer waghalsig hohen Kreuzung aus Aufzug und Feuerwehrleiter Möbel aus einer Dachwohnung fünf Stockwerke über ihr. Dieselabgase mischten sich mit dem köstlichen Duft aus der Bäckerei. Beiläufig nahm sie wahr, dass schon etliche Tische der Straßencafés besetzt waren. Der orientalische Ladenbesitzer an der Ecke füllte seine Auslagen mit frischem Obst auf, das dem Geruch seiner Gewürze eine fruchtige Note hinzufügte. Menschen hasteten oder schlenderten an ihr vorüber, während sie nur Augen für die Karte hatte.
Abrupt blieb sie stehen, faltete den Plan zusammen und stopfte ihn in die Tasche zurück. Wie konnte sie so dumm sein, nicht auf die Passanten zu achten? Wenn der Mann, den sie gesehen hatte, nicht Rafe war, sondern ihm nur zum Verwechseln ähnlich sah, hätte er schon ein Dutzend Mal an ihr vorbeilaufen können! Rasch blickte sie sich um und ging aufmerksamer weiter, sah jeden an, der ihr entgegenkam. Als sie an der Ampel stand, um den Boulevard zu überqueren, musterte sie die Wartenden auf der anderen Straßenseite und auch die Gäste des Bistros daneben. Sie versuchte sogar, einen Blick auf die Fahrer der vorbeikommenden Autos zu erhaschen, was hinter den spiegelnden Scheiben zwecklos war. Je mehr sie sich der Pont au Double näherte, die zur Notre-Dame hinüberführte, desto mehr Touristen mischten sich unter die Pariser und fügten der Vielfalt der Gesichter weitere asiatische und osteuropäische Züge hinzu.
Vor der Brücke führten zu beiden Seiten Stufen auf den Kai hinab. Sophie nahm die rechte Treppe, um die Schiffe abzuklappern, die gegenüber der im Sonnenschein leuchtenden Kathedrale vertäut lagen. Sie erinnerte sich genau, dort schwimmende Restaurants gesehen zu haben. Sicher lockte schon der Blick auf die mit Wasserspeiern und spitzen Türmchen, Rosettenfenstern und Heiligenstatuen geschmückte Längsseite der Notre-Dame viele Gäste an, und die malerisch zurechtgemachten Schiffe taten das Übrige. Liebevoll restauriert, mit Gardinen, Grünpflanzen und sogar Blumenkästen versehen, sah jedes auf seine Art einladend aus. Doch in keinem der drei, die an diesem Morgen am Port de Montebello lagen, erkannte Sophie das Boot wieder, auf dem sie Rafe gesehen hatte.
Enttäuscht ging sie auf dem baumgesäumten Kai weiter, ließ die aus mächtigen Mauern gebildete Spitze der Île de la Cité hinter sich und näherte sich der weißen, das Wasser in einem einzigen flachen Bogen überspannenden Brücke, von der sie sich beinahe in die Seine gestürzt hätte. Kein Schiff war hier zu sehen, nur draußen auf dem Fluss kämpfte sich eins der gläsernen Ausflugsboote gegen die Strömung voran. Ein Schatten, vielleicht der einer Möwe, glitt über sie hinweg. Das leere Ufer – trotz des schönen Wetters verirrten sich nur wenige Menschen hierher – begann, Sophie melancholisch zu stimmen. Auf die Dauer entpuppte es sich als anstrengend, Ausschau zu halten und so viele Passanten zu mustern. Ihre Aufmerksamkeit erlahmte, und sie ertappte sich dabei, ihren Gedanken nachzuhängen. War es nicht ohnehin sinnlos? So unwahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto? Traurigkeit wallte in ihr auf. Wieder sah sie sich über dem Wasser stehen, das dunkel und träge dahinfloss. Ich hätte springen sollen.
Verwundert schüttelte sie den Kopf. Woher kam nur auf einmal wieder diese Schwermut? Eben war sie doch noch voller Tatendrang gewesen, und nun ließ sie sich schon wieder hängen. Dabei hatte sie mit der Suche gerade erst angefangen.
Jemand beobachtete sie. Plötzlich wusste sie es, spürte den Blick wie ein Messer in ihrem Rücken. So unauffällig wie möglich drehte sie den Kopf, schielte nach hinten. Der Radfahrer, der ihr entgegengekommen war, verschwand Richtung Notre-Dame, ohne sich umzublicken. Ein Jogger näherte sich von dort, doch er hielt die Augen vor sich auf das Pflaster gerichtet und schien mehr mit seinem inneren Schweinehund als der Umgebung beschäftigt.
Sophie blickte wieder nach vorn. Zu ihrer Rechten ragte hinter den Bäumen die Mauer auf, an deren Fuß die Treppe zur Straße hinauf begann. Vor ihr mündete der Kai in einen schmalen Brückenbogen, hinter dem sie Teile eines weiteren Schiffs ausmachen konnte. Niemand war zu sehen, doch noch immer fühlte sie sich angestarrt. Nervös blieb sie stehen und kramte den Stadtplan hervor. Als müsse sie sich orientieren, drehte sie sich, sah ratlos die Promenade hinauf und hinunter. Wenn mich wirklich jemand beobachtet, muss er mich für dämlich halten. Entlang der Seine kann man sich wohl kaum verlaufen.
Gerade wollte sie die Augen wieder auf die Karte richten, als sie eine dunkle Gestalt entdeckte. Der Mann trat aus dem Schatten eines Baums und war für wenige Schritte gut im Sonnenlicht zu erkennen, bevor ihn der nächste Schatten verschluckte. Jetzt, da Sophie wusste, dass er dort war, konnte sie seine Silhouette gegen die hellen Pflastersteine sehen. Während sie hastig den Plan zusammenfaltete, zitterten ihre Finger. Sie behielt ihn in der Hand und eilte zur Treppe. Der Kerl trug eine Sonnenbrille, doch sie war sicher, dass es der Mann war, der sie schon im Les Étages angestarrt hatte.
Sie nahm zwei Stufen auf einmal, um einen größeren Vorsprung zu gewinnen, aber was sollte sie tun, sobald sie oben angekommen war? Am helllichten Tag würde der Mann kaum über sie herfallen. Die Uferstraße war belebt. Wenn sie dort oben blieb, hatte sie nichts zu befürchten. Keuchend erreichte sie die letzte Stufe. Links ragte die turmhohe Statue der heiligen Genoveva über dem Brückengeländer auf, als wolle sie jeden Schiffer zur Andacht ermahnen, der sich stromabwärts der Kathedrale näherte.
Sophie hielt an, um Atem zu schöpfen und eine Entscheidung zu treffen. Aus dem Augenwinkel sah sie den Unbekannten die unterste Stufe betreten.
Es ist albern, davonzurennen. Mir kann nichts passieren. Vielleicht bildete sie sich alles nur ein, und der Mann folgte ihr nicht einmal. Entschlossen wechselte sie die Straßenseite und schickte sich an, die Brücke zu überqueren. Von dort oben hatte sie einen guten Blick über die Schiffe jenseits der Pont de la Tournelle. Es handelte sich um kleine, teils zu Hausbooten umgebaute Lastkähne, doch der gesuchte war nicht darunter. Die aufkeimende Enttäuschung ging in ihrer Sorge unter, als sie entdeckte, dass der Fremde zwar auf der anderen Straßenseite geblieben war, aber ebenfalls den Weg auf die Île Saint-Louis eingeschlagen hatte. Erneut ermahnte sie sich, ruhig zu bleiben. Es konnte immer noch Zufall sein. Womöglich wohnte er in der Gegend oder hatte ein Hotelzimmer und war ein ebenso harmloser Spaziergänger wie sie.
Sie zwang sich, weiterzugehen, als gäbe es ihn nicht. Es war schwer, der Versuchung zu widerstehen, doch sie warf keinen Blick mehr über die Schulter, bis sie die Insel durchquert hatte und die Häuser wieder die Sicht auf die Seine freigaben. Zu beiden Seiten des Flusses war weit und breit kein Schiff zu entdecken. Stattdessen kündigten jenseits der Pont Marie blaue Banner und Sonnenschirme die baldige Eröffnung des Pariser Strandvergnügens an.
Sophie wünschte, sie hätte ihren Fotoapparat mitgenommen, denn die Kamera wäre ein guter Vorwand gewesen, um in der Gegend herumzuknipsen und dabei ihren Verfolger im Auge zu behalten. Es half nichts, sie musste wieder in seine Richtung schielen, während sie über die Brücke ging. Aber was verriet seine Anwesenheit schon, außer dass er auf dem Weg ins Marais war?
Von der Pont Marie aus erstreckte sich stromabwärts ein von Schiffen freies Ufer, so weit Sophie es trotz der vielen Brücken erkennen konnte. Obwohl nicht nur die Sonne und die Treppen sie ins Schwitzen gebracht hatten, dämmerte ihr, dass sie sich die Füße wund laufen würde, bevor sie die nächsten Anlegestellen zu Gesicht bekam – von ihrem geplanten Marsch bis zum Eiffelturm ganz zu schweigen. Gab es hier eine passende Métro-Verbindung oder einen Bus? Um ihren Vorsprung nicht einzubüßen, hantierte sie mit dem Stadtplan, ohne stehen zu bleiben, und stieß beinahe mit einer älteren Dame zusammen, deren Schoßhündchen sie dafür hysterisch ankläffte.
„Pardon“, murmelte Sophie in den verärgerten Wortschwall der Französin, der gleichermaßen ihr und dem Terrier zu gelten schien. Irgendwie gelang es ihr, um das Tier zu tänzeln, ohne die Karte völlig aus den Augen zu lassen. Auf dieser Seite der Pont Marie war tatsächlich eine Métro-Station eingezeichnet. Von dort konnte sie mit der Linie 7 nach Pont Neuf fahren und die Suche an der vielversprechendsten Stelle wieder aufnehmen. Jetzt musste nur noch dieser Typ ins Marais verschwinden.
Sie entdeckte das grün-weiße Métropolitain-Schild auf der anderen Straßenseite und ärgerte sich, als die Fußgängerampel ausgerechnet in diesem Moment auf Rot sprang. Wieder glaubte sie, den bohrenden Blick auf sich zu spüren, während sie inmitten einer gut gelaunten Gruppe deutscher Senioren warten musste, bis der Strom französischer Kleinwagen, röhrender Motorräder und bunter Lieferfahrzeuge aller Größen wieder zum Erliegen kam. Es war, als könne sie mit einem ihr bislang unbekannten Sinn wahrnehmen, wie der Mann hinter ihr näher kam. Jeden Augenblick würde sein Schatten neben ihr auftauchen, sein Atem ihren Nacken streifen.
Entsetzt fuhr sie herum und erntete einen Strauß fragender, nachsichtiger Blicke aus den Reihen der älteren Herrschaften hinter ihr. Der Unbekannte stand noch dort, wo das Brückengeländer auslief, doch die schwarzen Gläser waren direkt auf sie gerichtet. Kein Wunder. Alle glotzen mich an, weil ich mich so seltsam benehme, versuchte sie sich einzureden und wandte sich wieder der Ampel zu, die endlich Erbarmen zeigte. Nun würde sich erweisen, ob er ihr wirklich folgte.
Sophie sah absichtlich nicht zurück, bis sie den richtigen Bahnsteig erreicht hatte. Sie ging nicht weit, um Spielraum zu behalten, wollte ihn notfalls abhängen, indem sie schnell in einen anderen Waggon einstieg als er. Schließlich konnte er nicht wissen, wohin sie unterwegs war.
Nur zwei Minuten bis zum nächsten Zug. Ihr Blick wanderte zwischen der Anzeigetafel und dem Ausgang der Röhre, durch die sie gekommen war, hin und her. Bei jedem dunklen Schuh samt Hosenbein, die in Sicht kamen, zuckte sie zusammen, bis der Rest des Besitzers um die Ecke war. Ein Rauschen kündigte die nahende Bahn an. Die vornehmlich in Weiß und Pastellfarben gekleidete Seniorengruppe quoll aus dem Gang. Sophies Magen verkrampfte sich. Als ob der Sog der einfahrenden Métro sie ergriff, bewegte sie sich über den Bahnsteig, nur weg von der Stelle, an der in diesem Moment ihr Verfolger erschien. Sie schlängelte sich zwischen den Einsteigenden hindurch, drängelte sich immer noch eine Tür weiter, bis sie fürchtete, die Türen könnten schließen und sie allein mit dem Fremden zurücklassen.
Die Métro war voll, aber nicht überfüllt. Sophie konnte den ganzen Waggon überblicken. Es gab keine Sitzplätze mehr, und ein kleiner, milchkaffeefarbener Junge mit großen, dunklen Augen bettelte gestenreich. Seine Berührung war leicht wie die eines Schmetterlings, seine Stimme kaum zu hören. Sophie wehrte ihn schweren Herzens ab und bedeutete ihm, weiterzugehen. Wahrscheinlich wartete ohnehin jemand auf ihn, um ihm die milden Gaben sofort wieder abzunehmen. An der nächsten Station, dem Knotenpunkt Châtelet, stieg er wieder aus. Dafür schwang sich mit etlichen weiteren Fahrgästen ein Akkordeonspieler herein, der sogleich eine beschwingte Melodie anstimmte. Nichts hätte schlechter zu Sophies Stimmung gepasst.
In Pont Neuf stürmte sie aus dem Zug, sobald die Türen zur Seite glitten, doch dann blieb sie mitten im Gedränge stehen. Sie wollte nicht an anderen Waggons vorbeilaufen und von diesem Kerl gesehen werden, solange er noch schnell aus der Métro springen konnte. Erst als der Zug anfuhr, schloss sie sich den Touristen an, die aus dem Untergrund emporquollen, um über die älteste Brücke der Stadt zu flanieren. Es war ungewohnt erleichternd, wieder ans grelle Sonnenlicht und die frische Luft zu kommen. Für gewöhnlich machte es ihr nichts aus, die Métro zu benutzen, aber heute schien nichts wie sonst zu sein.
Verstohlen blickte sie sich um, während sie in einem Aussichtshalbrund an das weiße Steingeländer der Pont Neuf trat. Es ähnelte unangenehm jenem der Pont de la Tournelle, über das sie nur zwei Nächte zuvor geklettert war. Sogar ein ähnliches Sims samt metallener Kabelabdeckung verlief davor. Schaudernd wich sie ein wenig zurück. Um sie herum keine Spur des Kerls mit der Sonnenbrille. Sie horchte in sich hinein, ob sie sich beobachtet fühlte, doch ihre Nerven flatterten noch zu sehr, als dass sie es mit Sicherheit hätte sagen können. Wer der Unbekannte auch sein mochte, sie hatte ihn wohl endlich abgeschüttelt.
Zeit, sich wieder auf die Schiffe zu konzentrieren. Am rechten Seineufer ragten auch hier nur Banner und Sonnenschirme anstelle von Masten und Flaggen auf. Stromabwärts konnte Sophie bis zum Louvre blicken, ohne ein einziges Boot zu entdecken, stromaufwärts näherte sich dagegen eines der Ausflugsschiffe, die unter der Mitte der Brücke, an der Spitze der Île de la Cité an- und ablegten. Es war zu groß und zu neu, um infrage zu kommen, aber es tröstete sie, überhaupt wieder ein Schiff zu sehen.
Während die Touristen Fotos von den mittelalterlichen Türmen der Conciergerie schossen, die aus dieser Perspektive die Insel dominierten, beschloss Sophie, ihren ursprünglichen Plan zu ändern und die Suche jenseits der Brücke auf dem linken Seineufer fortzusetzen. Ob sie nun auf dieser oder jener Seite bis zum Eiffelturm lief, um dann auf der anderen zurückzukehren, spielte keine Rolle, aber hier sah es im Moment einfach zu frustrierend aus, um überhaupt weiterzumachen.
Am anderen Ende der Pont Neuf erwartete sie eine Pariser Postkartenidylle. Wie sie es in Erinnerung hatte, lagen unten am Wasser etliche Schiffe hintereinander aufgereiht. Spaziergänger schlenderten an ihnen vorüber, und dahinter erhob sich die gemauerte Uferbefestigung, von der Treppen hinabführten. Oben an der Straße hatten die Bouquinisten im Schatten der Bäume ihre dunkelgrünen Stände geöffnet. Wehmut wallte in Sophie auf. Wie viel Spaß hatten Rafe und sie dabei gehabt, die alten Bücher und Zeitschriften, die Souvenirs und Gemälde nach etwas Brauchbarem zu durchstöbern! Sie hatten über Aktpostkarten der Goldenen Zwanziger gelacht, einem Aquarellmaler zugesehen und einen Anatomieatlas aus dem vorletzten Jahrhundert gekauft, dessen Seiten man nur vorsichtig umblättern durfte, damit sie nicht zerfielen. Jetzt liegt er in einer Kiste mit Rafes Lieblingssachen zu Hause auf dem Dachboden. Ob sie ihm den Karton wohl bald zurückgeben durfte? Nicht, wenn ich noch lange hier herumstehe …
Auf dem Weg die Treppen hinab breitete sich ein ungutes Gefühl in ihr aus, das sie nicht einordnen konnte. War es Angst davor, das Schiff nicht zu finden? Oder auf einen Mann zu treffen, der bei Tageslicht nur entfernt wie Rafael aussah? Es war möglich, aber was wog diese Enttäuschung gegen die Chance, ihn lebend wiederzusehen? Diese verzagten Erwägungen konnten sie nicht ernsthaft daran hindern, die ersten Schiffe in Augenschein zu nehmen, doch der Eindruck, wie von einer Wolke überschattet zu sein, blieb.
Zuvorderst lag ein schwarzer, restaurierter Lastkahn, der in Form und Größe schon nahe an das herankam, was sie suchte. Er diente jedoch als Hausboot, das durch ein Sonnensegel und Kübelpflanzen sogar über eine einladende Terrasse verfügte. Wer wohl die ganzen Leute waren, die auf dem Fluss hausten? Hübsch anzusehen waren die Schiffe allemal, besonders das nächste, ein alter Zweimaster, wie Sophie sie nur aus Filmen kannte. Seine Messingbeschläge gleißten in der Sonne, und das Holz der Masten glänzte wie mit Lack überzogen. In Hamburg hätten wir bestimmt viele Segelschiffe gesehen. Sie hatte sich darauf gefreut, mit Rafael den Hafen zu erkunden und an den Wochenenden Abstecher an Nord- und Ostsee zu machen. Konnte es etwas Schöneres geben, als dort hinzuziehen, wo andere Urlaub machten? Noch so ein Traum, der wie eine Seifenblase geplatzt war …
Plötzlich wusste Sophie, wo ihr ungutes Gefühl herrührte. Bevor sie darüber nachdenken konnte, fuhr ihr Kopf bereits herum. Ein dunkel gekleideter Mann trat unter dem letzten Bogen der Pont Neuf hervor. Die undurchsichtigen Gläser der Sonnenbrille waren auf sie gerichtet.
Sophie wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Hatte sie in der Métro nicht alles versucht, um den Fremden abzuschütteln? Sie konnte sich nicht in Luft auflösen, und vor allem war sie aus einem bestimmten Grund hier am Ufer und sah nicht ein, ihre Suche wegen dieses Stalkers abzubrechen. Stur stapfte sie weiter. Umgeben von so vielen Spaziergängern und Radfahrern und den Bewohnern der Hausboote, die ihre Blumen gossen, Decks strichen oder Wäsche aufhingen, konnte ihr nichts passieren. Doch sie spürte die Anwesenheit des Fremden hinter sich wie eine Androhung kommenden Unheils. Wie lange sollte dieses unheimliche Spielchen dauern?
Sie erwog, sich umzudrehen und ihn zur Rede zu stellen. Wenn sie sich wütend vor ihm aufbaute und ihn anfauchte, sie gefälligst in Ruhe zu lassen, musste er doch von ihr ablassen. Andererseits … Manche Männer fühlten sich in ihren Nachstellungen noch bestärkt, wenn sie erreichten, dass die Frau mit ihnen sprach – ganz gleich, was oder wie sie es sagte. Sophie sah ihn förmlich vor sich, wie er süffisant lächelte und versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Er würde es als Vorwand nehmen, neben ihr herzugehen und auf sie einzureden, und jeder würde glauben, dass sie ihn kannte. Ein harmloser Streit unter Freunden. Oder würde er eine abweisende Miene machen und sie auflaufen lassen? Einfach kühl leugnen, nur um ihr dann weiter zu folgen, bis sie in eine einsamere Gegend kamen?
Großer Gott, ich hab zu viele schlechte Filme gesehen. Sie riss sich zusammen und versuchte, sich wieder mehr den Schiffen zu widmen. Bis zum Eiffelturm war es noch weit. Vielleicht verlor der Kerl irgendwann das Interesse. Bei dem schönen Wetter waren so viele Ausflügler unterwegs, dass sie sich keine Sorgen machen musste. Oder sollte sie ihn doch einfach anschreien und der Sache ein Ende machen? Sie fuhr herum, doch der Fremde lief nicht direkt hinter ihr, sondern ein gutes Stück entfernt, näher an der Mauer, dort, wo die Bäume Schatten warfen. Als scheue er das Sonnenlicht, obwohl es hier kein Entrinnen davor gab.
Ernüchtert wandte sich Sophie ab. Das bisschen Zorn, das sie eben noch beflügelt hatte, war erneut der Übermacht ihrer Ängste und Bedenken erlegen. Was war sie nur für ein erbärmlicher Feigling! Wütend auf sich selbst lief sie weiter.
Die Sonne heizte das Pflaster des Kais auf und wurde vom Wasser gespiegelt. Obwohl sie nur eine dünne Sommerhose und ein Top trug, fühlte sich Sophie allmählich wie eine schmelzende Schneeflocke. Ihre Verzweiflung wuchs. Wahrscheinlich hatte sie dieses Schiff geträumt, während der Albtraum hinter ihr nur zu echt war. Bei nächster Gelegenheit hätte sie sich gern eine kalte Limo und ein Sandwich gekauft, aber schon bei der Vorstellung, es unter den Augen ihres Verfolgers essen zu müssen, wurde ihr übel. Warum konnte er nicht einfach dorthin verschwinden, wo er hergekommen war? Ein Blick über die Schulter zeigte ihr, dass sich der Abstand zwischen ihnen stattdessen verringert hatte.
„Attention, Mademoiselle!“, rief ein Radfahrer, dem sie fast vors Rad gelaufen war.
Erschrocken wich Sophie zurück, als er mit einem rettenden Schlenker an ihr vorbeizischte, und sah wieder nach vorn. Unter der nächsten Brücke kamen drei Polizeireiter in Sicht. An ihren leuchtend weißen Uniformhemden und den blauen Hosen waren sie schon von Weitem zu erkennen. Die schickt der Himmel!, dachte Sophie, obwohl sie eigentlich eher an Dienstpläne glaubte. Wenn sie den Gendarmen erklärte, dass der Mann schon seit der Île Saint-Louis und sogar in der Métro an ihren Fersen klebte, würden sie sicher ein ernstes Wort mit ihm reden. Unbewusst beschleunigte sie ihre Schritte. Die Hufeisen der drei gleich großen, fuchsfarbenen Pferde klapperten laut auf den Pflastersteinen. Die Reiter trugen schwarze Plastikhelme und Schusswaffen an den Gürteln. Sophie straffte sich. Der strenge Geruch von Pferdeschweiß wehte ihr entgegen. Erleichtert merkte sie, dass eine Frau unter den Polizisten war, und suchte deren Blick. „Entschuldigen Sie, Madame“, bat sie.
Sofort zügelte die Reiterin ihr Pferd. Die anderen folgten ihrem Beispiel. Alle drei sahen fragend zu ihr herab.
„Können Sie mir helfen?“, fuhr sie rasch fort. „Da ist …“
Sie drehte sich, um auf ihren Verfolger zu zeigen. Ungläubig blinzelte sie, ihr Blick jagte über den Kai. Nichts. Es war, als hätte die Erde den Fremden verschluckt.
Stunden später war ihr die Szene immer noch peinlich. Stotternd wie eine Touristin, die kaum die Sprache beherrschte, hatte sie den Polizisten von einem Verfolger berichtet, der sich in Luft aufgelöst hatte. Sie waren zu höflich gewesen, um etwas zu sagen, aber vermutlich hatten sie ihr einen Sonnenstich oder lebhafte Phantasie unterstellt, wenn nicht Schlimmeres. Sophies Wangen röteten sich noch bei der Erinnerung an die Blicke, die sie gewechselt hatten. Sie verstand einfach nicht, wo der Kerl so plötzlich geblieben war. Niemals hätte er den nächsten Aufgang zur Straße erreichen und abhauen können, ohne dabei noch von ihnen gesehen zu werden. Nicht einmal ein Versteck, das groß genug gewesen wäre, hatte es an jener Stelle gegeben. Ich sollte lieber froh sein, dass er weg ist, anstatt mir den Kopf zu zerbrechen.
Überrascht hielt sie inne. Sie war so in Gedanken versunken gewesen, dass sie die Schiffe betrachtet hatte, ohne sie bewusst zu sehen. Das ist es! Die Erkenntnis durchfuhr sie wie ein Blitz. Eben noch hatte sie geglaubt, ihre Suche morgen auf die Seineufer am Bois de Boulogne, dem riesigen Park am anderen Ende von Paris, ausdehnen zu müssen, und nun stand sie direkt davor. Lumière de Lutèce – Licht Lutetias – stand in Goldschrift auf dem Bug, doch das war bereits das Nobelste an dem umgebauten Frachter. Einst mochte Kohle oder Getreide in seinem Bauch transportiert worden sein, nun beherbergte der schwarze Rumpf wohl die Küche, Vorratsräume und natürlich die Maschine, deren Tuckern Sophie noch im Ohr hatte. Die weiß abgesetzte Reling wies ein paar Dellen auf, und die Geranien in den Blumenkästen wirkten verkümmert, obwohl oder gerade weil ein Mann dabei war, sie mit dem kräftigen Strahl aus einem Schlauch zu ertränken. Hinter ihm erhoben sich die einstöckigen, weiß gestrichenen Aufbauten. Sie bestanden größtenteils aus jenen Panoramafenstern, durch die Sophie nachts die Tische gesehen hatte. Im schonungslosen Licht des Tages bemerkte sie jedoch auch die Stellen, an denen die Farbe vom rostigen Stahl blätterte, die schwarzen Schlieren, wo regelmäßig Wasser herabrann, und die matten Bereiche der Scheiben, die auf Plastik hindeuteten. Das ebenso angerostete und verblichene Schild über dem Steg verriet, dass dieses schwimmende Lokal für private Feiern und Firmenausflüge zu mieten war. Kein Wunder. Touristen kann man damit wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr ködern. Sie kam zu dem Schluss, dass es leichter sein musste, Rafe wiederzufinden, wenn man ihr sagen konnte, wer die Lumière de Lutèce an jenem Abend gebucht hatte.
Als sie näher an die Kante des Kais trat, grinste der Mann mit dem schwarzen Gummischlauch, ohne dass ihm dabei die Zigarette aus dem Mundwinkel fiel. Er war von der Sonne fast schon dunkelbraun gebrannt und trug ein ausgeleiertes T-Shirt, abgewetzte Jeans und Turnschuhe. War der Besitzer so heruntergekommen wie sein Kahn, oder hatte sie eine Art Matrosen vor sich? Sie kannte sich mit Schifffahrt so wenig aus, dass sie nicht einmal genau wusste, ob es auf Flussschiffen überhaupt Kapitäne und Matrosen gab.
„Bonjour, Mademoiselle.“ Sie musste die Worte erraten, da er die Zähne kaum auseinanderbekam. „Wenn’se ’n gutes Angebot suchen, sin’se hier richtig.“
„Bonjour, Monsieur“, erwiderte sie betont höflich. „Ich habe dieses Schiff vorgestern Nacht vor der Île Saint-Louis vorbeifahren sehen. So um Mitternacht herum?“
Der Fremde zuckte mit den Schultern. „Ja, könnte hinkommen.“ Seinem Blick nach zu urteilen, fragte er sich, ob sie wirklich auf ein Geschäft hinauswollte.
„Haben Sie vielleicht …“ Sie zog das Foto von Rafe aus der Tasche. „… diesen Mann an Bord gesehen?“
Raue, graufleckige Finger nahmen es entgegen. „Hm.“ Wieder ein Achselzucken. „Weiß nich’. Bin die meiste Zeit unter Deck. Spülen und so. Is’ das ’n Verbrecher?“ Er musterte sie erneut, versuchte wohl abzuschätzen, ob sie Polizistin war.
„Nein, mein Verlobter.“ Sie konnte ihre Enttäuschung nur schwer verbergen. „Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Hinten auf dem Heck.“
„Hm“, brummte er, nahm die Zigarette aus dem Mund und rief plötzlich so laut, dass Sophie zusammenzuckte: „Henri!“
Sie starrte ihn entgeistert an, aber er schien sie überhaupt nicht wahrzunehmen, sondern zu lauschen. „Henri! Schwing mal deinen …“ Er brach ab, als ihm wieder einzufallen schien, dass er eine Frau vor sich hatte. „Los, komm rauf!“
Eine gedrungene Gestalt tauchte in einer offenen Tür auf. Die Haare waren bereits licht und viel zu blond für die sonnenverbrannte Miene darunter. Auch die gelben Bartstoppeln wirkten fehl am Platz, weil sie heller waren als die Haut. „Was gibt’s?“, blökte Henri, dessen Arme so schwarz verschmiert waren wie das Unterhemd, das er nachlässig in den Hosenbund gestopft hatte. Tätowierungen und Schmutz gingen nahtlos ineinander über.
Sein Kumpan zeigte ihm das Foto. „Haste den schon mal gesehen?“
Henri warf für Sophies Geschmack einen viel zu kurzen Blick darauf. „Nee.“
„Bitte, sehen Sie noch einmal hin, Monsieur! Ich glaube, dass er vorgestern Nacht an Bord war.“
Ein scharfer Blick seiner gelblich braunen Augen traf sie. „Da waren ’ne Menge Leute. Kann mir nich’ jeden merken.“ Damit wandte er sich ab und verschwand wieder im Bauch des Kahns. Sein Mannschaftskamerad gab Sophie mit einem dritten Achselzucken das Bild zurück.
„Haben Sie nicht noch mehr Kollegen, die Sie fragen können?“
Er schüttelte den Kopf. Die Zigarette hatte wieder den Weg in seinen Mundwinkel gefunden. „Die werden nur angeheuert, wenn’s Arbeit gibt.“
Nein, das kann es nicht einfach gewesen sein! Sie hörte selbst, wie flehend ihre Stimme klang, als sie sagte: „Können Sie mir vielleicht wenigstens sagen, wer das Schiff vorgestern gemietet hatte?“
„Das weiß nur der Chef“, brummte ihr Gegenüber und deutete zum Schild über dem Steg hinauf.
Sophie begriff, dass er die Telefonnummer meinte, die dort stand. „Trotzdem vielen Dank“, beeilte sie sich zu sagen, bevor er mit seinem noch immer die Geranien überflutenden Schlauch weiterzog. Wenn es sein musste, würde sie eben den Eigentümer der Lumière de Lutèce anrufen. Wo war nur der verfluchte Stift? Sie war sicher, dass sie einen eingesteckt hatte. Bevor sie noch lange weiter in ihrer Tasche kramte, griff sie zum Handy, um die Nummer zu speichern. Das Display zeigte eine neue SMS an. Sicher wieder so eine lästige „Willkommen in der EU“-Nachricht. Seit sie in Paris war, wechselte ständig ihr Netzanbieter, und jedes Mal kam eine Info über die neuen Tarife. Sie tippte die Telefonnummer des Schiffseigners ein und ließ das Handy wieder in der Tasche verschwinden.
Am liebsten hätte sie sofort angerufen, aber sie fürchtete, ausgerechnet der Blumenmörder könnte Zeuge ihrer endgültigen Niederlage werden, und mit ihren Tränen wollte sie dann doch lieber allein sein. Ein Stück stromaufwärts war sie an einer kleinen Grünfläche mit Parkbänken vorbeigekommen, wo sie ungestört sprechen konnte. Sie schlug den Rückweg ein und legte sich in Gedanken bereits die Worte zurecht. Irgendwie musste sie dem Unbekannten das Geheimnis entlocken, falls er sich stur stellte. Sollte sie sich als Polizistin ausgeben? Oder doch besser bei der Wahrheit bleiben und ihn mit Tränen erweichen? Allmählich wünschte sie sich, sie wäre Privatdetektivin oder hätte zumindest eine entsprechende Ausbildung. Im Fernsehen besuchten die Ermittler in solchen Fällen einfach den Besitzer des Schiffs, und einer lenkte ihn ab, während der andere einen Blick in die Kundendatei oder das Auftragsbuch warf. Oder sie brachen nachts in sein Büro ein. Vielleicht wird er es mir ja auch einfach sagen.
Sie erreichte die nächstgelegene Bank und setzte sich. Während irgendwo in Paris ein Telefon läutete, krampfte sich ihr Magen zusammen. Alles hing von diesem Kerl ab, einer fremden Stimme, zu der sie nicht einmal ein Gesicht hatte. Sie stellte sich ein besser gekleidetes Pendant zur Besatzung vor, doch das half nicht gerade, ihre Nervosität zu überwinden.
„Hallo?“
„Bonjour, Monsieur … Verzeihen Sie, ich kenne Ihren Namen nicht. Ich habe Ihre Nummer von dem Schild an der Anlegestelle … Ihres Schiffs.“ Natürlich des Schiffs! Sophie wand sich innerlich. Seines Autos wohl kaum.
„Arnaud.“ Das musste dann wohl der Name sein. Der Mann klang etwas ungeduldig, aber nicht unfreundlich. „Wollen Sie die Lumière mieten?“
„Nein, Monsieur Arnaud. Mein Name ist Sophie Bachmann. Ich möchte Sie nur um eine Auskunft bitten.“
„Aha.“ Die Stimme wurde um einige Grad kühler.
„Könnten Sie mir sagen, wer vorgestern Nacht auf Ihrem Schiff unterwegs war? Ich muss das unbedingt wissen“, rutschte es Sophie heraus. Sie hätte sich auf die Zunge beißen können. Als Angestellte der Gendarmerie ging sie jetzt nicht mehr durch.
„Ich bedaure, Madame. Solange meine Kunden mir nichts Gegenteiliges sagen, gehe ich davon aus, dass sie ihre Daten vertraulich behandelt sehen wollen.“
„Warten Sie!“, rief Sophie, aus Angst, er wolle auflegen. „Ich verstehe Ihre Bedenken, Monsieur Arnaud. Es geht mir nur darum, Ihren Kunden nach einem seiner Gäste zu fragen. Sie können ihn zuerst um Erlaubnis bitten, wenn das …“
„Madame“, fiel er ihr gereizt ins Wort. „Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als meine Kunden mit solchen Anfragen zu belästigen. Und damit das gleich klar ist: Weitere Anrufe können Sie sich sparen! Guten Tag.“
„Aber …“ Sie verstummte, denn die Leitung war tot. Das Handy noch immer am Ohr, starrte sie auf die Seine, und selbst ihre Gedanken schwiegen. Es dauerte einen Moment, bis sie sich der Schritte auf dem Splitt bewusst wurde, die sich ihr genähert hatten. Jemand stand zwei, drei Meter seitlich von ihr. Sie sah auf.
„Wie viel ist Ihnen der Kerl wert?“, fragte Henri.
Als Sophie die Augen aufschlug, war ihr Zimmer in fahles Mondlicht getaucht. Der alte, dunkle Kleiderschrank mit den Glaseinsätzen schimmerte silbrig, geheimnisvoll und ein bisschen unheimlich. Sie glaubte, plötzlich zu verstehen, was C.S. Lewis inspiriert hatte, ausgerechnet einen Schrank zum Tor in das Zauberreich Narnia zu erwählen. Ihr war kühl. Schläfrig wollte sie sich die Decke über die Schulter ziehen und griff ins Leere.
O Mist! Bis auf die Schuhe lag sie vollständig angezogen auf dem Bett. Ausgelaugt durch die Hitze, den langen Marsch entlang der Seine und das Auf und Ab ihrer Gefühle hatte sie sich vor dem Abendessen ausgestreckt, um kurz auszuruhen und sich danach wieder auf die Suche nach Rafe zu machen.
Mist! Mist! Mist! Wie spät mochte es sein? Sie zog ihre Tasche aufs Bett und holte das Handy heraus. 03:13 Uhr.
Selbst für eine Samstagnacht war es jetzt zu spät, um sich allein auf die Straße zu wagen. Falls Rafael – oder der Typ, der ihm ähnlich sah – um diese Zeit überhaupt noch unterwegs war. So genau hatte sich Henri da nicht ausgedrückt. Kaum zu fassen, dass er ihr hundert Euro für eine Auskunft abgeknöpft hatte, die möglicherweise nur seiner kriminellen Phantasie entsprungen war. Im Grunde konnte jeder behaupten, dass sich der Mann auf dem Foto regelmäßig in der Gegend um die Rue Mouffetard herumtrieb, einer beliebten Ecke am Rand des Quartier Latin. Henri hatte nicht verraten wollen, woher er es wusste, also war ihr nichts anderes übrig geblieben, als ihm zu glauben – und zu bezahlen, denn mit einem wie ihm legte sie sich nicht an. Hundert Euro, und nun hatte sie auch noch die erste Gelegenheit verschlafen, dieser neuen Spur nachzugehen.
Das konnte wieder nur mir passieren. Und schon zwei neue Nachrichten.
Sophie hielt den Atem an. Vielleicht hatte Monsieur Arnaud es sich anders überlegt. Sie rief die Nachrichten auf. Die erste war tatsächlich nur eine Tarifinformation, die sie sofort löschte. Es stand ohnehin jedes Mal dasselbe darin. Sie öffnete die zweite.
„Liebe Sophie, deine Mutter macht sich Sorgen, weil du dich nicht meldest. Ruf sie doch mal an! Gruß, Tante Else.“
Darauf kann sie lange warten! Sophie warf das Handy zurück in die Tasche. Typisch Else. Wen interessierte schon, wie es ihr ging? Hauptsache, ihre Mutter war glücklich. Sie würde sich erst wieder zu Hause melden, wenn sie ihrer Mutter einen lebenden Rafael präsentieren konnte. Etwas anderes hatte sie für ihr Verhalten nicht verdient.
Der Ärger hatte die letzten Reste Müdigkeit vertrieben, stattdessen machte sich das verpasste Abendessen als Loch in ihrem Magen bemerkbar. Sie seufzte und schwang sich aus dem Bett. Was soll’s? Such ich mir eben noch einen Mitternachtssnack und sehe zu, dass ich morgen fit bin.
In Pantoffeln tappte sie auf den dunklen Flur hinaus. Vom Ticken der großen Standuhr abgesehen, war es totenstill in der Wohnung. Das Parkett knirschte unter ihren Schritten wie brechendes Eis. Schatten schienen vor ihr zu fliehen, als sie die angelehnte Tür zur Küche öffnete. Andere krochen näher. Beunruhigt tastete Sophie nach dem Lichtschalter. Die einzelne Glühbirne im weiß-rot karierten Lampenschirm scheuchte die Schatten tiefer in die Ecken des etwas heruntergekommenen Zimmers zurück. Ruß und fettiger Kochdunst hatten Tapeten und Decke über die Jahre vergilben lassen, und die Schränke, die an eine alte Landhausküche erinnerten, waren von Holzwürmern geplagt. Das Emaille-Spülbecken mit dem gegossenen Wasserhahn vervollständigte den Eindruck, in einem Museum gelandet zu sein. Vielleicht hatte Madame Guimard irgendwann beschlossen, dass sich eine Renovierung in ihrem Alter nicht mehr lohne.
Es roch nach einer Mischung aus Kernseife, deftigem Eintopf und Moder. Auf dem abgenutzten Küchentisch lagen ein Suppenteller nebst Löffel und ein halbes Baguette samt Brotmesser. Sophies Blick wanderte zum alten Gasherd. Ein Blechtopf stand darauf, an dem ein Zettel mit Madame Guimards schwungvoller und doch akkurater Handschrift lehnte. „Ich wollte dich nicht wecken. Du sahst so müde aus.“
Sophie musste lächeln. Die wenigen Worte wärmten ihr Herz mehr als alles, was ihre Mutter seit Rafes Tod gesagt hatte. Es gelang ihr, ohne größere Verpuffung die Gasflamme anzuzünden, worauf sie ein bisschen stolz war, weil sie vor ihrer Ankunft in diesem Haus noch nie einen Gasherd benutzt hatte. Während der Eintopf heiß wurde, goss sie sich ein Glas Wasser ein und wandte sich dem Brot zu. Wieder wurde ihr die Stille in der Wohnung bewusst. Ein kaum hörbares Zischen der Flamme war das einzige Geräusch. Erneut war ihr, als werde sie beobachtet, doch das Zimmer war leer. Ihr Blick blieb an der undurchdringlichen Dunkelheit vor dem Fenster hängen.
Nein, das konnte nicht sein. Sie war im vierten Stock.
Trotzdem lief ihr ein Schauder über den Rücken, und sie wünschte, sie hätte ein Sweatshirt über das Top gezogen. Zum Glück würde sie gleich heiße Suppe im Magen haben. Sie griff nach dem Messer. Plötzlich sah sie sich mit der Klinge über ihre Pulsadern fahren. Ein roter Spalt öffnete sich unter dem gezähnten Stahl. Sie blinzelte. Das Messer lag unverändert in ihrer Hand. Ihre Haut war unberührt. Aber für einen Augenblick hatte das Bild so echt gewirkt, dass sie versucht gewesen war, es zu tun – die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Wie erstarrt ließ sie das Messer zurück auf den Tisch fallen. Wer auch immer du bist, verschwinde!, dachte sie, ohne zu wissen, zu wem sie eigentlich sprach.
Am nächsten Nachmittag saß Sophie im Schneidersitz auf dem Bett und versuchte, französisches Wirtschaftsrecht zu pauken. Während ihrer Ausbildung war sie ausgerechnet auf diesem trockenen Fachgebiet immer gut gewesen, aber nun wollten die geänderten Paragraphen der letzten Jahre nicht in ihrem Gedächtnis haften bleiben. Ständig erwischte sie sich dabei, dass die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen, weil ihre Gedanken zum Abend vorauseilten. Hundertmal sah sie in verschiedenen Varianten vor sich, wie das Wiedersehen mit Rafe verlaufen könnte. Manchmal wichen die Dialoge nur um ein paar Wörter voneinander ab, in denen jedoch ganze Bedeutungswelten mitschwangen und dem Wortwechsel eine völlig andere Richtung gaben. Mal leugnete Rafael, sie zu kennen – natürlich nur, um sie vor brutalen Drogenhändlern zu schützen. Mal schloss er sie überglücklich in die Arme.
Nicht zu wissen, wie die Begegnung wirklich ablaufen würde, zerrte an ihren Nerven. War es nicht bald spät genug, um die vergebliche Lernerei abzubrechen und sich stattdessen der Frage zu widmen, was sie für den großen Moment anziehen sollte? Himmel, Sophie! Steiger dich nicht so rein! Wie groß ist die Chance, dass er tatsächlich noch lebt?
Das Klingeln des Handys bewahrte sie vor neuen Zweifeln. Sie runzelte die Stirn. Hoffentlich war es nicht Else oder gar ihre Mutter selbst. Ein rascher Blick auf das Display ließ sie erleichtert aufatmen. „Hallo, Lara!“, jubelte sie.
„Hi, Sophie! Du klingst gut.“ Freudige Überraschung lag in der vertrauten, ungewöhnlich tiefen Stimme. „Ist es schön in Paris?“
„Ach, Paris ist doch immer schön, egal, wie’s mir geht. Ich glaube, ich bin nur froh, dass du mich vom Lernen abhältst.“
Lara lachte. „Na, wenn das so ist, muss ich wohl wieder auflegen.“
„Untersteh dich!“
„Was lernst du denn überhaupt? Da ruf ich extra sonntags an, um deinen Unterricht nicht zu stören, und du hängst trotzdem über den Büchern.“
„Nur für die Abschlussprüfung am Freitag. Unter der Woche hab ich kaum Zeit dafür, und ich kann praktisch noch nichts.“
„So wie ich dich kenne, ist das garantiert übertrieben“, meinte Lara. Sophie konnte es ihr nicht übel nehmen. Zu oft hatte sie ihre Freundin schon während ihrer Schulzeit mit Prüfungsangst verrückt gemacht und dann doch nicht so schlecht abgeschnitten. „Aber was für eine Prüfung? Ich dachte, du nimmst nur an so ’ner Art Fortbildungsseminar teil.“
„Ja, aber man kann sich am Ende freiwillig prüfen lassen und bekommt dann ein Zertifikat. So was macht sich bei Bewerbungen besser als eine schnöde Teilnahmebestätigung, also hab ich mir gesagt: Wenn schon, denn schon. Nehm ich das auch noch mit.“
„Stimmt schon“, gab Lara zu. „Dann würde ich’s wahrscheinlich auch machen. Und es hassen, bei dem genialen Wetter meinen Sonntag damit zu verbringen.“
„Ist es bei euch auch so heiß?“
„Und ob! Wir sind gerade aus dem Freibad heimgekommen, weil Stefans Rücken schon knallrot ist. Trotz Eincremen! Seit alle Welt nur noch von Hautkrebs redet, macht Sonne echt keinen Spaß mehr. Das kann dir beim Büffeln wenigstens nicht passieren.“
„Nein“, lachte Sophie. „Aber ich war gestern den ganzen Tag an der Seine unterwegs. Ich glaub, ich hab mir dabei einen Sonnenstich geholt oder so. Jedenfalls bin ich wie tot umgefallen, als ich nach Hause kam, und erst nachts wieder aufgewacht.“
„Aha!“, rief Lara. „Du sitzt also doch nicht nur in deiner Abstellkammer herum.“
Wenn du wüsstest … Sollte sie Lara von ihren seltsamen Erlebnissen erzählen? Von Rafe besser nicht, sonst würde ihre Freundin sie auch noch für verrückt halten. Und was den Vorfall mit dem Messer anging, wusste sie selbst nicht mehr genau, ob sie das im Halbschlaf nicht nur geträumt hatte. Was sollte dann erst Lara dazu sagen? „Nur keine Sorge, ich … werde auch heute Abend wieder ausgehen.“
„Das ist gut. Weißt du, Stefan und ich haben uns schon Gedanken gemacht, weil du jetzt so ganz allein in Paris sitzt.“
Stefan kennt mich überhaupt nicht, dachte Sophie säuerlich, doch es hatte keinen Sinn, Lara darauf hinzuweisen, dass sie ihren neuen Freund erst zweimal gesehen und kaum ein Wort mit ihm gewechselt hatte. Sie war Lara dankbar, dass sie sich nach Rafes Tod darum bemüht hatte, für sie da zu sein, und ihr die Schulter zum Ausheulen angeboten hatte. Ihr vorzuwerfen, dass sie ausgerechnet in Sophies schwärzestem Moment den Mann ihres Lebens kennengelernt und deshalb kaum ein anderes Thema mehr gekannt hatte, wäre unfair gewesen. „Das ist wirklich nicht nötig. Genießt ihr mal euer Glück! Ich gönn dir das, Lara, auch wenn’s sich in Stuttgart vielleicht nicht immer so angehört hat.“
„Ach, Sophie. Das weiß ich doch. Ich war bestimmt nicht leicht zu ertragen. Stefan hier, Stefan da. Meine Schwester kann’s auch schon nicht mehr hören, aber ich schaff’s einfach nicht, ihn mal fünf Minuten nicht zu erwähnen.“
Sophie musste grinsen. „Ich weiß. Du bist in diesem Zustand nicht zu ertragen.“
„Na ja, du hast es mir auch nicht gerade leicht gemacht. Aber das ist okay“, schob Lara rasch nach. „Du hast viel durchgemacht. Ich freu mich, dass es dir besser geht.“
Ich jage Geistern nach, will von Brücken springen und mir die Pulsadern aufreißen … „Ich bin mir nicht sicher, ob es mir besser geht. Sagen wir lieber, dass ich mich anders fühle. Ich habe hier … eine neue Sicht auf die Dinge bekommen. Mal sehen, wie sich das entwickelt.“
„Klingt jedenfalls, als würdest du wieder nach vorne schauen. Das ist ein Fortschritt.“
Fragt sich nur, in welche Richtung.
Henri hatte etwas von La Mouffe genuschelt, doch da der Name in jedem Reiseführer stand, wusste Sophie, dass er die Rue Mouffetard gemeint hatte. Die Straße war zu nah, um ernsthaft die Métro in Erwägung zu ziehen. Sophie wählte Jeans und eine schicke Bluse und band sich ihre Jacke um die Hüfte, da es nachts frisch werden würde. Bevor sie aufbrach, erzählte sie Madame Guimard, in welcher Gegend sie ausgehen wollte, denn die alte Dame hätte ohnehin darauf bestanden. Gleich am ersten Abend hatte sie betont, dass sie sich Sophies Eltern gegenüber in dieser Hinsicht verantwortlich fühle. Dass Sophie vierundzwanzig war, schien sie nicht zu beeindrucken, denn für sie waren anscheinend alle Menschen unter vierzig noch Kinder.
Womöglich würde sie mir Hausarrest erteilen, wenn sie wüsste, was ich vorhabe, dachte Sophie schmunzelnd, als sie auf die Straße hinaustrat. Sie hatte das Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben, und ging in Gedanken durch, was sie brauchte. Schlüssel, Geld, Stadtplan, sogar das Handy hatte sie im letzten Moment eingesteckt. Nach dem Gespräch mit Lara war der Akku leer gewesen, sodass sie es beinahe am Ladegerät vergessen hätte, aber als Notanker war es doch zu wichtig – selbst halb aufgeladen. Ihr fiel nicht ein, was sie an einem Abend in der Großstadt noch vermissen könnte. Sicher setzte ihr nur die Aufregung zu. Sie war so kribbelig wie vor dem ersten Date, obwohl sie sich ständig vorhielt, wie dumm und voreilig das war.
Unterwegs wurde sie ruhiger, und bald führte der Weg bergauf, was den Namen der Straße – Rue de la Montagne Sainte-Geneviève – erklärte. Sophie bog jedoch ab, bevor die Kirche mit dem Reliquienschrein der heiligen Genoveva in Sicht kam. Die traurige Geschichte des Schreins, der im Aufruhr der Revolution geschändet worden war, als ob die über tausend Jahre zuvor verstorbene Frau eine Schuld an adliger und kirchlicher Willkür träfe, hatte sie angerührt, ja geradezu empört, als sie mit Rafael eher zufällig ausgerechnet diese Kirche besichtigt hatte. Doch jetzt stand ihr nicht der Sinn nach stillen Gewölben und geschichtsträchtigen Mauern. Seit Rafes Beerdigung ging ihr das ewige Schweigen der Toten dort zu nah.
Sie folgte den auffallend vielen jungen Leuten in die Rue Descartes, an deren Beginn ihr bereits laute Musik aus einer Bar entgegenschallte. Jugendliche schlängelten sich auf knatternden Mofas durch die bunte Menge aus Studenten, Einheimischen und jungen Touristen. Bekannte riefen sich Grüße zu. Schon jetzt wurde gelacht und geprahlt, obwohl der Abend gerade erst begann. Noch warfen die Häuser in der untergehenden Sonne lange Schatten über die enge Straße, und die ausgelassene Stimmung war mehr der Vorfreude als dem Alkohol geschuldet. Autofahrer verirrten sich kaum hierher. Tische und Stühle wucherten aus den Lokalen ins Freie und machten gemeinsam mit den Flaneuren dem Verkehr die Straße streitig, die schließlich in einen kleinen gepflasterten Platz mündete.
Vier Bäume mit ungewöhnlich großen Blättern, ein paar Blumenkübel und gestutzte Hecken umgaben den Springbrunnen in der Mitte des Place de la Contrescarpe. Ein niedriger Gitterzaun hielt die Leute aus dem Grün fern, und eine von schwarzen Eisenpfosten baumelnde Kette wiederum die Autos und Motorroller von den Menschen, die aus allen Richtungen zusammenströmten. Auch hier quollen Sitzgelegenheiten aus etlichen Cafés. Das Stimmengewirr schwoll zu einem Summen in Sophies Ohren an. Sie blieb einen Augenblick lang stehen, um ihre Möglichkeiten zu überdenken. Wenn ihr Gedächtnis sie nicht täuschte, mündete direkt gegenüber die Rue Mouffetard in diesen Platz. Aber ganz gleich, wo sie Posten beziehen würde, könnte sie nie die komplette Straße überblicken. Dazu war La Mouffe zu lang, zu unübersichtlich, und es gab zu viele Abzweigungen.
Also beschloss sie, erst einmal zu bummeln, bis der Hunger sie in ein Lokal trieb. Da sie nicht wusste, wo und wann Rafe auftauchte – und ob er überhaupt jemals herkam –, konnte sie ebenso gut aufs Geratewohl herumlaufen und dabei nach ihm Ausschau halten. Kaum hatte sie den Platz überquert, entdeckte sie ein Stück vor sich eine hochgewachsene Gestalt mit dunkelbraunem, leicht gelocktem Haar, das bis in den Nacken fiel. Die federnden Bewegungen des schlanken, aber breitschultrigen Mannes deuteten Jugend an.
Sophies Herz schlug schneller. Sie musste ihn einholen, einen Blick auf sein Gesicht erhaschen. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, ging sie flotter. Plötzlich schien sie jeder behindern oder ihr den Weg abschneiden zu wollen. Sie zwängte sich durch Lücken, wo vorher viel Platz gewesen war, umging Leute, die Speisekarten studierten, und drängelte sich durch eine Gruppe unschlüssig herumstehender Engländer. Konnte sie so viel Glück und Pech auf einmal haben? Ihr war, als sei sie keinen Deut näher herangekommen. Jetzt erst bemerkte sie den kleineren Mann an Rafes Seite, der genauso dunkle, aber kurz geschorene Haare hatte. Fahrig deutete er auf ein Café oder einen der Gäste, woraufhin sein Begleiter hinüberblickte. Die Enttäuschung traf Sophie wie ein kalter Regenguss. Der Junge, den sie für Rafael gehalten hatte, war höchstens zwanzig und besaß eine ungewöhnlich große, gebogene Nase. Nicht einmal im Dunkeln hätte sie ihn mit Rafe verwechseln können.
Noch zweimal spielten die Augen ihr solche Streiche, dann ließ sich ihr Puls nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Ernüchtert begann sie, auch den Rest der Umgebung wieder bewusster wahrzunehmen. Die Rue Mouffetard war eine sehr schmale, alte Straße, in der sich noch so manches Haus mit Fassadenmalereien und Reliefen schmückte. Zunächst wechselten sich Kneipen, Restaurants und kleine Geschäfte ab, später dominierten die – sonntagabends leider geschlossenen – Marktstände, denn La Mouffe war berühmt für ihren täglichen Lebensmittelmarkt. Sogar in einem ihrer Lieblingsfilme, Die fabelhafte Welt der Amélie, kaufte Monsieur Bretodeau regelmäßig in dieser von Obst- und Gemüseauslagen gesäumten Gasse sein Brathähnchen. Doch die Realität war nicht ganz so idyllisch, sondern schloss auch Fast-Food-Läden und laute Musik aus einigen Lokalen ein.
Sophie schlenderte bis zu der alten Kirche, die das Ende der Mouffe markierte, und drehte wieder um. Die Gerüche aus den Küchen und Schnellimbissen zeigten allmählich Wirkung. Sie entdeckte ein italienisches Restaurant, vor dem sie auf der Straße sitzen und die Passanten beobachten konnte. Dass auf der Tafel mit den Tagesgerichten auch noch Tiramisu lockte, entschied die Angelegenheit. Nur weil dieser Henri sie geschröpft hatte, würde sie nicht auf ihr Lieblingsdessert verzichten.
Während sie sich durch eine eigenwillige Salatkreation mit Parmaschinken und Grapefruit kämpfte und anschließend das zum Glück perfekte Tiramisu umso mehr genoss, senkte sich die Nacht auf Paris herab. Hunderte, wenn nicht Tausende mussten mittlerweile an ihr vorübergezogen sein, nur Rafe war nicht darunter gewesen.
Sie hatte ihr Budget mit einem Espresso weiter strapaziert, um den Aufbruch so lange wie möglich aufzuschieben, doch seit einer Weile warf der Kellner ihr ungeduldige Blicke zu. Wenn sie nichts mehr bestellte, blockierte sie einen Tisch. Bevor er unhöflich werden konnte, bat Sophie um die Rechnung und machte sich auf den Rückweg, aber aufgeben wollte sie noch nicht, denn in den Bars fing das Leben jetzt erst richtig an.
Rund um den Place de la Contrescarpe ging es besonders hoch her. An einigen Cafétischen wurde lautstark debattiert, an anderen gegrölt und gelacht. Der Fahrer eines Autos, der im Schritttempo über den Platz schleichen musste, wurde mit Flüchen bedacht, weil er die Nachtschwärmer teilte wie Moses das Rote Meer. Hinter ihm fluteten sie zurück auf die Fahrbahn, als hätte es ihn nie gegeben. Angeheiterte Mädchen zogen Arm in Arm um die Häuser, lachten kreischend oder kicherten, wenn sie von jungen Männern angesprochen wurden. Die Menge war hier nicht so bunt wie an mancher Métro-Station. Zwar entdeckte Sophie Menschen aller Völker und Hautfarben, während sie nach Rafael Ausschau hielt, doch die Schwarzen, Asiaten und Nordafrikaner, die in diesem Viertel ihr Vergnügen suchten, bevorzugten in Sachen Mode den europäischen Einheitslook. So oder so war es unmöglich, jeden Einzelnen wahrzunehmen, der sich irgendwo an diesem Platz aufhielt oder ihn nur streifte.
Sophie umrundete den Place de la Contrescarpe und warf im Vorübergehen einen Blick in jedes Lokal. Am Ende entschied sie sich für eine Bar, in der sie noch einen kleinen Tisch am Fenster ergattern konnte. Wenigstens diese Ecke des Platzes wollte sie im Auge behalten. Die Kellnerin hatte kaum die Orangina vor ihr abgestellt, als vier junge Leute eintraten und sich ebenfalls nach einem Tisch umsahen. Sie waren leger, aber nicht heruntergekommen gekleidet, weshalb Sophie sie für Studenten hielt. Die einzige Frau der Truppe, eine zierliche Brünette mit burschikoser Frisur, ähnelte einem der Männer so auffällig, dass sie vermutlich Geschwister waren. Der Blick des Bruders blieb an Sophie hängen, die rasch wegsah, doch es half nichts. Da keine anderen Plätze frei waren, kamen die vier zu ihr herüber.
„Hallo! Stört’s dich, wenn wir uns zu dir setzen?“ Der junge Mann hatte nicht nur dieselbe Haarfarbe wie seine Schwester, sondern auch mindestens ebenso lange Wimpern, die seinen stechenden grauen Augen einen weicheren Zug verliehen.
Sophie lächelte gequält. „Eigentlich schon. Ich warte auf jemanden.“
„Ach, dann ziehen wir einfach weiter, wenn dein Freund kommt.“ Mit einer wegwerfenden Handbewegung ließ er sich neben ihr nieder, während sich die anderen freie Stühle zusammensuchten. „Oder ist es eine Freundin?“
Das Gespräch nahm genau die Wendung, die sie befürchtet hatte. Schon hatte sie die Straße länger aus dem Auge gelassen, als ihr lieb war, dabei war es im Laternenlicht schon schwierig genug, die Gesichter der Passanten zu erkennen.
„Es ist mein Verlobter“, erwiderte sie, um ihn zu entmutigen.
„Was für ein Pech“, lachte einer der anderen beiden und klopfte seinem Freund betont munter auf die Schulter. Zur Antwort bekam er nur einen Brummlaut.
Die Kellnerin erschien und lenkte sie ab. Längst hatte Sophie ihre Aufmerksamkeit wieder nach draußen gerichtet.
„Bist du auch Studentin?“, erkundigte sich die junge Frau.
„Nein, Fremdsprachenkorrespondentin“, antwortete Sophie mit einem raschen Seitenblick.
Da ihre Antworten so einsilbig blieben und sie ständig aus dem Fenster starrte, gaben es ihre Tischnachbarn bald auf. Sicher halten sie mich jetzt für eine dumme, langweilige Kuh, dachte sie bedauernd, denn die vier wirkten nett und aufgeschlossen. Aber wenn sie Rafe jemals finden wollte, hatte sie keine Wahl.
Die Zeit zog sich wie Kaugummi. Nach einer Weile wechselten die Studenten an einen frei gewordenen größeren Tisch, und sie blieb allein auf ihrem Beobachtungsposten zurück. Mitternacht verstrich. Sie musste sich zwingen, die Lider offen zu halten. Das hat alles keinen Sinn, flüsterte ihr eine innere Stimme zu. Morgen würde sie vor Müdigkeit wieder dumpf wie ein Zombie in der Schule sitzen. Gerade unterdrückte sie mühsam ein Gähnen, als jemand an ihren Tisch trat.
„Der kommt nicht mehr.“
Überrascht sah sie zu dem jungen Mann mit den grauen Augen auf. „Wahrscheinlich nicht“, stimmte sie widerwillig zu und kramte ihr Portemonnaie hervor. Er sollte nicht glauben, dass sie nun bei ihm Trost suchen würde.
„Soll ich dich nach Hause bringen?“, fragte er prompt.
Sie erinnerte sich an den unheimlichen Kerl, der sie an der Seine verfolgt hatte, und zögerte. Doch ihn kannte sie ebenso wenig, und sie wollte ihn auch nicht ausnutzen. „Nein.“ Wieder sah sie durch die Scheibe nach draußen. „Das ist wirklich …“ Als sie den Mann auf der Straße erkannte, geriet ihre Stimme zu einem Wispern.
Rafe.«
Sophie warf den erstbesten Geldschein, der ihr zwischen die Finger kam, auf den Tisch, riss mit der freien Hand ihre Jacke von der Rückenlehne und hastete zum Ausgang. Hinter ihr polterte der Stuhl zu Boden, während sie sich zwischen den verdutzten Studenten hindurchdrängelte. Wenn es so weiterging, würde ihr bald der Ruf überstürzter Abgänge vorauseilen, doch sie wischte den Gedanken beiseite. Ihr Herz raste. Sie hatte Rafe vor dem Fenster gesehen, ganz sicher. Keine Sekunde durfte sie jetzt verlieren.
Vor der Tür empfing sie kühle Nachtluft. Es waren weniger Leute unterwegs als zuvor, aber mehr, als sie an einem Sonntag erwartet hätte. Sie drehte den Kopf, fürchtete, die Gestalt, die eben an der Bar vorbeigegangen war, könne ein weiteres dummes Trugbild gewesen sein, das die Sehnsucht ihr vorgaukelte. Nein, sie war da! Das helle T-Shirt zog Sophies Blick sofort auf sich. Sie wollte Rafes Namen rufen, wollte, dass er sich umdrehte und sie erkannte. Doch der Impuls erstarb, als sie die beiden Männer zu seiner Rechten bemerkte, mit denen er gerade ein paar Worte wechselte. Ihren Bewegungen haftete etwas Steifes, Entschlossenes an, das nicht zu harmlosen Nachtschwärmern passte. Alle wilden Theorien über die Gründe für sein Untertauchen fielen ihr wieder ein. Wenn sie jetzt einen Fehler beging, konnte sie alles zunichtemachen. Es war besser abzuwarten, bis sie ihn allein sprechen konnte.
Darauf bedacht, den Abstand nicht zu groß werden, aber auch nicht schrumpfen zu lassen, folgte sie den drei Männern, die den Platz überquerten und auf der anderen Seite wieder verließen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie noch immer ihren Geldbeutel mit der einen und die Jacke mit der anderen Hand umklammerte, während sie die Umhängetasche in der Eile nur unter den Arm geklemmt hatte. Nicht gerade die empfehlenswerte Art, wie man im nächtlichen Paris seine Wertsachen transportieren sollte. Sie nahm die Jacke zwischen die Zähne, um das Portemonnaie einstecken und den Gurt der Tasche über die Schulter streifen zu können, während sie gleichzeitig immer wieder nach vorn spähte. Unweigerlich fiel sie zurück. Sie nahm den selbstverpassten Knebel aus dem Mund und ging schneller.
Vor ihr bogen Rafe und seine Begleiter ab. Sophie rannte. Sofort drohte ihr die Tasche von der Schulter zu rutschen. Mit einer Hand hielt sie den widerspenstigen Gurt, mit der anderen die Jacke, während sie mit dem Ellbogen versuchte, die hüpfende Tasche zu bändigen. Das kann doch alles nicht wahr sein! Sie verkniff sich einen lauten Fluch und verkürzte ihre Schritte, um in unauffälligerem Tempo um die Straßenecke zu biegen. Sie hatte schon genug Blicke auf sich gezogen.
In der Seitenstraße ging es ruhiger zu. Das blinkende grüne Kreuz einer Apotheke war eine der wenigen Leuchtreklamen, die hier den Laternen Konkurrenz machten. Erleichtert entdeckte Sophie die drei Männer wieder, als sie gerade darunter hinweggingen. Einer der beiden Fremden hatte über einem Rest kurzen, dunklen Haars eine Halbglatze, auf der sich das grüne Neonlicht spiegelte. Er war so groß wie Rafael, aber deutlich breiter und massiger gebaut, der andere dagegen einen halben Kopf kleiner und schmächtig. Sie trugen kurzärmelige Hemden und hatten sich nicht die Mühe gemacht, diese in den Hosenbund zu stopfen. Sophie trat Schweiß auf die Stirn. Versteckten sie etwa Waffen? Waren es dieselben Männer, mit denen sie Rafe bereits auf dem Schiff gesehen hatte?
Sie überquerten die Straße, um erneut um eine Ecke zu verschwinden. Sophie beeilte sich. Außer einem einzelnen Fußgänger auf der anderen Seite war vor ihr niemand mehr zu sehen. Trotz der lauen Sommernacht umwehte ihn ein dunkler Mantel, doch davon abgesehen, fiel Sophie nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Er bog in dieselbe Gasse ab wie Rafe. Ein Zufall? Aber er war schon zuvor auf der anderen Straßenseite gewesen. Auch hier wohnten Menschen, die irgendwann nach Hause gingen; das bewiesen schon die wenigen Fenster, in denen noch Licht brannte. Manchmal hörte sie Stimmen oder leise Musik aus einem der oberen Stockwerke oder das Brummen eines Motors in der Ferne.
Sie betrat die Gasse, durch die gerade so ein Auto passen mochte, und erschrak. Im Schatten des ersten Hauseingangs rührte sich etwas Großes am Boden. Instinktiv wich Sophie zurück. Unverständliche Laute drangen zu ihr herüber. Ein bärtiges Gesicht tauchte auf und gleich darauf eine zum Mund geführte Flasche. Ein Clochard! Erleichtert, aber dennoch misstrauisch schlug sie einen Bogen um den Obdachlosen.
Als sie wieder nach vorne sah, verschwand die Gestalt im Mantel gerade in einem Gebäude auf der linken Straßenseite. Dahinter rührte sich nichts. Nur vereinzelt beleuchteten Laternen Teile der Gasse, die von Müll und Graffiti gesäumt war. Sophie wurde kalt. Wo war Rafe geblieben? Mit wachsender Verzweiflung rannte sie über das alte, unebene Pflaster. Sie hatte ihn sich nicht eingebildet. Er musste hier irgendwo sein!
Ihre Schritte hallten laut von den Wänden wider, von denen der Putz bröckelte. Es stank nach Unrat und Urin. Irgendetwas huschte vor ihr in eine Mauernische. Im Zwielicht hätte es ebenso gut eine Ratte wie eine Katze sein können. Sie wollte es lieber nicht wissen und schielte im Vorüberhetzen dennoch in jede dunkle Ecke, jeden Torweg, nur um vor weiteren in die Schatten gekauerten Clochards zu erschrecken.
Endlich erreichte sie das Ende der Gasse und sah sich rasch nach allen Seiten um. Nichts. Eine kaum breitere Straße, durch die eine Vespa surrte, bevor die Gegend wieder in nächtlicher Stille versank. Sophie spürte Tränen in ihre Augen steigen und kämpfte dagegen an. Ich hab mir die drei nicht eingebildet! Sie müssen in einem der Häuser sein.
Da sie im Gegensatz zu ihr nicht gerannt waren, konnten sie nicht viel weiter als bis zur Mitte der Gasse gekommen sein. Sollte sie die Obdachlosen fragen? Möglicherweise war einer von ihnen nüchtern genug, um ihr weiterzuhelfen. Aber war es klug, betrunkene Männer darauf aufmerksam zu machen, dass sie allein durch die Gegend irrte? Nicht alle Stadtstreicher waren romantische Ritter der Gosse, die sich ihre Ehre bewahrt hatten, und Geld konnten sie im Zweifelsfall alle brauchen. Nein, sie sprach besser niemanden an. Und ich sollte auch nicht länger hier stehen wie eine Bordsteinschwalbe, die auf Kundschaft wartet.
Sie holte tief Luft – nicht nur, um sich gegen den Gestank zu wappnen. Es fiel ihr schwer, die dämmerige Gasse noch einmal zu betreten. Sie kam ihr vor wie der Graben, in den ein schicksalhafter Regen sämtlichen Abschaum der Stadt gespült hatte. Was sagte es über Rafe und sie aus, dass es sie ausgerechnet hierher verschlagen hatte?
Schritte näherten sich die Straße herauf. Aus dem Augenwinkel sah Sophie eine einzelne Gestalt in dunkler Kleidung. Wer es auch sein mochte, sie wollte nicht angetroffen werden, wie sie mutterseelenallein herumstand und Wurzeln schlug. Fluchtartig stürmte sie los, dieses Mal ohne nach rechts und links zu blicken. Ein genöltes „Is’ jetz’ endlich mal Ruhe?“ ging im Stakkato ihrer Schritte so unter, dass sie es mehr ahnte als hörte. Erst als sie annähernd die Hälfte der Gasse hinter sich wusste, ging sie wieder langsam, lauschte, musterte Türen und Durchlässe, so gut es im Zwielicht möglich war. Ihr Körper spannte sich in der Erwartung neuer Schrecken. Warum zum Teufel tat sie sich das an? Sie konnte nicht einmal sicher sein, dass sie sich für den echten Rafe in Gefahr brachte. Noch hatte sie sein Gesicht nicht aus der Nähe gesehen …
Sie merkte auf. Was eben noch ein kaum wahrnehmbares Geräusch gewesen war, entpuppte sich als Stimme. Eine Stimme, die nun laut und zornig wurde. Andere fielen ein. Sophie schwankte zwischen Angst und Hoffnung. Sie wollte nicht in einen Streit geraten, der sie nichts anging, aber sie musste nachsehen, ob Rafe daran beteiligt war. Eilig hielt sie auf die Quelle der Stimmen zu, die nun wieder leiser wurden, als hätten sie gemerkt, dass sie unerwünschte Aufmerksamkeit erregten.
Sie drangen rechter Hand aus einem schmalen Durchlass, der in einen Hinterhof führte. Die Passage selbst war in tiefe Dunkelheit getaucht, doch dahinter konnte Sophie im Mondlicht mehrere Gestalten erspähen. Am hellen T-Shirt glaubte sie, Rafe wiederzuerkennen, und der Kerl, der gerade einen anderen Mann am Kragen packte, war eindeutig der mit der Halbglatze. Sophie schluckte nervös. Was nun? Instinkt und Vernunft hatten sich verbündet und raunten ihr zu, schleunigst zu verschwinden, doch ihr Herz weigerte sich. Ich muss wissen, ob es Rafe ist. Wenn nicht … konnte sie sich immer noch auf dem schnellsten Weg aus dem Staub machen.
Aber wie sollte sie Gewissheit bekommen? Seine Stimme! Es war möglich, dass er einen Doppelgänger hatte, aber dass der auch noch dieselbe Tonlage und einen deutschen Akzent hatte, das war ausgeschlossen.
Jetzt, da sie wieder leiser sprachen, musste sie näher heran. Wachsam pirschte sie sich in den Durchgang vor. Dort war es so finster, dass die Streithähne sie bestimmt nicht sehen würden, solange sie sich nicht zu weit vorwagte.
Ein schwaches Aufglänzen warnte sie gerade noch rechtzeitig, bevor sie über ein altes Fahrrad stolpern konnte, das jemand an die Wand gelehnt hatte. Sie schlich daran vorbei, bemühte sich, etwas zu sehen, bevor sie einen Fuß vor den anderen setzte. Wenn sie auch nur gegen eine einzige achtlos hingeworfene Coladose trat, waren die Typen hinter ihr her.
Allmählich hatten sich ihre Augen so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie jenseits des Fahrrads in der rechten Wand einen türbreiten Eingang ausmachen konnte, wo die Schatten noch schwärzer waren. Ein bedrückendes Gefühl warnte sie davor, dieser finsteren Höhle den Rücken zuzuwenden. Hatte dort nicht gerade etwas geraschelt? Sie hielt inne, doch in der Stille hörte sie nur die Stimmen aus dem Hinterhof deutlicher. War das wirklich Rafe? Verwundert wagte sie sich noch einen Schritt weiter, drückte sich an den leeren Türrahmen, als könne sie mit ihm verschmelzen und unsichtbar werden. Das kann nicht sein …
Im gegenüberliegenden Gebäude klaffte die dunkle Mündung eines breiten Torwegs, der vermutlich den Haupteingang zu diesem Hof darstellte. Ein paar Mofas und ein Auto parkten hier zwischen Mülltonnen und Regenrinnen. Sämtliche Fenster im untersten Stockwerk waren vergittert, die Wände stellenweise mit schwarzem Gekritzel verschmiert. Sophie zählte vier Männer, von denen sie einen an diesem Abend noch nicht gesehen hatte. Er schien ihr jünger als die anderen, und wenn das trübe Licht sie nicht täuschte, hatte er ein nordafrikanisch anmutendes Gesicht. Der Kräftige ließ ihn gerade wieder los, aber der Schmächtige stand schräg hinter ihm und verhinderte so eine überraschende Flucht. In ängstlichem Ton sprudelte der Junge etwas hervor, das nach Rechtfertigungen klang.
Der Mann, der wie Rafe aussah – was sie im Halbschatten wieder nicht genau erkennen konnte –, unterbrach ihn mit einer scharfen Bemerkung. Rafaels Stimme. Sophie hätte jeden Eid geschworen. Doch seit wann sprach er fließend Französisch? Während ihres Urlaubs in Paris hatte er kaum einen zusammenhängenden Satz herausgebracht und sich mit Latein als zweiter Fremdsprache entschuldigt. Jetzt klang er wie ein Einheimischer. Sollte sie sich doch getäuscht haben?
Der Schmächtige warf ebenfalls etwas ein, woraufhin der Glatzkopf eine barsche Frage stellte. Trotz mischte sich in die Antwort des Jungen. Sophie zuckte zusammen, als die Faust des Kräftigen vorschnellte. Prügel und Beschimpfungen prasselten auf sein Opfer ein, das sich krümmte und nur noch von dem Schmächtigen auf den Füßen gehalten wurde. Sie konnte nicht fassen, was sie sah. Der vermeintliche Rafe stand daneben und sah einfach nur zu! Rafe, der unbedingt Arzt hatte werden wollen, der Idealist, der nach Kolumbien geflogen war, um kostenlos malariakranke Kinder zu behandeln, sah ungerührt zu, wie ein Mann zusammengeschlagen wurde? Hier stimmte etwas nicht. Aber es war doch seine Stimme!
Empört löste sie sich von der Wand, um einzugreifen, als sich wie aus dem Nichts eine Hand auf ihren Mund legte. Zugleich umfasste sie von hinten ein Arm und zerrte sie rückwärts. Ihr Aufschrei geriet unter der fester zupressenden Hand zu einem dumpfen Ächzen.
„Klappe halten!“, fauchte es an ihrem Ohr.
Sie sah nur noch, wie der Junge zu Boden sank, als der Schmächtige ihn losließ, dann hatte der Angreifer sie schon einen halben Meter in den Eingang gerissen. Sie wand sich in seinem unnachgiebigen Griff, versuchte, ihn mit Ellbogen oder Fuß zu treffen, während er sie einen weiteren Schritt rückwärts zog.
„Halt still, wenn dir dein Leben lieb ist!“
Sie erstarrte. Das Herz schlug ihr bis in die Kehle hinauf. Hatte er ein Messer? Eine andere Waffe? Irgendetwas Kantiges hielt er in der Hand, die sie nicht sehen konnte. Mit der anderen verschloss er ihr nicht nur den Mund, sondern auch fast die Nasenlöcher. Überdeutlich hörte sie die Luft darin pfeifen, hörte auch seinen Atem, roch eine Spur von Rasierwasser und Zigarettenrauch. Draußen näherten sich Schritte, Dreck knirschte unter Schuhsohlen. Jemand knurrte etwas, das im Widerhall der Schritte unterging, als die Männer den Durchgang betraten. Rafe und seine Begleiter würden nur drei oder vier Meter an ihr vorbeigehen. Sie spürte, wie sich ihr Angreifer spannte.
„Keinen Laut!“, wisperte er und hielt den Atem an.
Sie wagte nicht, sich zu rühren. Wenn er ein Messer hatte, würde er schneller zustechen, als Hilfe bei ihr sein konnte – falls diese Schläger, dieser andere Rafe überhaupt auf die Idee kämen, ihr beizustehen. Zielstrebig marschierten sie im Halbdunkel vorüber, doch wie flüchtige Täter wirkten sie nicht. Sie schienen weder Entdeckung noch Verfolger zu fürchten. Erneut verwehrte das Dämmerlicht Sophie einen genaueren Blick auf Rafaels Gesicht. Dabei sah er sogar ungefähr in ihre Richtung, doch sogleich schob sich wieder Mauerwerk zwischen sie, und sie blieb gefangen in der Dunkelheit zurück.
Ihr Kopf war leer, als weigere er sich, auch nur darüber nachzudenken, was ihr bevorstand. Ihre Kehle wurde eng. Eine Träne rann über ihre Wange hinab, bis sie von der Hand des Fremden aufgehalten wurde. Noch immer drückte er ihre Lippen gegen die Zähne, schnitt ihr fast die Luft ab, sodass ihr Atem schnell und schnaufend ging.
„Du musst völlig verrückt sein“, murmelte er. „Was sollte das werden? Wolltest du dich umbringen lassen? Diese Kerle sind gefährlich.“
Was? Seine Worte verwirrten sie so sehr, dass sie im ersten Moment nur dastand und nach Luft schnappte, nachdem er sie losgelassen hatte. Plötzlich ging ihr auf, dass nichts mehr sie daran hinderte, die Verfolgung wieder aufzunehmen. Vielleicht konnte sie noch aufholen und … Sie kam nicht einmal bis in den Durchgang, bevor er sie erneut am Arm gepackt hatte.
„Scheiße, was soll das? Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?“
Sie sah sich nach ihm um, doch viel mehr als einen Umriss und einen helleren Fleck, wo sein Gesicht sein musste, konnte sie in der Finsternis nicht erkennen. „Lass mich los!“, fuhr sie ihn an. „Deinetwegen werde ich ihre Spur verlieren.“
„Vielleicht wäre das besser für dich.“
„Woher willst du das wissen?“ Erneut versuchte sie, sich loszureißen. „Du kennst mich doch gar nicht!“
„Aber ich kenne sie.“
Sophie hielt inne. „Du weißt, wer sie sind?“
„Das habe ich gerade gesagt, ja.“
„Und jetzt?“ Ihre Wut über den Schreck, den er ihr eingejagt hatte, verlieh ihr Mut. „Wirst du es mir verraten?“
In seinen Worten schwang ein schiefes Lächeln mit. „Kann ich dich dann loslassen, ohne dass du sofort wieder in dein Unglück rennst?“
Sie versuchte, endlich wieder klar zu denken. Wenn er ihr sagen konnte, wo Rafe wohnte, würde ihr das die gefährliche Tour durchs nächtliche Paris ersparen, von der sie schon jetzt mehr als genug hatte. Aber konnte sie ihm vertrauen? Zumindest klang er nett, und wenn er ihr Übles gewollt hätte, wäre er wohl längst über sie hergefallen. „Okay. Ich muss wissen, wo …“
Er gab ihren Arm frei, blieb aber so nah, dass sie niemals entwischt wäre, wenn sie es versucht hätte. „Ich muss erst mal nach dem Verletzten sehen.“
„O Gott, natürlich!“ Wie hatte sie das vergessen können?
Der Fremde drängte sich an ihr vorbei in den Durchgang und eilte auf den Hof. Sophie folgte ihm besorgt. Mechanisch rückte sie den Gurt auf ihrer Schulter wieder zurecht. Dass sie immer noch die Jacke in der Hand hatte, kam ihr grotesk vor, doch ihre Finger hatten sich hineingekrallt und lösten sich nur widerstrebend. Welche Nummer hatte der französische Notruf doch gleich? Wenn der Junge einen Krankenwagen brauchte … Erstaunt sah sie sich um. Bis auf sie selbst und den Fremden, der bereits hinter dem Auto und den Mülltonnen suchte, war der Hof leer. „Wo ist er hin?“
„Hat ihn wohl doch nicht so schwer erwischt. Mit ein paar Prellungen kann man immer noch laufen, wenn’s sein muss“, behauptete der junge Mann, den Sophie im Mondlicht endlich besser sehen konnte.
Der Typ im dunklen Mantel! „Du bist ihnen auch gefolgt!“ Ihr Blick glitt zu seiner Rechten, doch die Waffe musste er bereits eingesteckt haben. Er trug den Mantel offen und darunter Hemd und Hose – ebenfalls dunkel, aber in Stoff und Schnitt eher sportlich als elegant.
„Du hast einen Hang dazu, das Offensichtliche auszusprechen“, stellte er fest. Für einen Franzosen war er groß, aber bei Weitem kein Riese und dazu sehr schlank. Sein Gesicht wirkte trotz des Dreitagebarts hager, wozu die vollen Lippen einen sympathischen Kontrast darstellten.
„Ach ja? Und wann habe ich Ihnen eigentlich das Du angeboten, Monsieur …“
„Méric, Jean.“ Zu ihrer Überraschung reichte er ihr die Hand. Sie anzunehmen, war ein Reflex, den sie nicht unterdrücken konnte. „Und mit wem habe ich das Vergnügen, Mademoiselle? Oh, Verzeihung. Madame.“
„Madame?“ Sie folgte seinem Blick zu ihrer Linken. „Ach so, der Ring. Nein, ich bin nicht verheiratet. In Deutschland trägt man den Ehering rechts. Ich heiße Sophie Bachmann.“
„Sie sind Deutsche? Kaum zu glauben.“ Er lächelte. „Ich hab’s nicht rausgehört.“
„Danke.“ Geschmeichelt erwiderte sie das Lächeln, doch sie fühlte sich noch immer gehetzt. Wer war dieser Mann, und warum verfolgte er Rafe? Wäre es besser zu verschwinden, weil vielleicht doch jemand die Polizei gerufen hatte, die ihnen unangenehme Fragen stellen würde? Ganz abgesehen davon, dass sie sich gemütlichere Orte vorstellen konnte, um über ihre Aussprache zu plaudern.
„Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Wo wohnen Sie?“
Überrumpelt ließ sie sich von ihm aus dem Hof dirigieren. „Rue Jean de Beauvais“, antwortete sie, bevor er eine falsche Richtung einschlagen konnte. „Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Sie eigentlich sind. Ich meine, warum Sie hier sind.“
„Sie mir auch nicht“, stellte er nüchtern fest.
Wieder flackerte ihre Wut über die Angst und das Gefühl der Hilflosigkeit auf, das sie in seinem Griff empfunden hatte. Sie fuhr herum, um ihm ihren Zorn ins Gesicht schleudern zu können. „Haben Sie eine Ahnung, was für einen Schreck Sie mir eingejagt haben? Ich dachte, ich würde sterben! Es ist mein gutes Recht, ein paar Erklärungen zu verlangen.“
Er erwiderte ihren Blick ernst und beherrscht, doch in seinen Augen blitzte Ärger auf. „Es tut mir leid, dass ich grob werden musste, aber Sie waren im Begriff, einen schweren Fehler zu begehen. Diese Kerle hätten Sie ganz anders angefasst.“
Sophie presste die Lippen zusammen und wandte sich ab. Jean Méric wartete, bis sie von selbst weiterging. Es lag auf der Hand, dass er recht hatte. Verbrecher wollten keine Zeugen, und sie hatte keine Ahnung, wie die Männer auf ihre Einmischung reagiert hätten. Trotzdem saß ihr der furchtbare Moment noch zu sehr in den Knochen, um diesem Fremden dafür dankbar zu sein. „Warum waren Sie dort? Sind Sie so etwas wie ein verdeckter Ermittler?“
Er schnaubte. Hörte sie da Belustigung heraus? Sie warf einen Seitenblick auf sein Gesicht, doch darauf zeigte sich eher Verdruss.
„Das ist kompliziert.“ Als sie nur abwartete, fuhr er fort: „Sagen wir, dass ich den dreien gefolgt bin, weil ich wusste, dass sie nichts Gutes vorhatten. Ich … habe ein Gespür für so etwas.“
Sophie verzog das Gesicht. „Okay, vielleicht wollen Sie es mir nicht sagen, aber Sie müssen mich auch nicht für dumm verkaufen.“
„Heute Nacht haben Sie sich jedenfalls nicht besonders klug verhalten“, versetzte er lakonisch.
Wieder sah sie ihn an, doch auch jetzt zeigte er kein Anzeichen dafür, sich über sie lustig zu machen. „Ich habe meine Gründe.“
„Die haben wir alle.“
Und er hat ein spezielles Talent dafür, mich auf die Palme zu bringen. „Danke, ich habe begriffen, dass ich Ihnen auf die Nerven gehe. Sie mir auch. Können wir es dabei bewenden lassen und zum Wesentlichen kommen?“
„Und das wäre?“
„Ich muss wissen, wo ich den Mann im hellen T-Shirt finden kann.“
Er blieb so abrupt stehen, dass sie unvermittelt seinem Beispiel folgte und ihn verblüfft ansah. Sein Blick war finster, als hätte sie ihn schwer beleidigt. „Ausgerechnet den? Warum? Was haben Sie mit ihm zu schaffen?“
Sophies Gedanken überschlugen sich. War er doch ein Polizist und beschattete Rafe – oder seinen Doppelgänger –, weil jener in üble Machenschaften verstrickt war? Warum so viel Feindseligkeit? Er klang, als sei Rafe der Schlimmste der drei. „Das … das ist eine private Sache.“
„Mag sein, aber ich will sichergehen, dass Sie wissen, worauf Sie sich da einlassen.“
Das war eindeutig eine Warnung. Was in aller Welt geht nur hier vor? „Ich muss wissen, ob er der ist, für den ich ihn halte. Dazu muss ich ihn sprechen – allein natürlich. Mit den anderen Kerlen will ich nichts zu tun haben.“
Jean sah sie an, als sei sie vollkommen irre. „Dazu kann ich nur sagen, dass es ratsamer wäre, wenn Sie sich von ihm fernhielten. Jedes Wort, das Sie mit ihm wechseln, ist zu viel.“
Riskierte sie ihr Leben, wenn sie mit ihm sprach? Das war sicher übertrieben. Aber ihre Zweifel wuchsen. Konnte es hier wirklich um Rafael Wagner gehen, der niemals jemandem etwas antun würde? „Also schön, ich hab genug von diesen ganzen Andeutungen. Wissen Sie, wie lange sich dieser Mann schon in Paris aufhält? Ist er ein Verbrecher, den Sie seit Jahren dingfest machen wollen? Dann kann er nämlich nicht der sein, den ich suche. Ich habe ihn vor zwei Tagen zufällig auf einem Boot gesehen und glaubte, meinen Verlobten in ihm wiederzuerkennen.“
Jeans Brauen zuckten – überrascht? Doch seine Miene wurde unergründlich. „Er ist seit ein paar Wochen, höchstens zwei, drei Monaten hier.“
Sophie spürte ihr Herz stolpern. Er ist es! Er ist hier! „Sind Sie sicher? Ich dachte, er sei tot!“
„Heilige Mutter Gottes“, flüsterte Jean. Mitgefühl lag in seinem Blick, aber sie wartete vergeblich darauf, dass er ihre überschäumende Freude ein wenig teilte.
„Sie müssen mir sagen, wo er wohnt! Wenn er sich irgendetwas hat zuschulden kommen lassen, gibt es sicher eine Erklärung dafür. Ich kann …“ Sie brach ab, als er sie an der Schulter berührte und sanft zum Weitergehen drängte.
„Das ist nicht der richtige Ort, um über diese Dinge zu sprechen.“
Obwohl er leise und freundlich sprach, lag etwas in seiner Stimme, das ihre Begeisterung dämpfte. Er klang so bestimmt, dass sie ihren Weg fortsetzte und mit ihm den Place de la Contrescarpe überquerte. Aus der Bar, in der sie gewartet hatte, drang noch gedämpfte Musik. Auch wenn sich immer noch Leute auf der Straße herumtrieben, war es sehr viel leerer geworden, sodass sie froh war, nicht allein nach Hause gehen zu müssen. Doch die ernste Miene ihres schweigenden Begleiters beunruhigte sie von Minute zu Minute mehr.
„Warum freuen Sie sich so gar nicht mit mir? Was ist es, das Sie mir nicht sagen wollen?“
Er sah sie bedauernd an. „Sie sollten sich nicht zu früh freuen. Es mag den Anschein haben, als hätten Sie Ihren Verlobten wiedergefunden, aber die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen.“
„Sie sprechen schon wieder in Andeutungen“, beschwerte sie sich gereizt.
Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, bevor der undeutbare Ausdruck zurückkehrte. „Und Sie sprechen schon wieder das Offensichtliche aus.“ Er hob abwehrend die Hand, als sie den Mund zu einer ungehaltenen Antwort öffnete. Seine Stimme wurde so leise, dass sie sich anstrengen musste, um ihn über ihrer beider Schritte hinweg zu verstehen. „Bis jetzt war er für mich nur einer von vielen. Ich werde versuchen, mehr über die Angelegenheit in Erfahrung zu bringen.“
Montag! Noch nie hatte Sophie so gut verstanden, warum manche Leute Montage hassten. Nach nur drei Stunden Schlaf war ihr Magen verstimmt, ihr Mund ausgetrocknet – egal, wie viel sie trank –, und der Kopf brummte, als wäre sie volltrunken ins Bett getorkelt. Bestimmt sah sie grauenhaft aus. Madame Guimard hatte sie beim Frühstück missbilligend gemustert, aber nichts gesagt. Sophie war ihr dankbar dafür. Sie wollte die alte Dame nicht belügen, hätte aber nicht gewusst, was sie ihr erzählen sollte. Dass sie ihrem tot geglaubten Verlobten in abgelegene Gassen gefolgt war, wo er Streitigkeiten unter Gangstern ausfocht? Dass sie von einem Kerl in einen dunklen Hauseingang gezerrt worden und vor Angst fast gestorben war? Oder dass sie nicht wusste, wer dieser Mann eigentlich war, und sich dennoch heute Abend wieder mit ihm treffen wollte? Nein, die Wahrheit kam nicht infrage.
In der Mittagspause machte sie als Erstes ihr Handy an, das sie hatte ausschalten müssen, um den Akku zu schonen. Das Aufladen hatte sie wie immer vergessen. Keine Nachricht von Jean Méric. Einerseits war es gut, weil es wohl bedeutete, dass es bei ihrer Verabredung blieb. Andererseits kam ihr die vergangene Nacht so unwirklich vor, dass sie einen Beweis dafür brauchen konnte, dass alles nicht nur ein weiterer böser Traum gewesen war.
„Oh, là, là! Dein neuer Freund hält dich wohl ganz schön auf Trab, was?“, neckte Francesca, als sie Sophies enttäuschtes Gesicht sah.
Sophie grinste, um Zeit zu gewinnen. „Ja, ich hab nicht viel Schlaf bekommen.“
„Das ist nicht zu übersehen“, meinte Tereza kichernd. „Erzähl doch mal! Ist er Franzose?“
Francesca verdrehte die Augen. „Was soll er denn sonst sein? Chinese?“
„Warum nicht?“, verteidigte sich Tereza. „Sie wohnt im Quartier Latin! Da wimmelt es von Touristen und ausländischen Studenten.“
„Ja, volltrunkene Engländer mit dem Charme einer Bierflasche. Bäh!“ Die Italienerin winkte ab. „Oder Deutsche, bei denen der romantischste Satz noch wie ein Marschbefehl klingt … Oh, scusi, du bist ja Deutsche. Bei dir vergess ich das immer.“
Sophie beschloss, dass ihre gebeutelte Seele dringend einen emotionalen Schokoriegel brauchte, und zog Rafes Foto aus ihrem Portemonnaie.
Francesca riss es ihr förmlich aus den Fingern. „Das ist er? Che bello! Könnte fast ein Italiener sein.“
„Zeig her!“, forderte Tereza und drängte sich an ihre Freundin, um einen besseren Blick zu bekommen. „Italiener? Pah! Vielleicht auf einem Gemälde von Michelangelo, aber nicht in echt.“
„Er ist Deutscher und heißt Rafael“, warf Sophie ein.
„Nie im Leben!“, beharrte Francesca.
„Rafael? Wie in dem Lied von Carla Bruni?“ Tereza lächelte versonnen das Foto an, was Sophie ein unangenehmes Gefühl bereitete. Sie wusste immer noch nicht sicher, ob Rafe tatsächlich lebte, und es war eine Sache, einen verstorbenen Verlobten vorzuzeigen, als gebe es ihn noch, aber eine andere, wenn fremde Frauen ihretwegen das Bild eines Toten anschmachteten.
Ein paar Stunden später saß Sophie auf dem Bett und hatte das Foto erneut in der Hand. Rafe war darauf ausgesprochen gut getroffen. Er lächelte so natürlich in die Kamera, als gäbe es sie nicht, und das leicht gelockte, vom Wind zerzauste Haar hätte kein Stylist vorteilhafter frisieren können. Sie hatte ihn gern damit aufgezogen, dass es sein Bewerbungsbild für Hollywood sei – eine sichere Methode, um eine Balgerei zu provozieren, denn er hatte es gehasst, wenn jemand auf sein Aussehen anspielte. „Schönlinge kann niemand leiden“, hatte er manchmal gesagt und düster vor sich hin gestarrt, bis sie die Wolken an seinem Himmel verscheucht hatte.
Es tat weh, das Bild anzusehen. Wie oft hatte sie nach der Beerdigung genauso dagesessen und Tränen vergossen! Hatte sich gewünscht, er würde sie nur noch einmal so anlächeln. Schwer zu glauben, dass es bald Wirklichkeit werden könnte. Die Puzzleteile passten bis jetzt nicht zusammen. Aber sie konnten sich immer noch zu dem Bild fügen, das sie herbeisehnte. Dieser Jean musste ihr heute mehr verraten – sie würde sich nicht noch einmal mit Andeutungen abspeisen lassen.
Irgendwo in Madame Guimards Wohnung läutete das Telefon. Sophie fiel auf, dass sie nicht wusste, wo es stand, weil sie nur ihr Handy benutzte. Handy! Das war das Stichwort. Sie musste endlich den Akku aufladen, bevor … Der Blick aufs Display verriet ihr, dass sie ohnehin nur noch eine halbe Stunde Zeit hatte. So ein Mist!
„Sophie?“ Madame Guimards Stimme vermischte sich mit eiligen Schritten. „Es ist für dich!“
Verwundert sprang Sophie vom Bett, riss die Tür auf und stieß beinahe mit ihrer Vermieterin zusammen.
„Schnell, schnell!“, drängte Madame Guimard. „Deine Mutter ist dran.“
Sophie konnte sich ein Stöhnen nicht verkneifen, ließ sich aber ins Wohnzimmer scheuchen, wo der Hörer neben einem altmodischen Apparat mit Wählscheibe lag, der zum Stil der Einrichtung passte. „Ja?“ Es klang genervter, als sie beabsichtigt hatte, doch sie verspürte keine Reue. Wenn sie damit einen Streit vom Zaun brach, umso besser.
„Sophie, Kind! Wir haben gestern den ganzen Tag auf deinen Anruf gewartet. Wenigstens sonntags könntest du dich doch mal melden und uns sagen, dass es dir gut geht!“
„Das hatten wir nicht ausgemacht, oder?“ Die Frage war rhetorisch. Sie wusste sicher, dass sie in ihrem Zorn nichts dergleichen versprochen hatte.
„Das ist doch selbstverständlich! Wir sind deine Eltern. Wir machen uns immer Sorgen um dich.“
Manchmal auch mehr darum, was für euch schöner wäre. „Das ist nicht nötig. Es geht mir gut. Ich musste gestern für die Abschlussprüfung lernen und war abends noch aus.“
„Du treibst dich doch hoffentlich nicht nachts allein in dieser Stadt herum.“ Die Stimme ihrer Mutter wurde noch aufgeregter, fast schon schrill. „Letzte Woche haben sie wieder brennende Autos in diesen ban… diesen üblen Vororten gezeigt.“
„Du meinst die banlieus. Die sind meilenweit weg von der Innenstadt. Hier brennt nichts.“ Ihr Blick schweifte über die silbergerahmten Fotos auf der Kommode. Madame Guimards Familie war offenbar größer, als es den Anschein hatte.
„Man kann nie wissen. Heutzutage ist man nirgendwo mehr sicher. Vor zwei Monaten haben sie bei Katzes eingebrochen. Die wohnen nur zwei Straßen von uns! Das hatte ich dir doch erzählt. Der ganze Schmuck und das Geld waren weg.“
Sophies Gedanken schweiften ab. War das die junge Brigitte Bardot, die da mit einer ebenfalls jüngeren Madame Guimard für ein Foto posierte?
Ihre Mutter plapperte unbeirrt weiter. „Da fällt mir ein: Erinnerst du dich an Matthias, den Sohn von Katzes? Er lässt dir Grüße ausrichten.“
Jetzt geht das wieder los! „Schön für ihn. Ich bin nicht interessiert.“
„Aber er ist doch nett und hat einen guten Job bei …“
Sophie wurde kalt vor Wut. „Mama, ich bin gleich verabredet“, fiel sie ihr schneidend ins Wort. „Sag mir lieber, wie’s Papa geht.“
„Gut, wenn er sich nicht gerade Sorgen um dich machen muss. Mit wem gehst du denn aus?“ Wieder dieser schrille Unterton. Die Vorstellung, die einzige Tochter könne nun nach Paris auswandern, nachdem das Schicksal ihr gerade erst das Hamburg-Desaster erspart hatte, musste für ihre Mutter die Hölle sein.
Sophie war versucht, ihr an den Kopf zu werfen, dass sie Jean nachts in einer schlechten Gegend aufgegabelt hatte, aber dann würde das Telefon nicht mehr still stehen. „Mit einem gebildeten jungen Franzosen, der Rafael kennt.“ Zwei Spitzen in einem Satz. Das musste genügen. „Tschüs, Mama. Grüß Papa von mir!“
Sie legte auf, bevor ihre Mutter antworten konnte. Matthias Katz – war das zu fassen? Matz Katz, wie sie ihn seit dem Kindergarten nannte, hatte mit fünfundzwanzig schon einen Bierbauch und redete von nichts anderem als seinem mit Spoilern aufgemotzten 3er BMW, in dem ein ganzes Bündel Wunderbäume vom Rückspiegel baumelte. Ihr ist wohl alles recht, wenn ich nur in Hedelfingen wohnen bleibe. Und Matz Katz würde bestimmt niemals dort wegziehen.
Sophie wusste immer noch nicht, was sie von Jean Méric halten sollte. Auf dem Weg zu ihrer Verabredung rätselte sie erneut, was er wohl mit Rafe zu tun hatte. War er Kriminalbeamter oder arbeitete für die Staatsanwaltschaft? Die Nähe zum Justizpalast am Quai des Orfèvres auf der Île de la Cité, wo schon Simenons berühmter Roman-Kommissar Maigret ermittelt hatte, beflügelte ihre Phantasie. Etliche Spezialeinheiten sollten dort ihren Sitz haben. Ein Jurastudium hätte auch gut zu ihm gepasst. Nicht umsonst hatte sie ihn am Telefon als gebildet bezeichnet. Seine Aussprache und die Wortwahl hatten ihr verraten, dass er eine höhere Schule besucht haben musste, wenn nicht sogar eine Uni. Na ja, im Grunde kann es mir egal sein, solange er mir hilft, diese seltsame Geschichte zu verstehen, sagte sie sich und betrat den Place de la Contrescarpe.
Wie offenbar jeden Abend ging es rund um den Platz geschäftig zu. Sophie konnte kaum einen Unterschied zum Sonntag feststellen, außer dass ein wenig öfter ein Auto die Fußgänger von der Fahrbahn scheuchte. Was ihr jedoch sofort ins Auge stach, waren vier Polizisten in leuchtend hellblauen Hemden. Dass die Pariser Gendarmerie viel Präsenz zeigte, war ihr schon öfter aufgefallen. Ihr war, als würde bei der Auswahl der Beamten ein bestimmter Typ Franzose bevorzugt: mittelgroß, drahtig und in der Uniform schneidig anzusehen. Dass sie sich alle das meist braune Haar kurz scheren ließen, trug zum einheitlichen Eindruck bei. Nur die Frauen fielen durch Pferdeschwänze oder mittlere Haarlängen auf.
In diesem Fall blieb Sophies Blick allerdings nicht lange an den beiden Polizisten und deren zopftragender Kollegin hängen, die ein paar Schritte vor dem kleinen Lokal standen, in dem sie verabredet war. Stattdessen wanderte er zu dem vierten Beamten weiter, der mit einem der Gäste sprach. Verunsichert hielt sie inne. Der Mann, mit dem sich der Gendarm unterhielt, war Jean Méric.
Unschlüssig trat sie von einem Fuß auf den anderen. So spannend die Vorstellung, Jean habe mit der Polizei zu tun, eben noch gewesen war, so wenig Lust verspürte sie, mit ihm in Verbindung gebracht zu werden, falls er sich aus ganz anderen Gründen in der Pariser Unterwelt auskannte. Die Mienen der wartenden Beamten verhießen nichts Gutes. Sie schienen ungeduldig und bedachten Jean mit finsteren Blicken. Oder ärgerten sie sich nur, weil ihr Kollege sie aufhielt? Doch dieser wirkte locker, während Méric freundlich, aber ein bisschen angespannt aussah.
Allmählich kam sie sich dumm dabei vor, den über den Platz strömenden Menschen im Weg herumzustehen. Bestimmt würde sie jeden Moment den Polizisten auffallen, die sich dann fragten, weshalb sie sie anstarrte und sich so komisch benahm. Just als sie entschieden hatte, noch eine unverdächtige Runde um den Springbrunnen zu drehen, verabschiedete sich der Gendarm von Jean.
Sophie schlenderte trotzdem um die kleine, grüne Oase im städtischen Grau, bevor sie sich endlich in Jeans Nähe traute. Auch er sollte nicht merken, dass sie gewartet hatte, bis die Polizei abgezogen war. Oder hatte er sie bereits entdeckt? Offenbar nicht, denn er blickte ihr nicht entgegen.
Es war merkwürdig, ihn zum ersten Mal bei Tag zu sehen – als würde eine Figur aus einem Schwarzweißfilm plötzlich im echten Leben auftauchen. Sein Haar und der Dreitagebart waren dunkelblond, der Teint leicht gebräunt, aber vom Schlafmangel gezeichnet. Die Ärmel des weiten, anthrazitfarbenen Hemds hatte er aufgekrempelt, und seine Beine steckten in einer schwarzen Jeans, unter der ebensolche Socken und Lederschuhe hervorlugten. Gerade fischte er nach etwas in seiner Brusttasche, ließ aber sofort davon ab, als Sophie an seinen Tisch trat. Er sprang förmlich auf und reichte ihr die sehnige Hand. „Bonsoir, Sophie. Schön, Sie wiederzusehen.“
Ihr fiel auf, dass seine Kleidung zerknittert wirkte wie die eines Clochards. Hatte er etwa darin geschlafen? Doch es umgab ihn derselbe dezente Geruch nach Rasierwasser und Zigaretten wie in der Nacht zuvor.
„Setzen Sie sich doch“, bat er und deutete auf einen freien Stuhl, als sei sie nicht seinetwegen hier und könne weitergehen.
„Bonsoir, Jean.“ Sie kam der Aufforderung nach und musterte über den Tisch hinweg sein Gesicht. Sein Alter war so schwer zu schätzen wie seine Augenfarbe. Die lange Nacht und ein paar tief eingegrabene Linien um Augen und Mund machten ihn älter, aber sie glaubte nicht, dass er die dreißig überschritten hatte. Ihr wurde bewusst, dass sich nervöses Schweigen zwischen ihnen ausbreitete, doch ihr fiel nichts Belangloses ein, um es zu brechen. War es zu unhöflich, direkt zur Sache zu kommen?
Die Erleichterung entlockte ihr ein Lächeln, als eine Kellnerin auf ihren Tisch zuhielt. Die Frau hatte das ergrauende Haar im Nacken aufgesteckt und trug verwaschene Jeans unter ihrer Schürze. Ein enges T-Shirt gab ihre mollige Figur preis, doch es gelang ihr, salopp statt vulgär auszusehen. „Salut, Jean“, flötete sie und setzte mit einem Nicken ein fröhliches Hallo für Sophie hinzu. „Was darf’s sein?“
„Salut, Marie. Wie geht’s?“
Die Kellnerin machte eine vage Geste. „Ganz gut. Aber bei dir sieht’s besser aus“, befand sie und grinste Sophie an.
„Äh …“
„Sophie und ich haben etwas … Geschäftliches zu besprechen“, erklärte Jean hastig. „Sophie, darf ich Ihnen Marie vorstellen? Sie betreibt dieses Lokal.“
„Angenehm, Madame.“ Mechanisch reichte Sophie ihr die Hand.
„Ach, nennen Sie mich Marie! Das tun alle“, lachte sie.
„Haben Sie schon gegessen?“, erkundigte sich Jean bei Sophie.
Sie schüttelte den Kopf.
„Dann bring uns doch die Karte, Marie.“
„Das Getränk wie immer?“, hakte Marie nach.
„Ja, wie immer. Nehmen Sie auch Rotwein, Sophie?“
Sie nickte abwesend. Ihre Gedanken kreisten darum, was es zu bedeuten hatte, dass Jean ihre Angelegenheit als geschäftlich betrachtete.
Marie holte zwei abgegriffene Klappkarten aus Pappe von einem Tischchen beim Eingang und reichte sie ihnen, bevor sie im Innern des kleinen Restaurants verschwand.
„Die Galettes kann ich empfehlen. Maries Mann stammt aus der Bretagne und versteht sich wirklich darauf“, behauptete Jean, während sie die unzähligen Varianten dieser Spezialität des Hauses überflog.
Sophie versuchte, sich zu entspannen. Jean schien nicht gewillt, ihr über einen schnellen Drink hinweg die Informationen zu geben, die sie wollte, und nach der vergangenen Nacht konnte sie sich Schlimmeres vorstellen, als mit ihm zu Abend zu essen. „Dann nehme ich den mit Ziegenkäse und Salat.“
„Ausgezeichnet.“
Marie brachte vier Gläser, Rotwein und eine Karaffe Wasser, schenkte ihnen ein und nahm ihre Bestellung entgegen. Als sie zu anderen Gästen weiterzog, setzte das verunsichernde Schweigen wieder ein. Jean sah Sophie nachdenklich an. Ihre Ungeduld gewann wieder die Oberhand. Gereizt suchte sie nach einer höflichen Formulierung der Frage, was zum Teufel ihn denn nun mit Rafe verband.
„Mir sind einige Dinge noch nicht ganz klar“, sagte er plötzlich.
Ach! Sophie schnaubte. „Was glauben Sie, wie es mir geht?“
Er lächelte schief. „Das ist sicher alles verwirrend für Sie, aber ich weiß nicht, ob ich so viel daran ändern kann.“
Was sollte das nun wieder heißen? „Wenn das nicht Ihre Absicht ist, verschwenden Sie meine Zeit. Dann habe ich keinen Grund, hier zu sitzen.“
Sein geduldiger Blick besänftigte ihren aufflackernden Zorn. „Das bedaure ich, und wenn es mir möglich ist, werde ich Ihnen helfen. Aber ich kenne Sie nicht, also müssen Sie mir die Entscheidung überlassen, ob und wann ich Ihnen vertrauen kann.“
Er musste ihr vertrauen können? Sophie nahm einen Schluck Wein, um ihr Erstaunen zu überspielen. War er so etwas wie ein Polizeispitzel? Jemand, der sich inkognito in der Unterwelt bewegte und um sein Leben fürchten musste, wenn er enttarnt wurde? Doch dann hätte der Gendarm sicher nicht in aller Öffentlichkeit mit ihm gesprochen. Es sei denn, es gehörte zur Rolle, gelegentlich Ärger mit dem Gesetz zu haben, ohne deshalb im Knast zu landen …
„Sophie?“, unterbrach er ihre mit ihr durchgehende Phantasie. „Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.“
Also doch Ermittler. Oder Anwalt. „Woher soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann? Das setzen Sie einfach so voraus.“
Er zuckte die Achseln. „Ihnen bleibt nichts anderes übrig. Sie wollen schließlich etwas von mir, nicht umgekehrt.“
Daran war nicht viel zu rütteln. Sie konnte allein weitermachen, doch es war gefährlich, und da sich Rafe so unerwartet benahm, konnte sie nicht sicher sein, was geschehen würde, wenn sie ihm in einem unpassenden Moment in die Quere kam. „Na schön, ich gebe auf. Was wollen Sie wissen?“
„Wann ist Ihr Verlobter verstorben?“
Fehlt nur noch, dass er Papier und Bleistift zückt, um sich Notizen zu machen … „Angeblich am 11. April dieses Jahres.“
„Angeblich? Hatten Sie denn Grund zu der Annahme, dass er nicht tot sein könnte?“
„Nein, erst als ich am Freitagabend auf der Pont de la Tournelle stand und er unter mir auf einem Schiff vorbeifuhr.“
„Demnach sind Sie nicht nach Paris gekommen, um nach ihm zu suchen?“
Obwohl sie froh darüber war, wunderte sie sich über die Selbstverständlichkeit, mit der er ihre Worte hinnahm. Jeder andere hätte ihr einen Vortrag darüber gehalten, dass sie nur einen Doppelgänger gesehen haben konnte. „Wie ich schon sagte: Ich glaubte, er sei tot. Dass ich hier bin, hat eher … Ich hielt es einfach für eine gute Idee, alles zurückzulassen und mir in Paris einen Job zu suchen. Auslandserfahrung sammeln, Abstand gewinnen …“ Sie wollte „neu anfangen“ hinzufügen, weil es so schön ins Klischee passte, doch es wäre eine Lüge gewesen, deshalb verstummte sie und nippte erneut an ihrem Glas.
„Wenn Sie sicher waren, dass er tot ist, muss es Sie sehr überrascht haben, ihn hier zu sehen“, stellte Jean mitfühlend fest.
„Ja, es ist … bestürzend. Verunsichernd. Aber es weckt auch alle Hoffnungen, die ich begraben hatte.“
Er nickte. „Ich verstehe, dass Sie Gewissheit haben müssen. Sie wollen wissen, ob er Sie hintergangen hat oder das Schicksal nur einen grausamen Scherz mit Ihnen treibt.“ Bitterkeit vertiefte für einen Augenblick die Falten um seinen Mund. Er spülte sie mit einem Schluck Wein hinunter und sah Sophie wieder an. „Vielleicht bin ich der Einzige, der das für Sie herausfinden kann.“
Mehrere Fragen lagen ihr auf der Zunge, doch in diesem Moment kam Marie mit zwei vollgeladenen Tellern auf sie zu. Schwungvoll stellte sie einen mit Salat, gerösteten Brotkrumen und angeschmolzenem Ziegenkäse überhäuften Pfannkuchen vor Sophie ab. „Voilà, chèvre chaud.“
Heiße Ziege? Sophie musste schmunzeln. Solange sie nicht „heiße Zicke“ genannt wurde …
„Jean, dieser Typ, der uns immer wieder Ärger macht …“, begann Marie, brach jedoch ab, als Jean sie scharf ansah und kaum merklich den Kopf schüttelte.
Glaubt er etwa, ich hätte das nicht gesehen? Sophie konnte kaum abwarten, bis Marie wieder außer Hörweite war. „Hatte das eben etwas mit Rafael zu tun?“
Es enttäuschte sie, dass er keineswegs ertappt aussah, nur interessiert. „Ihr Verlobter hieß Rafael?“
„Ja, Rafael Wagner. Der Mann, den ich verfolgt habe … Er nennt sich wohl anders“, vermutete sie und begriff nicht, warum es sie so niedergeschlagen machte. Sie hatte nicht ernsthaft erwartet, dass er seinen wahren Namen verwendete, wenn er untergetaucht war.
Jean lächelte wie über einen Witz, den nur er verstand. „Sie sollten essen, bevor der Käse kalt wird. Und nein, es ging nicht um den Mann, den Sie suchen.“
Schweigend machte sie sich über ihre Galette her. „Warum fragen Sie nicht weiter?“, erkundigte sie sich nach einer Weile.
„Um ehrlich zu sein, wollte ich Ihnen nicht den Appetit verderben“, behauptete er. „Aber wenn Sie darauf bestehen.“
Kauend sah sie ihn über den Tisch hinweg an, und er erwiderte schmunzelnd ihren Blick. „Tue ich“, forderte sie ihn heraus, aber sie musste dabei lächeln.
„Wie ist er gestorben?“
Sophie ärgerte sich über sich selbst, als ihr schlagartig der Appetit verging. Trotzig stocherte sie weiter im Salat herum, doch sie bekam kaum noch etwas herunter. „Er wurde erschossen.“ Es befriedigte sie ein wenig, dass Jean offenbar mit etwas Unspektakulärerem gerechnet hatte, denn er hob überrascht die Brauen. „Zumindest haben das die kolumbianischen Behörden gesagt, und seiner Schwester – sie ist Ärztin – wäre wohl aufgefallen, wenn es keine Schussverletzungen an seiner Leiche gegeben hätte.“
Ich klinge völlig schizophren. Jean musste sie für verrückt halten. Wahrscheinlich hatte er in seinem Beruf lediglich gelernt, es besser zu verbergen als andere, damit sich die Irren beim Verhör angenommen fühlten und alles erzählten.
Er griff über den Tisch nach ihrer Hand und strich mit dem Daumen darüber. Es fühlte sich gut und tröstlich an, doch sie wollte sich nicht einlullen lassen. Womöglich war er nur darauf aus, Drogenhändlern auf die Spur zu kommen, und hielt Rafe für einen ihrer Komplizen.
„Er war Arzt.“ Abrupt entzog sie ihm ihre Hand. „Nicht weil er es auf Geld oder Prestige abgesehen hatte, sondern aus Berufung. Kolumbien war nicht sein erster humanitärer Einsatz, er hat sich schon als Student immer wieder an medizinischen Hilfsprojekten beteiligt. Nannte es einen guten Vorwand, um die Welt zu bereisen. Wir hatten sogar vor, für ein paar Jahre auszuwandern und …“ Ihre Kehle wurde eng.
„Glauben Sie an Gott?“
Verwundert blickte Sophie auf. „Nein … na ja … Dieses ganze Gerede vom lieben Gott ist doch eher etwas für Kinder. Ich weiß nicht. Wenn es einen Gott gäbe, hätte er Rafe nicht sterben lassen.“ Sie nahm nur am Rande wahr, dass Jean verständnisvoll nickte. Aber wenn Rafe lebt … Sie hatte ihn gesehen. Wenn es wahr wäre, dass er sich nur aus irgendeinem Grund verstecken musste, vielleicht gab es dann doch einen Gott.
„Sind Sie katholisch oder protestantisch?“, wollte Jean wissen.
„Äh.“ Was hatte das mit Rafe zu tun? „Ich bin katholisch getauft worden, aber in meiner Familie haben wir es nicht so mit der Kirche. Warum?“
„Nur aus Interesse“, antwortete er etwas zu schnell. „Hier in Frankreich ist man sehr katholisch, wissen Sie? Da macht man sich so seine Gedanken über Gott und das Sterben und all das.“
„Ich gebe zu, dass ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht habe, bevor Rafe … bevor er verschwunden ist.“
„Und jetzt sind Sie dem Thema gegenüber aufgeschlossener?“, hakte Jean nach.
„Irgendwie schon. Aber was bringt es, mich zu fragen, was nach dem Tod kommt oder ob das Ganze einen Sinn hat, wenn es mir niemand verraten kann? Das Gerede des Priesters bei der Beerdigung war schrecklich! Als hätten wir den schlimmsten Sünder auf Erden zu Grabe getragen. Das hatte alles nichts mit Rafe zu tun.“
Jean lächelte – über ihren Eifer? Oder ihren Unglauben? Sie konnte es nicht einschätzen.
„Sagen Sie, haben Sie noch Fragen, die mehr mit meinem Anliegen zu tun haben?“
Er schob seinen Teller ein Stück von sich, und ihr fiel auf, dass sie über dem Gespräch kaum wahrgenommen hatte, wie er ihn geleert hatte. „Nein.“
„Oh. Dann …“ Es kam so unvermittelt, dass sie nichts mehr zu sagen wusste. „Und wie geht es jetzt weiter?“
Belustigt zuckte er die Achseln. „Wir trinken einen Kaffee?“
„Sie sind unmöglich!“, lachte Sophie. „Sie wissen genau, was ich gemeint habe.“
„Hat’s geschmeckt?“, mischte sich Marie ein und räumte das Geschirr ab.
„Ja, sehr gut, danke.“ Sie bemühte sich, es wirklich begeistert zu sagen, um den ungegessenen Rest Lügen zu strafen. Jean bestellte Kaffee, und sie schloss sich an.
„Heißt das nun, dass Sie sich Ihr Urteil über mich gebildet haben, oder nicht?“, bohrte sie weiter. Sie konnte nicht leugnen, dass sie ihn irgendwie mochte, aber unter der Sympathie lagen ihre Nerven noch immer blank.
„Es geht nicht darum, ein Urteil über Sie zu fällen, Sophie“, erklärte er ernst. „Das maße ich mir nicht an. Ich versuche nur einzuschätzen, wie viel Wahrheit Sie vertragen können und ob Sie mir überhaupt glauben würden, wenn ich sie Ihnen erzähle. Die wenigsten Menschen können mit den Dingen umgehen, mit denen ich mich beschäftige, deshalb verdrängen sie, dass es sie gibt. Es ist manchmal leichter, etwas nicht zu genau zu wissen, um unbefangen weiterleben zu können.“
„Also wenn Sie jetzt von menschlichen Abgründen sprechen, halte ich das für übertrieben. Im Fernsehen werden uns doch tagtäglich die schlimmsten Verbrechen vorgeführt.“
„Glauben Sie mir, es ist ein großer Unterschied, ob man das Böse nur auf einem Bildschirm sieht oder ihm leibhaftig begegnet.“ Er sagte es mit solcher Überzeugung, dass sie schauderte. War Rafe in so Schreckliches verwickelt, oder sah sie nur so zartbesaitet aus, dass Jean ihr Details ersparen wollte?
Marie servierte zwei dampfende Tassen. Der Kaffeeduft verbreitete eine anheimelnde Atmosphäre, doch Sophie war nicht in der Stimmung, sie zu genießen. „Ich will alles erfahren. Ich habe ein Recht darauf, weil mein Leben zerstört wurde.“
Halb erwartete sie Widerspruch, aber Jean nickte. Wieder trat der verbitterte Zug um seinen Mund hervor. „Einverstanden. Geben Sie mir nur noch bis morgen Zeit. Ich werde mich heute Abend mit jemandem treffen, der mehr über die Angelegenheit weiß als ich.“
„Ich will mitkommen! Ich kann nicht noch einen Tag – und eine Nacht – mit dieser Ungewissheit leben.“
„Sie wissen ebenso gut wie ich, dass Sie das können, Sophie“, erwiderte er so nüchtern, dass sie sich albern vorkam. „Gehen Sie nach Hause und lassen Sie …“
Seine ohnehin leise Stimme erreichte ihre Ohren nicht mehr. Ihr Herz stockte.
Ademain, Sophie!« Jeans Worte drangen kaum mehr in ihr Bewusstsein als Durchsagen zwischen Kaufhausmusik.
„Ja.“ Sie blickte kurz zu ihm auf, ohne ihn wirklich anzusehen. „Ja, bis morgen dann.“ Ein Teil von ihr registrierte, dass er wegging, doch gegen Rafes Anblick verblasste es zur Bedeutungslosigkeit. Wie konnte er dort zwischen den Gästen des benachbarten Cafés sitzen und sich mit neuen Bekannten unterhalten, als wäre nichts, während sie – die trauernde Beinahe-Witwe – sich seinetwegen fast in die Seine gestürzt hätte?
Sie fasste ihn genauer ins Auge. Es war noch hell genug, um ihn auf zehn, höchstens fünfzehn Metern Entfernung gut zu erkennen. Wenn dieser Mann ein Doppelgänger sein sollte, musste Rafes Familie ihr einen eineiigen Zwilling verschwiegen haben. Alles passte: das Haar, das gewinnende Lächeln, das nahezu makellose Gesicht, in dem nur die Nase einen Tick zu groß war, um es als klassisch schön zu bezeichnen.
Es tat weh. Jede vertraute Geste bereitete Sophie einen ziehenden Schmerz in der Brust.
Und doch gab es Unterschiede. In seinen Zügen blitzte immer wieder etwas Überlegenes, Herausforderndes auf, das sie nicht an ihm kannte. Rafe war eher bescheiden und zurückhaltend gewesen. Im engsten Freundeskreis hatte er offen und herzlich sein können, aber niemals hatte sie ihn so … so überheblich gesehen. Ja, das traf es. Zum ersten Mal, seit sie ihn kennengelernt hatte, wirkte er selbstsicher bis zur Unverschämtheit. Wie er die anderen am Tisch taxierte, ihnen mit seiner Miene zu verstehen gab, dass ihr Geplapper ihn bestenfalls amüsierte …
Ihr wurde übel. Sie merkte erst, dass sie ihre Kaffeetasse umklammerte, als Marie neben ihr auftauchte.
„Geht’s dir nicht gut?“
Sophie riss sich zusammen. „Nein, schon gut. Kann ich dann bitte zahlen?“ Hatte Jean überhaupt bezahlt? Sie konnte sich nicht daran erinnern.
„Was? Um Himmels willen! Jean kündigt mir die Freundschaft, wenn ich dir Geld abknöpfe. Das geht auf seine Rechnung.“
„Davon hat er aber nichts gesagt“, protestierte sie halbherzig.
„Glaub’s mir einfach.“ Marie zwinkerte und trug Jeans Gläser und Tasse fort.
Sogleich kehrte Sophies Aufmerksamkeit zu Rafe zurück. Die Situation schien unverfänglich. Die Leute, mit denen er am Tisch saß, wirkten zwar nicht sympathisch – sie glaubte sogar, den Schmächtigen unter ihnen zu erkennen –, aber wenn sie sich als zufällig vorbeikommende alte Freundin ausgab, würde es Rafe doch sicher nicht in Schwierigkeiten bringen. Ihr Magen verkrampfte sich noch mehr. Nein, sie schaffte es nicht, einfach hinüberzugehen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Sie wollte ihn anschreien, ausflippen und heulen dürfen für das, was er ihr angetan hatte!
Jeans Warnung fiel ihr wieder ein. „Halten Sie sich von ihm fern! Jedes Wort, das Sie mit ihm wechseln, ist zu viel.“ Warum? Er saß dort drüben wie ein ganz normaler Mensch, der nach Feierabend ausging. Weshalb durfte sie nicht einfach hinübergehen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen?
Sie starrte ihn so intensiv an, dass er es gespürt haben musste, denn plötzlich trafen sich ihre Blicke. Anstatt zu lächeln, zu grüßen, irgendetwas zu tun, konnte sie ihn nur wie versteinert ansehen. Er zog die Brauen ein wenig zusammen, dann wandte er sich wieder ab. Sophie zitterte. In seinen Augen hatte kein Funke Erkennen aufgeleuchtet. Nichts deutete darauf hin, dass er wusste, wer sie war. Ihr war so kalt, dass sie wünschte, sie hätte ihre Jacke mitgenommen. Das ist nicht möglich. Nicht möglich. Niemand kann so gefühllos und berechnend sein. Es sei denn, es hätte niemals Liebe zwischen ihnen gegeben. Doch das konnte erst recht nicht sein.
Ihr war schwindlig. Beinahe gewaltsam riss sie den Blick von Rafe los, der unbekümmert mit der einzigen Frau am Tisch sprach. Sie sah aus wie ein billiges Flittchen, der Minirock zu kurz, die Lippen zu grell geschminkt. Keine Sekunde länger wollte Sophie riskieren, dass er vor ihren Augen zu flirten begann. Benommen stand sie auf und wandte sich zum Gehen. Eine dunkle Ahnung ließ sie aufblicken. Die Beine drohten unter ihr nachzugeben. An einem Baum beim Springbrunnen lehnte der Mann mit der Sonnenbrille.
Schlaflos wälzte sie sich in ihrem Bett herum. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, sah sie Rafe vor sich, wie er sie angeschaut und keine Regung gezeigt hatte. Musste es nicht irgendeine logische Erklärung geben, die ihn von jeder Schuld reinwusch? Eine Amnesie zum Beispiel, infolge einer schweren Kopfverletzung oder eines psychischen Traumas. Wäre das nicht auch ein plausibler Grund dafür, warum er sich völlig anders benahm und wie ein Franzose sprach?
Großer Gott! Ein erschossener Toter, Entführungen, Drogenhändler, verdeckte Ermittler, Amnesien und ausgerechnet Paris … Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen! Sie musste endlich aufhören, ihr Gehirn mit Dingen zu martern, die keinen Sinn ergaben, sonst würde sie noch durchdrehen. Doch immer, wenn sie an diesen Punkt kam, fingen ihre Gedanken von selbst an, erneut die Fakten ordnen zu wollen. Hilflos wusste sie die Nacht verstreichen, den Morgen und damit den Unterricht nahen.
Müdigkeit ließ ihre Überlegungen träge werden. Die Lider fielen ihr zu. Seufzend vergrub sie das Gesicht im Kissen – und fühlte einen Blick auf sich.
Alarmiert riss sie die Augen auf. Ihr Zimmer sah aus wie zuvor. Kein Schatten war tief genug, als dass sich dort jemand hätte verstecken können. Dennoch schlug ihr Herz so schnell, als sei sie gerade die Treppen heraufgerannt. Mit einem Mal wurde es dunkler im Raum, als hätte sich etwas vor das Fenster geschoben.
„Magische Lovestory.“
„Zum Verlieben schön!“
„Nach den Vampiren sorgen jetzt Engel für Herzflattern bei Fantasy-Fans. (…) In ›Der Kuss des Engels‹ heißt der gefallene Engel Rafael und die Frau, die sich auf eine verbotene Liebe mit ihm einlässt, Sophie. Autorin Sarah Lukas geht der Frage, ob das Böse in der Welt Gottes Werk oder Teufels Beitrag ist, noch raffinierter nach.“
„›Der Kuss des Engels‹ bietet spannende, intelligente Unterhaltung und herzergreifende Romantik.“







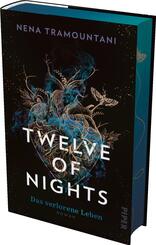




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.