
Der letzte Tango des Salvador Allende - eBook-Ausgabe
Roman
Der letzte Tango des Salvador Allende — Inhalt
Als am Morgen des 11. Septembers 1973 der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Augusto Pinochet, nicht auf seinen Anruf reagiert, ahnt Salvador Allende, dass seine Stunden als Präsident gezählt sind: Der Putsch steht bevor. Sein Koch und persönlicher Assistent, Rufino, hält die dramatischen Ereignisse in einem Tagebuch fest — und erzählt darin ihre gemeinsame Geschichte, von den abendlichen Gesprächen über das Leben, die Liebe und den Tango, von Allendes Liebschaften und den Sorgen um das Land. Jahrzehnte später gelangen diese Aufzeichnungen in die Hände von David Kurtz, einem ehemaligen CIA-Agenten. Wird es ihm mit ihrer Hilfe gelingen, den chilenischen Geliebten seiner Tochter aufzuspüren?
Leseprobe zu „Der letzte Tango des Salvador Allende“
1
Die weiße Pelerine flattert im morgendlichen Wind,
als der Doktor über die schmalen Gassen, Durchgänge
und Treppen schwebt, die sich bis zum Pazifik hinunterschlängeln.
Er passiert die rostigen, im Hafen vertäuten
Schiffe, setzt seinen luftigen Weg bis zu den bunten
Fischen im Brunnen auf der Plaza Echaurren fort und
bestaunt aus der Höhe nicht nur die großen Blätter der
hundertjährigen Palmen und die tosende Brandung an
den bereits von der rauen Strenge der hügeligen Landschaft
kündenden Felsen, sondern auch den weiten Bogen,
den sein eigener Flug beschreibt.
Ob [...]
1
Die weiße Pelerine flattert im morgendlichen Wind,
als der Doktor über die schmalen Gassen, Durchgänge
und Treppen schwebt, die sich bis zum Pazifik hinunterschlängeln.
Er passiert die rostigen, im Hafen vertäuten
Schiffe, setzt seinen luftigen Weg bis zu den bunten
Fischen im Brunnen auf der Plaza Echaurren fort und
bestaunt aus der Höhe nicht nur die großen Blätter der
hundertjährigen Palmen und die tosende Brandung an
den bereits von der rauen Strenge der hügeligen Landschaft
kündenden Felsen, sondern auch den weiten Bogen,
den sein eigener Flug beschreibt.
Obwohl ihm die Höhe seit der Kindheit Schwindel
bereitet und er das Gefühl hat, als schwirrten Kolibris
in seinem Magen herum, bringt ihn der Anblick
eines Schwarms dicht über dem Wasser dahingleitender
Pelikane zum Lächeln. Der Doktor atmet begierig
den Geruch der Algen ein und setzt seinen Flug bis zur
La-Matriz-Kirche fort, wo er versucht, seine Gamsledermokassins
neben dem Glockenturm aufzusetzen,
dessen Holzkreuz seit dem letzten Erdbeben schief
steht.
Seine Absicht, auf den Dachziegeln zu landen, wird
durch das peitschende Geräusch der aufflatternden
Tauben zunichte gemacht. Es dauert eine Weile, bis er
begreift, dass der Grund für sein Scheitern nicht die
Vögel sind, sondern das Läuten des Telefons, nach dem
er jetzt im dunklen Schlafzimmer tastet. Der Wecker
auf dem Nachttisch zeigt vier Minuten vor fünf an. Es
ist der Morgen des 11. September 1973. Er hält den Hörer
ans Ohr.
„Verdächtige Bewegungen der Marine in Valpara íso“,
verkündet eine Stimme.
Der Doktor knipst die Nachttischlampe an und
setzt sich die Brille auf, fest davon überzeugt, dass er
den Tag nicht überleben wird. Er ist allein in seinem
Schlafzimmer in der Avenida Tomás Moro 200 in Santiago
de Chile, weit entfernt von seinem Heimathafen
Valparaíso, in einem Zimmer, das eher an die karge
Zelle eines Franziskanermönches erinnert. Es grenzt
unmittelbar an die Bibliothek, wo ihn das marmorne
Schachbrett und – direkt neben der Tür zu der Terrasse
mit den maurischen Fliesen und dem Schwimmbecken
mit dem ausgestopften Krokodil – seine geliebte
Sammlung präkolumbischer Keramik erwarten.
Er bleibt völlig ruhig, denkt an das sanfte Lächeln seiner
Frau, die in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss
schläft. Er stellt sich Hortensias tiefen, rhythmischen
Atem vor. Er stellt sich vor, wie sie träumt, sie wären
wieder frisch verheiratet. Er stellt sich vor, wie sie
träumt, wieder das Bett mit ihm zu teilen. Er weiß, in
seinen Erinnerungen wird sie für immer die blasse,
schwarzhaarige Schönheit bleiben, deren blaue Augen
ihn vor mehr als vierzig Jahren verzauberten, an jenem
Abend, als er bei einem Erdbeben in Santiago panisch
aus einem Freimaurertempel hinaus auf die Straße gerannt
war.
„Etwas genauer bitte“, sagt der Doktor in den Hörer.
Seit er vor drei Jahren zum Präsidenten gewählt
wurde, vergeht kaum ein Tag ohne ein Gerücht über einen
bevorstehenden Militärputsch.
„Gestern Abend ist die Kriegsmarine ausgelaufen,
um an dem traditionellen Manöver mit der amerikanischen
Flotte teilzunehmen“, erklärt die Stimme am anderen
Ende.
„Das habe ich selbst genehmigt“, erwidert der Doktor
und reibt seine Füße in der wohligen Wärme unter
den Laken aneinander.
„Ja, aber die Flotte ist wieder da“, fügt die jetzt zitternde
Stimme hinzu. „Im Dunkeln sind die Schiffe
kaum zu erkennen, aber sie liegen in der Bucht und zielen
auf die Stadt. Sie können uns jederzeit unter Beschuss
nehmen.“
„Noch etwas, Genosse?“ Der Doktor steigt aus dem
Bett und schlüpft vor dem Kleiderschrankspiegel, der
ihm die leichte Wölbung seines Bauches und seine mageren,
blässlichen Oberschenkel vor Augen führt, aus
dem Pyjama.
„An den Kreuzungen der Innenstadt haben Marineeinheiten
Stellung bezogen. In Kampfmontur …“
„Haben Sie sich beim Marinekommando erkundigt?
“ Nachdem er den Lautsprecher am Telefon eingeschaltet
hat, bückt sich der Doktor nach der Unterhose
von gestern und streift sie über, ohne das Gleichgewicht
zu verlieren. Schnell nimmt er eine Hose, ein
Hemd und einen Pullover mit Rautenmuster aus dem
Schrank und zieht sich in aller Eile an.
„Bei der Marine geht niemand ran, Doktor.“
„Und das Verteidigungsministerium?“
„Auch nicht.“
„Was ist mit den Oberbefehlshabern?“ Er schlüpft in
ein Paar schwarze Schuhe.
„Da geht auch keiner ran, nicht mal zu Hause.“
„Ich fahre zum Regierungspalast.“ Der Doktor legt
auf und alarmiert über die Sprechanlage die Leibwächter.
Er rasiert sich auf die Schnelle, nimmt ein Tweedsakko
vom Bügel und begibt sich in die Bibliothek, wo
er nach der Kalaschnikow greift, die Fidel Castro ihm
einst geschenkt hat. Im Halbdunkel der Küche stürzt
er einen Schluck kalten Kaffee hinunter und eilt nach
draußen, wo vier blaue Fiat 125 und ein Lieferwagen
die Motoren warm laufen lassen. Laut röhrend verlässt
die Karawane das Grundstück. Kurz bevor die Wachposten
das Tor schließen, wirft der Doktor einen letzten
Blick auf die in der Dunkelheit verschwindende
weiße Villa mit dem Ziegeldach und den zwei Palmen,
die den Hauseingang säumen und über den Lauf der
Zeit zu wachen scheinen.
2
In a gadda da vida, honey
Don’t you know that I’m lovin’ you
In a gadda da vida, baby
Don’t you know that I’ll always be true.
In-A-Gadda-Da-Vida
Iron Butterfly
„Und das, Señor?“
Der Zollbeamte am Flughafen von Santiago de Chile
hielt mir das kleine graue Plastikgefäß vor die Nase.
„Asche“, erwiderte ich gelassen.
Der Beamte schraubte den Deckel auf.
„Asche?“ Er betrachtete den Inhalt. „Gehört das Ihnen?“
„Ja.“
„Würden Sie mir bitte folgen?“
Ich folgte ihm. Ein Vierteljahrhundert zuvor war ich
zum ersten Mal in dieses Land gereist, ohne dass mein
Gepäck kontrolliert worden wäre. Die Jungs von der
Botschaft hatten sich um alles gekümmert. Jetzt schiebe
ich meine Koffer an den Schlangen der wartenden Passagiere
vorbei, bis wir in ein Büro gelangen. Der Beamte
fordert mich auf, Platz zu nehmen, und verlässt
mit meinen Dokumenten das Zimmer.
Wenige Minuten später führt er mich zu einem Mann
in Anzug und Krawatte, der gelangweilt vor einem
Computer sitzt. Wahrscheinlich hat er gerade in einer
Interpoldatei meine Vorgeschichte überprüft. Auf seinem
Schreibtisch steht das Gefäß.
„Können Sie mir erklären, was das ist?“
„Asche.“
„Asche?“ Sein Blick verrät Misstrauen.
„Genau.“
„Asche von was?“
„Von Victoria“, erkläre ich.
Er räuspert sich verlegen, nestelt an seinem Krawattenknoten
herum und wirft einen mitleidigen Blick auf
den Behälter, bei dem es sich genau genommen um eine
kleine elfenbeinfarbene Urne handelt.
„Wer ist Victoria?“ Er zieht ein Taschentuch hervor
und schnäuzt sich lautstark. Der schnurgerade Scheitel,
der sein Haar teilt, gleicht einer Furche in einem pechschwarzen
Acker.
„Meine Tochter.“
„Ihre Tochter?“
„Ja.“
„Haben Sie eine Bescheinigung?“
Ich suche die Jackentaschen ab und reiche sie ihm.
Ein weiterer Beamter betritt das Büro.
„Keine Sorge, das ist reine Routine“, erklärt der Typ
hinter dem Computer, während der andere das Gefäß
nimmt und wieder aus dem Raum geht. „Was wollen
Sie mit der Asche Ihrer Tochter in Chile?“
„Sie hat eine Zeit lang hier gelebt.“ Meine Augen
werden feucht. „Eine glückliche Zeit.“
„Ich verstehe.“ Er sieht mich nachdenklich an. Dann
gibt er etwas in den Computer ein.
Eine Stunde später durfte ich mit meinem Gepäck
durch den Zoll. An einem Tisch im Café der Kette Au
bon Pain packte ich die Urne zurück in meinen Handkoffer
zu dem Schulheft mit dem Porträt von Vladimir
Iljitsch Lenin, dem Spanisch-Englisch-Wörterbuch von
Langenscheidt und den anderen Büchern und verließ
das Flughafengebäude auf der Suche nach einem Taxi,
das mich zu meinem Hotel bringen würde.
3
De mis páginas vividas
siempre guardo un gran recuerdo;
mi emoción no las olvida,
pasa el tiempo y más me acuerdo.
Tres amigos
Domingo Enrique Cadícamo, Rosendo Luna
Es war ein milder Morgen im Jahr 1971, als der Präsident
unser Viertel besuchte. Alle rannten auf die Straße,
um ihn mit roten und grünen Fahnen, Pauken und
Trompeten und viel Getöse zu begrüßen. Er kam in einer
Karawane aus blauen, tiefer gelegten Fiats mit breiten
Reifen, die bei ihrer Ankunft Staub aufwirbelten,
laut röhrten wie Rennwagen und den Kindern aufgeregte
Schreie und den Hunden fröhliches Gebell entlockten.
Der Präsident, der auf dem Rücksitz eines der Autos
gesessen hatte, stieg aus. Er trug eine Lederjacke mit einem
schwarzen Rollkragenpullover darunter. Die Anwohner
brüllten im Chor seinen Namen und stürmten
auf ihn zu, um ihn zu berühren, ihm die Hand zu
schütteln, etwas zu schenken oder eine Bitte an ihn zu
richten, während die hoch aufgeschossenen, Anzug,
Krawatte und dunkle Sonnenbrillen tragenden Leibwächter
ihn umringten und die Leute daran zu hindern
versuchten, ihm allzu nahe zu kommen.
Ich werde diesen Morgen nie vergessen. Die Hitze,
meine Aufregung, der blaue Himmel, das tiefe Glück,
das wir alle empfanden. Ich kann mich noch an jede
Einzelheit erinnern, den Duft der trockenen Erde,
den Schweiß der Leute, die Musik auf der Straße; und
weil ich Angst habe, eines Tages all das zu vergessen,
schreibe ich es in diesem in der Sowjetunion gedruckten
Schulheft mit Lenins Abbild auf. Die Hefte werden
an den staatlichen Schulen verteilt, da es schon seit einiger
Zeit kaum noch Papier gibt. Meins habe ich von einem
Nachbarn im Tausch gegen sechs Empanadas bekommen.
Von der Tür der Bäckerei aus sah ich dem
Empfang des Präsidenten zu. Ich trug Schürze, Mütze
und Leinenschuhe, und mein Gesicht war weiß von
Mehl, weshalb ich mich nicht traute, zu ihm zu gehen.
Auf einmal drehte sich der Präsident um und ging
in die entgegengesetzte Richtung auf einen Lieferwagen
zu, auf dessen Ladefläche eine Folkloregruppe in
schwarzen Ponchos sang und wo er später eine Rede
halten würde, in der es darum ging, dass die Arbeiter
die Produktion in den Betrieben aufrechterhalten
müssten.
Er verteilte hier einen Händedruck, da ein aufmunterndes
Wort, ging mit geradem Rücken und erhobenem
Haupt, während die Leute ihn hochleben ließen
und die Kinder und Hunde zwischen den Beinen der
Erwachsenen herumtollten.
„Was macht die Brotproduktion, Genosse?“, fragte
mich der Präsident und kam auf mich zu; vielleicht
hatte ihn die strahlend weiße Bäckerkleidung oder der
Duft von warmem Brot angelockt. Er drückte mir die
Hand und umarmte mich, bis seine elegante Lederjacke
weiß von Mehl war.
„Ich backe gerade das Brot fürs Mittagessen, aber ob
es noch welches zum Abendessen gibt, weiß ich nicht“,
erwiderte ich, während ich ihm unter den misstrauischen
Blicken der Leibwächter das Mehl vom Revers
klopfte.
„Und was sollen die Genossen am Nachmittag zum
Tee essen?“, fragte er mich ernst.
„Nur Tee, sonst nichts, Herr Präsident. Wenn die
Läden überhaupt noch Tee haben.“
„Kein Brot?“
„Aber wenn es doch kein Mehl mehr gibt, Herr Präsident.
Womit soll ich denn den Teig kneten?“, antwortete
ich frei heraus, doch ohne es an dem nötigen Respekt
fehlen zu lassen. Im gleichen Moment stieß mich
einer der Leibwächter unauffällig mit dem Ellbogen in
die Rippen.
„Wir müssen etwas gegen den Schwarzmarkt unternehmen,
Genosse“, erklärte der Präsident. „Sonst nutzt
der Feind das aus und macht uns fertig.“
„Erinnern Sie sich nicht mehr an mich, Herr Präsident?“
Er schob den Leibwächter, der zwischen uns getreten
war, zur Seite und heftete seine kleinen, lebhaften
Augen auf mich. Hinter den dicken Gläsern seiner
schwarzen Brille konnte ich deutlich seine kaffeebraunen
Pupillen erkennen.
„Wie heißt du?“, erkundigte er sich inmitten der
Hochrufe und Rempeleien der Anwohner, während
ihm eine alte Frau eine frittierte Empanada hinhielt und
ein blinder Akkordeonspieler ihm einen Brief in die
Hand drückte.
Ich nannte meinen Namen, aber er zeigte keine Reaktion.
Schlimmer noch, ich hatte den Eindruck, dass
er im Grunde nur seinen Weg fortsetzen und zu dem
Lastwagen gehen wollte, auf dem gerade das Konzert
der Charangos, Pauken und indianischen Flöten zu
Ende ging. Schnell fügte ich hinzu:
„Erinnern Sie sich nicht an Juan Demarchi?“
„Den anarchistischen Schuster?“, fragte der Präsident
überrascht.
„Genau den.“
„Natürlich erinnere ich mich“, rief er mir winkend
zu, während ihn die Menge fortriss. „Das war der
Lehrmeister meiner Jugend. Er hatte seine Werkstatt
auf dem Cerro Cordillera in Valparaíso.“
„Ich bin der Cachafaz“, schrie ich aus voller Lunge
und mit einer gehörigen Portion Stolz. „Können Sie
sich jetzt erinnern?“
Der Präsident war zu einem Schiffbrüchigen geworden,
der immer weiter abgetrieben und von der Strömung
zu der improvisierten Bühne mitgerissen wurde.
Ich blieb unter dem Baum stehen, der meiner Bäckerei
Schatten spendete. Erst viel später, als ich das Brennholz
für den nächsten Backgang schichtete, trat ein Mann in
Anzug und Krawatte und einer Sonnenbrille auf der
Nase vor meinen Tresen und fragte nach dem Cachafaz.
„Zu Ihren Diensten.“ Ich klopfte mir das Mehl von
den Händen.

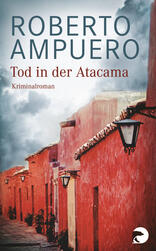

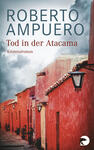
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.