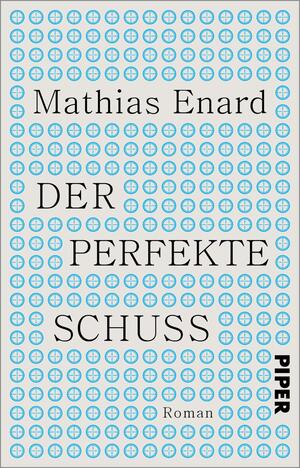
Der perfekte Schuss — Inhalt
Erschütternd, verstörend, eine grandiose Zumutung
Er ist zwanzig, der beste Scharfschütze der belagerten Stadt. Wenn er von seinem Posten auf dem Dach heruntersteigt, genießt er die Angst, die er verbreitet. Furchtlos ist nur Myrna, das Mädchen, das für seine demente Mutter sorgt – das er beschützen und besitzen will. Dies ist ein Roman über den Krieg aus der Perspektive eines Mörders, der sein Selbstwertgefühl aus der Eleganz seiner Treffer zieht. Ein erbarmungsloser Text über die sich verselbstständigende Realität des Krieges.
„Ein Meisterwerk von einzigartiger sprachlicher und kompositorischer Konsequenz … Atemberaubend!“ Deutschlandfunk Kultur
„Ein literarisch glänzender Beitrag zur Psychologie des Krieges.“ BR2
„Man kann nicht mehr aufhören zu lesen, denn dieser Protagonist lässt einen nicht mehr los.“ NZZ am Sonntag
Leseprobe zu „Der perfekte Schuss“
Das Wichtigste ist der Atem. Das ruhige und langsame Ein- und Ausatmen, die Geduld des Atems. Zuerst muss man auf seinen Körper hören, auf seinen Herzschlag, Arm und Hand ruhig halten. Das Gewehr muss zu einem Teil des eigenen Körpers werden, seine Verlängerung.
Selbst das Ziel ist untergeordnet, wichtig ist die eigene Person. Man muss sich um den Platz kümmern, ob man sich auf einem Dach oder hinter einem Fenster befindet, ist egal, man muss die Stellung beherrschen, sie ganz vereinnahmen. Nichts stört mehr als eine Katze, die plötzlich hinter einem [...]
Das Wichtigste ist der Atem. Das ruhige und langsame Ein- und Ausatmen, die Geduld des Atems. Zuerst muss man auf seinen Körper hören, auf seinen Herzschlag, Arm und Hand ruhig halten. Das Gewehr muss zu einem Teil des eigenen Körpers werden, seine Verlängerung.
Selbst das Ziel ist untergeordnet, wichtig ist die eigene Person. Man muss sich um den Platz kümmern, ob man sich auf einem Dach oder hinter einem Fenster befindet, ist egal, man muss die Stellung beherrschen, sie ganz vereinnahmen. Nichts stört mehr als eine Katze, die plötzlich hinter einem vorbeistreicht, oder ein Vogel, der auffliegt. Man muss ganz bei sich sein, nirgendwo sonst, das Auge am Fernrohr, den stählernen Arm aufs Ziel gerichtet, bereit zu treffen. Von meinem Dach aus übersehe ich die Bürgersteige, spähe die Fenster aus, schaue den Leuten beim Leben zu. Mit einem Druck auf den Abzug bin ich bei ihnen. Es ist nicht einfach, im Gegenteil, es ist ein schwieriges Geschäft, das Präzision und Konzentration erfordert. Alle denken immer nur an den Schuss und was er bewirkt. Sie wissen nicht, dass ich ihren Herzschlag durch meinen gehört, dass ich jede Gefühlsregung ausgeschaltet habe, dass ich den Atem anhalte, unmittelbar bevor ich abdrücke, wie man so sagt, aber ich drücke nichts ab, im Gegenteil, ich entriegle einen Metallhahn, der schlägt auf ein Zündhütchen, das die Treibladung entzündet, die wiederum ein Projektil aus dem Lauf schleudert, das bis zu zwölfhundert Meter weit fliegt und jemanden tötet. Oder auch nicht. Manchmal geht der schönste aller Schüsse daneben, es gibt Unwägbarkeiten, Hindernisse, die sich zwischen den Schützen und das Ziel stellen; ein Windstoß kann unmerklich an der Waffe eines Scharfschützen rütteln, ein Geräusch auf der Straße kann ihn ablenken, eine Explosion oder ein Motorgeräusch ihn überraschen. Doch der Schuss selbst ist nie der Grund. Ich schieße nur, wenn ich sicher bin. Ich schieße wenig. An manchen Tagen schieße ich einen Vogel ab, nachdem ich ihn eine Stunde dabei beobachtet habe, wie er durch die Lüfte segelte, so lange brauche ich zur Vorbereitung, um seine Flugstrecken zu kennen, um zu verstehen, wie sich die Luftmasse unter seinen Flügeln bewegt, um seine Entfernung, seine Flugbahn einzuschätzen. Normalerweise ziele ich auf den Flügel und sehe zu, wie er trudelnd abstürzt, oder ich versuche ganz nahe an dem Vogel vorbeizuschießen, ohne ihn zu berühren,
ein Streifschuss. Dann fällt er ebenfalls herab. Wenn sie hoch genug fliegen, bekommen einige die Kurve, bevor sie auf den Boden aufprallen, doch die meisten stehen unter Schock und zerschmettern. Das ist ein gutes Training. Niemand schießt so gut wie ich, weil ich wenig schieße. Nie mehr als zehn Patronen an einem Tag. Nicht, dass ich mir ein Limit gesetzt hätte. Ich schieße einfach nur, wenn ich sicher bin. Die ganze Arbeit liegt davor.
Keine Ahnung warum, aber ich erinnere mich an jeden meiner Schüsse. Ich verwechsle sie nicht, sie sind alle verschieden. Ich suche mir nur die schwierigen aus. Zu Beginn, als ich Anfänger war, habe ich mich aufgeführt wie alle anderen, aber damals ging es darum, meine Mittelmäßigkeit zu verbergen. Ich suche mir nur die schwierigen Schüsse aus, weil die Freude dann größer ist. Schützen, die das nicht begreifen und auf alles schießen, was sich bewegt, sind Idioten.
Mir kommt es vor, als wäre ich schon immer Scharfschütze gewesen, doch ich mache das erst seit knapp drei Jahren, und wenn ich an meine Anfänge denke, schäme ich mich. Man kann alles lernen. Mein erster Abschuss zu Beginn des Krieges war ein Mann, der ein Taxi steuerte. Ich meinte ihn getroffen zu haben, denn der Wagen fuhr geradewegs gegen eine Wand. Ich wartete für den Fall, dass der Fahrer aussteigen würde, ich zitterte, richtete mein Gewehr nach allen Seiten, um zu sehen, ob ihm jemand zu Hilfe käme, ballerte zwei Kugeln aufs Geratewohl in die Autotür links vorn, er stieg natürlich nicht aus und niemand näherte sich. Ich hatte Tränen in den Augen, ich wusste nicht, was ich tun sollte; wegen des Autodachs, das mir die Sicht versperrte, sah ich nicht einmal, ob der Mann blutete, und geriet auf meinem fünfhundert Meter entfernten Gebäude in Panik. Eine Wirkung des Zielfernrohrs. Ich hatte das Gefühl, bei ihm zu sein, und wusste nicht mehr, ob ich der Scharfschütze war oder derjenige, auf den geschossen wurde. Ich hatte Angst, klemmte hinter meinem Gewehr, als könnte es mir die Augen dafür öffnen. Erschwerend kam hinzu, dass rechts von dem Wagen ein ziemlich hohes Haus stand und mir den Blick auf die Fahrertür versperrte. Jemand kam plötzlich im Laufschritt auf meinen toten Winkel zugelaufen, ich schoss reflexhaft, weil sich etwas bewegte, verfehlte ihn natürlich und traf das Auto, denn ich hatte noch nicht begriffen, dass man beim Blick durch das Zielfernrohr schlecht einschätzen kann, wie weit die Dinge voneinander entfernt sind. Ich war gezwungen, nachzuladen, und verlor dabei die Szene aus den Augen; da ich nicht aufgepasst hatte, wohin ich gezielt hatte, brauchte ich eine Weile, bis ich in meiner Panik den Wagen zwischen den Häusern wiederfand. Ich schwitzte, es war heiß,
Sommer, der Krieg hatte gerade angefangen, und weil mir der Schweiß von der Stirn rann, konnte ich nicht durchs Zielfernrohr blicken. Als ich die Stelle wiedergefunden hatte, wartete ich eine Viertelstunde, aber niemand kletterte auf der Beifahrerseite des Autos heraus. Ich war frustriert, ich wusste nicht, ob der Mann tot war, ob ich oder der Unfall ihn getötet hatte. In diesem Moment kam ich mir wie ein Feigling vor, denn ich hatte mir das schwierigste Ziel ausgesucht, einen zu drei Vierteln verdeckten Mann in einem fahrenden Auto. Eigentlich wollte ich ihm, glaube ich, eine Chance lassen. Aus Feigheit. Entweder schießt man oder man schießt nicht. Man muss sich entscheiden, sonst ist man ein Feigling. Aber das habe ich erst später begriffen.
Schweigend beobachte ich die Stadt. Man muss bis zum Äußersten gehen. Wenige können das. Sie gehen nur den halben Weg, manchmal ohne es zu wollen, weil es sie packt, wenn sie
durch das Visier ihrer tödlichen Waffe blicken. Alle sehen das Blut und den Schmerz, ohne zu verstehen, dass es noch etwas anderes gibt, ein flirrendes Mysterium, etwas wie eine Schwelle, wie eine Hängebrücke, die leicht im Wind schaukelt. Dieser Moment gehört mir. Auf dieses Intervall zwischen dem Drücken des Abzugs und dem Auftreffen der Kugel arbeite ich hin. Unbeeindruckt verschwinde ich in der Distanz zwischen mir und dem anderen. Dieses Verschwinden erfüllt mich. Es ist ein irres Vergnügen, man muss seiner würdig sein, es herbeiführen können.
Immer wenn ich sie betrachtete, wusste ich, dass sie im Grunde Angst hatte. Sie sah nur, worauf der Schuss abzielte, den Tod und alles, was sich daran anschließt. Doch jeder stirbt,
was kann ich dafür? Jetzt spüre ich ihren Puls nicht mehr so stark und nicht mehr so deutlich wie hinter meinem Zielfernrohr, ich bin nur an ihrem Körper, und sie entschwindet, ihr
Gesicht, das viel zu nahe ist, löst sich beinahe auf. Die Spannung, die Kraft, die Begierde hinter der Waffe kann sie sich nicht vorstellen. Sie versteht es nicht. Vielleicht ist es das Los
großer Künstler, unverstanden zu sein. Keine Ahnung.
Zu Beginn des Krieges hatte ich dieses russische Gewehr, das mir nicht richtig behagte, aber ein anderes war nicht aufzutreiben. Ich konnte noch nicht einmal richtig das Korn einstellen,
selbst ein stehendes Ziel in hundert Metern Entfernung traf ich nur mit Mühe. Aber ich lerne schnell, also lernte ich, damit umzugehen. Ich habe bei diesem verdammten Gewehr vielleicht zweihundert Mal das Visier eingestellt, bevor ich es kapierte. Und dann haben sie mir nach zwei oder drei Monaten, als inzwischen überall gekämpft wurde und sie merkten, dass
ich ein ausgezeichneter Schütze war, eine echte Waffe gegeben. Als Gegenleistung bat mich der Offizier, der sie mir brachte, jemanden zu töten, der seiner Frau nachstellte, einem fetten
Weib, die keiner, der bei Verstand war, gewollt hätte. Ein guter Schuss, mit der alten Russin, denn das neue Gewehr war noch nicht eingeschossen. Ich habe ihn vor seiner Haustür mitten ins Herz getroffen, direkt unter der linken Schulter. Damals waren meine einzigen Freunde, ihrer Bedeutung nach geordnet, mein Gewehr, das Meer und Zak. Stundenlang habe ich von meinem Dach aus das Meer betrachtet. Es hat mir immer gefallen, dabei bin ich keineswegs romantisch veranlagt. Das Meer wechselt die Farbe, es wogt oder ist reglos.
Im ersten Kriegsjahr zum Beispiel hat es sich überhaupt nicht bewegt, kaum dass es sich ab und zu kräuselte. Es war den ganzen Tag über blendend blau, und nicht einmal nachts konnte man es hören. Einmal sind wir an den Felsen unterhalb des Leuchtturms baden gegangen, Zak und ich, bei Nacht, das Wasser war fast so warm wie die Luft. Wie in der Badewanne. In den Bergen fielen Bomben und wir waren im Wasser, machten den Toten Mann und genossen das Schauspiel. Wir blieben nicht lange im Wasser, weil wir Angst hatten, irrtümlich als nackte Idioten unter Beschuss zu geraten. Aber wir fühlten uns gut, als wir herauskamen, man konnte sich fast einbilden, es sei kühl. Danach sind wir an die Front zurückgekehrt und ich bin wieder auf das Dach geklettert. Ich war sozusagen den ganzen Sommer draußen, meine Mutter sah mich nur ein oder zwei Mal. Sie war schon halb verrückt, bekam gar nichts mehr auf die Reihe. Sie fragte mich bloß, ob es immer noch welche gebe, die man töten müsse. Die Nachbarin, die sich um sie kümmerte, hatte Angst vor mir, und das gefiel mir. Sie nannte mich einen Mörder. Damit sie den Mund hielt, genügte es, wenn ich ihr geradewegs in die Augen sah und dabei zweimal mit meinem Siegelring auf den Stahl meines Gewehres klopfte. Tak, tak. Schweig. Du hast keine Ahnung. Du brauchst mich, um dich zu verteidigen. Das sagte mein Gewehr. Du verachtest mich, aber du bist gezwungen, mich zu unterstützen. Es ist Krieg, muss ich dir das extra sagen? Wäre es dir lieber, wenn jemand anderes, ein Fremder, oben auf dem Dach säße und dich durch sein Zielfernrohr ansähe? Denk an mich als einen Schutzengel. Sie bekam immer mehr Angst. Sagte, sie habe gehört, man würde sogar auf die









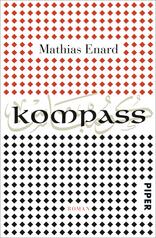

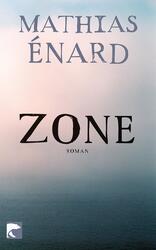








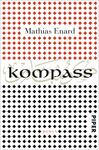

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.