

Der Zeitkrieg (Kantaki 3) Der Zeitkrieg (Kantaki 3) - eBook-Ausgabe
Die Kantaki-Saga 3
Der Zeitkrieg (Kantaki 3) — Inhalt
Ein gewaltiger Krieg bedroht die Galaxis – entfesselt von einer uralten feindlichen Spezies, die unwissentlich von Rungard Avar Valdorian aus ihrem Gefängnis befreit wurde. Doch der ehemalige Herrscher über das Konsortium ist nicht länger bereit, den Feinden wie ein Sklave zu dienen – und entschließt sich zur Flucht. Wird es ihm und den Kantaki, den einzigen, die dem Gegner überhaupt noch etwas entgegenzusetzen haben, gelingen, die Temporalen zurückzuschlagen? „Eine Space Opera, die ihresgleichen sucht!“ Phantastik-Couch
Leseprobe zu „Der Zeitkrieg (Kantaki 3)“
Prolog
Alle Farben: Transraum, 23. November 499 SN
Ist dies der Tod?, fragte sich Diamant, ohne eine Erinnerung ans Sterben.
Eben hatte sie noch im Pilotensessel von Vater Grars Schiff gesessen, die Hände in den Sensormulden, das Bewusstsein verbunden mit den Bordsystemen des riesigen Kantaki-Schiffes, das sich wie eine Erweiterung ihres Körpers anfühlte. Und nun schwebte sie plötzlich in einem grauen Nichts, umgeben von einer Leere, die mehr darstellte als die Abwesenheit von Dingen.
In dieser Leere, so fühlte Diamant, fehlten Raum und Zeit. Wie sie [...]
Prolog
Alle Farben: Transraum, 23. November 499 SN
Ist dies der Tod?, fragte sich Diamant, ohne eine Erinnerung ans Sterben.
Eben hatte sie noch im Pilotensessel von Vater Grars Schiff gesessen, die Hände in den Sensormulden, das Bewusstsein verbunden mit den Bordsystemen des riesigen Kantaki-Schiffes, das sich wie eine Erweiterung ihres Körpers anfühlte. Und nun schwebte sie plötzlich in einem grauen Nichts, umgeben von einer Leere, die mehr darstellte als die Abwesenheit von Dingen.
In dieser Leere, so fühlte Diamant, fehlten Raum und Zeit. Wie sie trotzdem darin existieren konnte, blieb ein Rätsel, aber wichtiger erschien ihr die Frage, ob sie noch lebte.
Etwas veränderte sich um sie herum. Das Grau kontrahierte, zeigte dabei hier und dort erste Farben. Bilder entstanden, und Diamant sah ihr Leben – jeder Moment ein einzelnes Bild, zum Greifen nahe und doch weit entfernt, Szenen einer inzwischen zweihundertdreiundzwanzig Jahre dauernden Existenz.
Sie sah sich selbst als Lidia DiKastro, Studentin der Xenoarchäologie auf Tintiran. Sie sah sich in Begleitung des Magnatensohns Valdorian, der glaubte, Entscheidungen für sie treffen zu können, der sie besitzen wollte. Sie sah, wie sie im Jahr 301 Seit Neubeginn zur Kantaki-Pilotin Diamant wurde und damit relative Unsterblichkeit genoss. Sie sah die Begegnung mit der siebenhundert Jahre alten und doch so jung wirkenden Esmeralda, die ebenfalls Kantaki-Schiffe flog.
Und sie sah Szenen, die nicht Teil ihres Lebens waren, zumindest nicht des Lebens, das sie geführt hatte. Die Bilder zeigten ihr nicht das eine Leben von Lidia DiKastro und Diamant, sondern hunderte, tausende, und jedes von ihnen war nicht weniger real als das, an das sie sich erinnerte. Sie schwebte im Zentrum, von dem Lebensbänder wie die Speichen eines Rades ausgingen, beobachtete zahllose Alternativen von sich selbst, wie lebendige, mit Leib und Seele ausgestattete Spiegelbilder, jedes von ihnen ebenso existenzberechtigt wie alle anderen.
Eine Schere kam.
Tausend Scheren kamen, und noch viel, viel mehr, so viele Scheren wie Bilder, und alle schnappten gleichzeitig zu, zerschnitten die Lebensbänder in ihre einzelnen Szenen, mit einem Geräusch, das wie das Zischen eines herabsausenden Fallbeils klang.
Wind wehte durch das Nichts, ein Sturm, der sich nicht um die Abwesenheit von Zeit und Raum scherte. Seine Böen packten die einzelnen Bilder, wirbelten sie wie welkes Laub auf und vermischten tausend und mehr Leben, verwandelten sie in einen bunten tanzenden Reigen.
Diamant streckte die Hand nach ihnen aus, aber der Wind trug die vielen Bilder fort, fauchte nun auch in den Gewölben ihres Geistes, zerrte dort an Gedanken und Gefühlen.
Die Farben wogten durcheinander, und Diamant spürte, wie sie sich in ihnen aufzulösen begann. Wenn dies nicht der Tod ist, so kommt nur noch Wahnsinn infrage, dachte sie mit einem letzten Rest von klarem Bewusstsein. Die Farben saugten ihr Selbst an, aber der Sog war nicht überall gleich, und er betraf auch nicht ihr ganzes Ich.
Sie kam sich vor wie ein Mosaik, an dem hundert Hände zerrten, jede von ihnen bestrebt, bestimmte Teile zu erlangen. Die Farben … Sie fühlten sich unterschiedlich an; manche von ihnen schienen wirklicher zu sein als andere.
Der Sturm inmitten des Nichts zerfetzte ihr Ich, und sie fiel zurück in tausend Welten.
1 – Doppelter Tod und ein Leben
Gelb: Abalgard, 12. Juli 5431
„Das hätte gefährlich werden können“, sagte Lidia DiKastro, seit dreißig Jahren Xenoarchäologin, spezialisiert auf die Hinterlassenschaften der legendären Xurr. Sie trat in den Windschatten eines Felsens und beobachtete die gewaltige Eismasse, die sich vom Gletscher gelöst hatte – sie lag geborsten und gesplittert weiter unten im Tal.
„Ach, das glaube ich nicht.“ Lidias Assistent kam näher, wie sie selbst in einen Thermoanzug gekleidet. Sein Gesicht verbarg sich halb hinter einer Atemmaske aus Synthomasse, und die Stimme kam aus einem kleinen integrierten Lautsprecher. „Wir haben das Lager ganz bewusst abseits des Gletschers errichtet, und selbst wenn die abgebrochenen Massen in unsere Richtung gerutscht wären: Die Kontrollservi hätten rechtzeitig den Sicherheitsschild aktiviert; uns wäre nichts passiert.“
Trotz der Atemmaske glaubte Lidia, das Lächeln auf den Lippen ihres Assistenten zu sehen. Der junge Paulus – so lautete sein Vorname; der Nachname bestand aus sechzehn Silben, und sie hatte nie versucht, sich ihn zu merken – war unerschütterlicher Optimist und sah immer alles von der besten Seite. Lidia wusste nicht recht, ob sie ihn deshalb beneiden oder bemitleiden sollte.
Sie beugte sich am Felsen vorbei, in den beißend kalten Wind, der über die eisverkrusteten Grate und schneebedeckten Gipfel des nördlichen Polargebirges von Abalgard fauchte, und blickte über den Hang zum Lager weiter unten, das nur als ein dunkler Fleck auf dem Weiß des Schnees erkennbar war. Winzige Punkte bewegten sich dort: Mitglieder des archäologischen Teams, das hier im hohen Norden nach weiteren Fundstellen von Xurr-Artefakten suchte.
„Sehen Sie sich das an.“
Lidia kehrte in den Windschatten des Felsens zurück und stellte fest, dass Paulus inzwischen weitergegangen war. Er stand zwischen zwei bizarren, wie exotische Gewächse aussehenden Eisformationen und deutete zum Gletscher empor. „Die Abbruchstelle …“
Lidia folgte ihm, trat vorsichtig an scharfkantigen Felsen vorbei und wich Spalten aus. Der Wind pfiff über sie hinweg und wehte lange, rauchartige Schneefahnen von den Graten. Kurze Zeit später verharrte sie neben Paulus, sah wie er nach oben und wusste sofort, was er meinte. Die Abbruchstelle war nicht schartig und ausgefranst, sondern so glatt wie mit einem Strahlbohrer geschnitten. Eine mehr als zweihundert Meter hohe Eiswand ragte vor ihnen auf, und sie war völlig glatt.
Lidia sah noch weiter nach oben, zum fernen Dreigestirn, das blass am grauen Himmel hing. Abalgard beschrieb eine sehr komplexe Bahn um den Tristern, und hinzu kamen nicht minder komplizierte Orbitalmuster der drei eng beieinander stehenden Sonnen. Nach den letzten Berechnungen ging auf dem vierten Planeten dieses ungewöhnlichen Sonnensystems eine Eiszeit zu Ende, die vor mehr als zehntausend Jahren begonnen hatte, zu jener Zeit, als die Xurr verschwunden waren.
„Ich habe schon viele Gletscher gesehen, aber so etwas noch nie“, sagte Paulus. „Man könnte meinen, dass wir hier eine Art Sollbruchstelle vor uns haben.“
Lidia schaltete ihren Individualschild ein, kletterte an Eis- und Felsbrocken vorbei und näherte sich der Eiswand, die allein durch ihre Ausmaße beeindruckte. Das letzte Stück des Weges war recht steil, und Lidia DiKastro, inzwischen fünfundfünfzig Jahre alt, atmete schwer, obwohl die Maske vor ihrem Gesicht die kalte, dünne Luft wärmte und mit Sauerstoff anreicherte.
Als sie dicht vor dem Ende des Gletschers stand, sah sie etwas in seinem eisigen Leib, vage Konturen, wie ein eingefangener Schatten. Erste Aufregung kribbelte in ihr, aber Lidia hielt sie unter Kontrolle. Aus Erfahrung wusste sie, wie leicht Vorfreude zu Enttäuschung führte.
„Ich glaube, da steckt etwas drin“, sagte sie.
„Vielleicht ein eingefrorener Xurr?“, fragte Paulus scherzhaft und kam ebenfalls nach oben.
„Wir wissen, dass die Eiszeit vor mehr als zehntausend Jahren innerhalb kurzer Zeit den ganzen Planeten erfasste – wir sprechen hier von Monaten, nicht von Jahren oder gar Jahrzehnten. Vielleicht wurde die damalige Kolonie der Xurr überrascht. Mit ein wenig Glück …“
Weit oben bildete sich eine Lücke im Grau der dünnen Wolken, und das Licht der Trisonne wurde heller, fiel ungefiltert auf den Gletscher, durchdrang das Eis …
Die Konturen ließen plötzlich eine Struktur erkennen, eine Art Ballon, oben dick und unten dünn, bestehend aus einer fleischartigen Masse, die Lidia von anderen Fundorten kannte: von den Xurr gezüchtetes Gewebe.
„Ist es wirklich das, wonach es aussieht?“, fragte Lidia voller Ehrfurcht.
Der neben ihr stehende Paulus rieb sich die Augen. „Wir kennen die organischen Raumschiffe der Xurr nur von plastischen Darstellungen, aber …“ Er schnaufte. „Meine Güte. Vielleicht war es eine Sollbruchstelle. Vielleicht haben die Xurr damals eines oder einige ihrer Schiffe einfrieren lassen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht nutzten sie die Eiszeit von Abalgard, um sich zu verbergen, vor der Gefahr, die die anderen zur Flucht veranlasste.“
„Die Xurr“, sagte Lidia langsam. „Abgesehen von den Horgh die einzige andere Spezies, die zur überlichtschnellen Raumfahrt fähig war.“ Sie lauschte dem Klang der eigenen Worte und stellte verwundert fest, dass sie … seltsam klangen. Etwas schien zu fehlen, eine wichtige Information.
Sie trat noch einen Schritt vor, so dicht an die gewaltige Eiswand heran, dass sie sie mit der ausgestreckten Hand berühren konnte, und dabei gewann sie den verwirrenden Eindruck, ihre Umgebung wie durch eine dünne transparente Membran wahrzunehmen.
„Wenn das Objekt dort drin wirklich ein konserviertes Raumschiff der Xurr ist …“, sagte Paulus leise. „Das wäre eine ungeheure Sensation und … He, was ist das denn?“
Lidia drehte sich um.
Zwischen ihr und Paulus zeigte sich ein schwarzer vertikaler Streifen in der Luft, etwa zwei Meter lang und so dünn wie ein Haar. Er zitterte, schwankte, senkte sich dann dem Boden entgegen. Als er ihn berührte, wuchs der Streifen zu einem Spalt, zu einem Riss in der Luft, und aus seiner Schwärze trat eine Gestalt, in einen schwarzen Kampfanzug gekleidet, das Gesicht hinter dem dunklen Helmvisier verborgen. Sie hob die rechte Hand, richtete eine Waffe auf Lidia und schoss.
Die energetische Entladung traf den Kopf der Xenoarchäologin und tötete sie auf der Stelle.
Orange: Tintiran, 29. März 5416
Levitatoren summten auf der großen Terrasse vor der Villa, und Lidia DiKastro trat neugierig ans Fenster des Blauen Salons, der während der letzten Jahre zu ihrem Zimmer geworden war. Weitere Vehikel näherten sich, zivile Levitatorwagen und Patrouilleneinheiten des Konsortiums. Männer und Frauen stiegen aus, manche von ihnen in Uniformen gekleidet. Als Lidia den Blick hob, sah sie ein großes Sprungschiff der Horgh, das aus den Wolken über dem Scharlachroten Meer kam und dem Raumhafen von Tintiran entgegensank. Sie glaubte zu verstehen.
Mit einem entschlossenen Ruck wandte sich Lidia vom Fenster ab, verließ den Blauen Salon – seit einiger Zeit immer mehr ein Ort der Trauer für sie – und eilte nach draußen. Jonathan versuchte, sie aufzuhalten, aber sie schenkte ihm keine Beachtung, ging einfach an ihm vorbei.
Valdorian wollte gerade in einen Levitatorwagen steigen, als Lidia die Terrasse erreichte. Er sah sie und zögerte.
„Ich möchte mitkommen“, sagte sie.
Valdorian wechselte einen kurzen Blick mit den Männern und Frauen in seiner Nähe. „Dies geht Sie nichts an.“
„Ich bin Ihre Frau“, sagte Lidia. „Was Sie betrifft, geht mich sehr wohl etwas an.“ Sie wusste nicht genau, warum sie ausgerechnet diesen Zeitpunkt und diesen Ort wählte. Vielleicht war ein kritischer Punkt erreicht, denn sie ahnte, was Valdorian plante. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte … Die Worte mussten einfach aus ihr heraus. Und es waren nur die ersten. Andere lauerten in ihr, hatten sich während der letzten Jahre in ihr aufgestaut, durch Kummer und Zorn.
„Lidia …“ Valdorian kam auf sie zu, gut vierzig Jahre alt, groß und schlank, das Haar ebenso grau wie die kühl blickenden Augen. Sein Gesicht war wie eine Maske, und manchmal fragte sich Lidia noch immer, was sich dahinter verbarg, nach fünfzehn Jahren Ehe. „Dies ist eine Angelegenheit des Konsortiums.“
Sie hatte es satt, von ihm behandelt zu werden wie eine Subalterne, wie ein Objekt, das man ganz nach Belieben benutzen oder zur Seite stellen konnte. Aber diesmal ging es um mehr: Valdorian schickte sich an, Tintiran und die anderen Welten des Mirlur-Systems in Gefahr zu bringen, darunter auch den vierten Planeten Xandor, auf dem ihre Eltern lebten, der Schriftsteller Roald DiKastro und die Pianistin Carmellina Diaz.
Lidia trat ganz dicht an Valdorian heran und sprach so leise, dass nur er sie verstehen konnte. Dennoch mangelte es ihrer Stimme nicht an Schärfe. „Ich habe Ihre Vorbereitungen während der letzten Tage beobachtet. Sie haben mehrere Einsatzgruppen gebildet, und jetzt das Horgh-Schiff … Es geht Ihnen um Viktor, nicht wahr? Oder um einen seiner Gesandten. Die Blassen sind mit den Horgh liiert. Wenn Sie einen von Viktors Leuten umbringen, ziehen Sie sich die Feindschaft der Horgh zu. Dadurch könnte das ganze Mirlur-System in Gefahr geraten.“
Valdorian presste kurz die Lippen zusammen. „Es ist Viktor höchstpersönlich, und er wird Tintiran nicht wieder verlassen. Wir haben unsere eigenen Blassen; von jetzt an werden wir keine Steuern mehr an die Parasiten abführen. Das Konsortium ist stark genug. Wir erklären unsere Unabhängigkeit von der Erde und den Dreizehn Hohen Welten unter der Regentschaft von Viktors Blassen.“
„Und wenn es zum Krieg kommt?“
„Wir gewinnen ihn.“
„Das ist Wahnsinn.“
„Das ist Politik.“
Valdorian drehte sich um und kehrte zum Levitatorwagen zurück. Lidia sah ihm nach, fassungslos und tieftraurig angesichts der bitteren Erkenntnis, dass sie seit anderthalb Jahrzehnten mit einem Mann verheiratet war, den sie überhaupt nicht kannte. Einmal mehr fragte sie sich, was sie damals dazu bewogen hatte, einer Ehe mit Valdorian zuzustimmen. Die Aussicht, an seiner Seite zur Magnatin zu werden und ein Leben „ohne Kompromisse“ zu führen, mit der Möglichkeit, sich alle – materiellen – Wünsche zu erfüllen? Vielleicht. Aber sicher hatte es noch mehr gegeben, das wollte sie glauben, selbst aus einem Abstand von fünfzehn Jahren. Doch nichts war davon geblieben, bis auf den … Diamanten, den Valdorian ihr damals geschenkt hatte. Seit langer Zeit hatte sie ihn nicht mehr betrachtet, sein Funkeln nicht mehr bewundert. Er lag jetzt im Sicherheitsfach ihres Schlafzimmers, hinter energetischen Barrieren, ebenso gefangen wie sie selbst.
Lidia blinzelte und stellte fest, dass sich die Terrasse leer vor ihr erstreckte. Die Levitatorwagen und Patrouillenfahrzeuge des Konsortiums waren gestartet, ohne dass sie es bewusst zur Kenntnis genommen hatte.
„Magnatin?“ Jonathan stand neben ihr, Valdorians Sekretär, ein unscheinbarer Mann, der zu verschwinden schien, wenn man sich nicht auf ihn konzentrierte.
Lidia drehte sich um. „Bringen Sie mich in die Stadt. Ich … brauche Bewegung.“
Dichte Wolken zogen übers Scharlachrote Meer und brachten einen frühen Abend. Tausende von Lichtern glühten und funkelten in Bellavista; Lidia dachte dabei an eine Ballerina, die ihr Kleid wechselte. An der Grenze von Tag und Nacht gefiel ihr die Stadt besonders, denn sie zeigte sich gleichzeitig von beiden Seiten, die eine ebenso schön wie die andere.
„Haben Sie ein bestimmtes Ziel?“, fragte Jonathan neben ihr.
Lidia bedachte ihn mit einem erstaunten Blick – sie hatte fast vergessen, dass er sie begleitete. Zahllose Gedanken gingen ihr durch den Kopf, wie eigenständige Wesen, die sich ihrer Kontrolle entzogen, und es gelang ihr nicht, sie zu ordnen. Wie verwundert musterte sie den Sekretär ihres Mannes, der zwanzig Jahre jünger als sie war, und aus irgendeinem Grund schien das nicht richtig zu sein. Sie sah kurzes, aschblondes Haar und graugrüne Augen, eine weder zu krumme noch zu gerade Nase, weder zu dünne noch zu dicke Lippen. Irgendetwas in Lidia glaubte, dass dieser so unscheinbare Mann älter sein sollte.
Sie sah sich um und bemerkte das zivile Personal, das sie auf Valdorians Veranlassung hin immer begleitete: bewaffnete Leibwächter, die Passanten daran hinderten, ihr zu nahe zu kommen; medizinische Subalterne, um – falls nötig – Erste Hilfe zu leisten; persönliche Bedienstete, die nur darauf warteten, dass sie einen Wunsch äußerte – das Gefolge einer Dynastin. Lidia hatte längst den Versuch aufgegeben, diese ganz besonderen Fesseln abzustreifen.
„Nein“, beantwortete sie Jonathans Frage, ging weiter und fühlte sich wie in einem Traum, der sie nicht freigab. Dieses sonderbare Empfinden stellte sich seit einigen Wochen immer wieder ein, und Lidia vermutete, dass es auf ihren inneren Konflikt zurückging, der sich verschärfte. Ein Teil von ihr wollte endgültig resignieren und sich mit allem abfinden, auch damit, dass Valdorian sein eigenes Leben lebte, ohne ihr Platz darin einzuräumen. Ein anderer Teil klammerte sich an der Hoffnung fest, dass es eine Möglichkeit gab auszubrechen, den goldenen Käfig des Magnatenlebens an der Seite eines kalten, egozentrischen Mannes zu verlassen und in die Freiheit zurückzukehren, endlich aufzuatmen.
Vor dem halbdunklen Präsentationsfenster eines Geschäfts blieb Lidia stehen und betrachtete die ausgestellten Kunstwerke aus Muscheln und Tintiran-Korallen. Kleine pseudoreale Sonnen umkreisten sie, bildeten dabei schnell wechselnde Muster aus Licht und Schatten, die mehr Tiefe schufen, als tatsächlich existierte. Doch schon nach wenigen Sekunden erregte etwas anderes Lidias Aufmerksamkeit: das eigene Spiegelbild. Sie sah das Gesicht einer Frau in mittleren Jahren, mit großen Augen, eine Mischung aus Smaragd und Lapislazuli, das schwarze Haar lockig und schulterlang – das Gesicht einer Frau, die sich die Schönheit der Jugend bewahrt hatte, ohne eine einzige Resurrektion. Aber es war auch das Gesicht einer Frau, die seit vielen Jahren unglücklich war.
Es donnerte in der Ferne, und als Lidia zum Raumhafen sah, blitzte es dort mehrmals auf.
„Er hat es wirklich getan“, murmelte sie.
Jonathan trat einen Schritt näher. „Magnatin?“
„Valdorian. Er hat Viktor umgebracht.“
Lidia drehte sich um und sah … einen Blassen.
Der Mann stand nur zwei Meter entfernt und hatte es irgendwie geschafft, an den Leibwächtern vorbeizugelangen. Schlank und groß war er, ein ganzes Stück größer als Lidia, und er trug die beigefarbene uniformartige Kleidung eines Sippenbruders der Horgh. Sein Gesicht wirkte völlig blutleer und die geröteten Augen lagen tief in den Höhlen. Wie Viktor und die anderen Blassen zählte er zu den Neuen Menschen: Nur sie waren in der Lage, die geistigen Schockwellen bei den Überlichtsprüngen der Horgh-Schiffe zu ertragen. Alle anderen Passagiere – normale Menschen ebenso wie Taruf, Ganngan, Grekki, Quinqu, Kariha, Mantai und so weiter – mussten die Überlichtphasen der Sprungschiffe im Transitstupor verbringen, und selbst das blieb nicht ohne Risiko. Immer wieder kam es vor, dass trotz des schützenden Stupors jemand den Schockwellen erlag und nie wieder erwachte.
Zwei muskulöse Leibwächter wollten den Blassen zurückdrängen, aber Lidia winkte ab. Neugierig trat sie näher und richtete einen fragenden Blick auf den Mann.
„Sie gehören nicht hierher“, sagte er mit seltsam rauer Stimme, ging ohne ein weiteres Wort an ihr vorbei und schritt am Rand des breiten, mehrstufigen Verkehrskorridors entlang, der wie eine Schlagader den urbanen Leib von Bellavista durchzog. Er verschwand zwischen den anderen Passanten.
Lidia sah ihm nach und glaubte zu beobachten, wie die Konturen ihrer Umgebung verschwammen, als sähe sie alles durch eine dünne transparente Membran. Sirenen heulten in der Ferne, und Levitatorwagen des Konsortiums sausten in den hohen Flugkorridoren zum Raumhafen. Unruhe breitete sich aus.
Etwas veranlasste Lidia, sich in Bewegung zu setzen und immer schneller zu gehen, bis sie fast lief, vorbei an Dutzenden von schwebenden Lampen, an Präsentationsflächen und kleinen Restaurants. Der Himmel war dunkel geworden, und in der Ferne über dem Scharlachroten Meer flackerten die Blitze eines Unwetters.
„Vielleicht sollten wir zur Villa zurückkehren“, sagte Jonathan, der nach wie vor an ihrer Seite blieb.
„Nein“, erwiderte Lidia nur und eilte weiter, durch eine Stadt, die ihr plötzlich immer fremder wurde. Sie sah Verwirrung und Sorge in den Gesichtern der Leibwächter und Bediensteten, achtete aber nicht darauf, während sie weiterhin entschlossen einen Fuß vor den anderen setzte, als ginge es darum, schnell ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen.
„Etwas stimmt nicht“, sagte sie plötzlich. „Warum fliegen Menschen mit den Horgh?“
„Mit wem sollten sie sonst fliegen?“, erwiderte Jonathan sanft. „Die Xurr verschwanden vor vielen Jahrtausenden, und abgesehen von ihnen beherrschen nur die Horgh die überlichtschnelle interstellare Raumfahrt.“
„Was ist mit den …“ Lidia suchte nach dem richtigen Wort und schüttelte hilflos den Kopf. Nach einigen weiteren Metern blieb sie stehen und sah sich um. Die Gebäude hinter ihr und zu beiden Seiten entsprachen genau Lidias Erinnerung, aber das Bauwerk vor ihr … Es bestand aus mehreren Kugeln und bot verschiedene Anderswelten an. „Wo ist die Pagode?“
„Die Pagode?“
Lidia zeigte auf das Gebäude, während Leibwächter und Bedienstete sie mit einem lebenden Schild umgeben. „An diesem Ort hat einmal eine … Sakrale Pagode gestanden.“
„Das Andersweltenzentrum existiert seit fünf Jahren“, sagte Jonathan. „Vorher gab es hier einen Gebäudekomplex mit kulturellen Einrichtungen der Taruf, Quinqu und Mantai.“ Der Sekretär zögerte kurz. „Geht es Ihnen nicht gut, Magnatin?“
„Eine Sakrale Pagode“, wiederholte Lidia. „Ich bin in ihr gewesen und habe dort …“
Zwei der Leibwächter, die sie umringten, entfernten sich, ohne dass sich ihre Beine bewegten. Der Raum zwischen ihnen und Lidia schien sich zu dehnen, und eine vertikale schwarze Linie entstand in der Luft, etwa zwei Meter lang und haardünn. Verblüfft beobachtete Lidia, wie sie den Boden berührte und breiter wurde, zu einem Spalt in Raum Zeit. Eine Gestalt trat hindurch, gekleidet in einen dunklen Kampfanzug, hob die rechte Hand mit der Waffe …
Ein Leibwächter reagierte und schoss mit einem kleinen Hefok, doch der Strahl zerstob an einem Schirmfeld, das den Unbekannten umgab.
Die Gestalt im Kampfanzug zielte auf Lidia und schoss. Feuer sprang ihr entgegen und verbrannte sie.

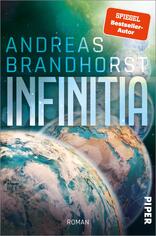


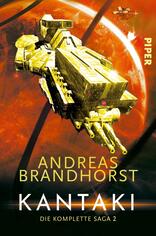
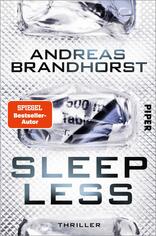



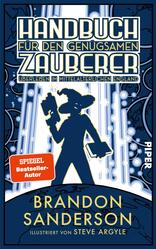









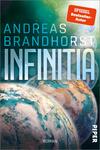

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.