
Der Zwölfte Mann ist eine Frau - eBook-Ausgabe
Mein unerhörtes Leben als Fußball-Fan
"Porombkas Buch ist halb Hommage, halb kulturtheoretische Betrachtung, die eine Phänomenologie des Stadionbesuchs miteinbezieht. Liebevoll geschrieben, unbedingt parteiisch ("Fußball ist Heimat"), oft amüsant: Ein Kapitel heißt "0:4 beim Pokalfinale oder Warum es eine Charakterfrage ist, Bayern-Fan zu sein", ein anderes: "Wadenbeißer und Stiernacken oder Warum das Spiel wieder Typen wie Borowka braucht". Und weil Porombka bei allem Spott über allwissende Männer auch ihre eher an ästhetischen Bewertungen der Spieler interessierten Geschlechtsgenossinnen nicht verschont, braucht ihr niemand vorzuwerfen, sie wäre auf einem Auge blind. Ein Leben als Fan und als Frau: Wiebke Porombka ist nicht die einzige. Aber eine der ersten, die darüber schreibt." - Spiegel online
Der Zwölfte Mann ist eine Frau — Inhalt
Wenn du ins Stadion gehst, kommst du nach Hause: Wiebke Porombka erzählt von ihrem Leben als Fan und als Frau. Und was der Fußball uns über die Welt verrät. Ein außergewöhnliches Buch über eine Leidenschaft, die niemals zu Ende geht. Alles begann, als Völler zu Werder kam. Aber sie musste die Klappe halten, wenn sie mit ihrem Bruder „Sportschau“ gucken wollte, und fing sich eine, wenn sie „blödquatschte“. Mädchen und Fußball – in den achtziger Jahren, als Wiebke Porombka zum Fan wurde, war das bestenfalls eine harmlose Verirrung. Und heute, wo Millionen Mädels mit Fähnchen im Haar die Eventmeilen bevölkern? Ist die Verirrung nur umso größer. Denn echte Fans, so zeigt Porombka in ihrem Buch, bleiben allein, auch wenn Tausende um sie herumstehen. Im Stadion ist es fast wie am Meer: Man wird verschluckt, und es gibt keinen Anfang und kein Ende mehr … Anhand eines Spieltags beschreibt die Autorin, was es heißt, Fan zu sein. Und dazu noch Frau. Sie erzählt von Männern, die gern Ahnung haben und mit Statistik protzen; von ahnungslosen Frauen, die sich fragen, ob Jogi Löw schwul ist; von den magischen fünfzehn Minuten vor dem Anpfiff und der entscheidenden Viertelstunde nach der Pause; weshalb Frauenfußball bescheuert ist – und warum das Spiel wieder Typen wie Borowka braucht.
Leseprobe zu „Der Zwölfte Mann ist eine Frau“
1. Schmerz, lass nicht nach
oder: Wie ich einmal Schläge kassierte,
wegen einer roten Karte
Fußball mag ein durchaus passendes
Spiel für harte Mädels sein, als Spiel
für feinsinnige Knaben ist es wohl
kaum geeignet.
(Oscar Wilde)
Die erste Ohrfeige meines Lebens verpasste mein
Bruder mir am 13. Oktober 1982. Ich saß im Frotteeschlafanzug
auf dem Sofa, beseelt vom Glück, nicht wie
sonst nach der „Sesamstraße“ ins Bett gehen zu müssen,
sondern mit meinem Bruder und meinem Vater
das Freundschaftsspiel England–Deutschland sehen zu
dürfen. Während die deutsche Mannschaft [...]
1. Schmerz, lass nicht nach
oder: Wie ich einmal Schläge kassierte,
wegen einer roten Karte
Fußball mag ein durchaus passendes
Spiel für harte Mädels sein, als Spiel
für feinsinnige Knaben ist es wohl
kaum geeignet.
(Oscar Wilde)
Die erste Ohrfeige meines Lebens verpasste mein
Bruder mir am 13. Oktober 1982. Ich saß im Frotteeschlafanzug
auf dem Sofa, beseelt vom Glück, nicht wie
sonst nach der „Sesamstraße“ ins Bett gehen zu müssen,
sondern mit meinem Bruder und meinem Vater
das Freundschaftsspiel England–Deutschland sehen zu
dürfen. Während die deutsche Mannschaft in späteren
Jahren vor allem in roten oder schwarzen Auswärtstrikots
aufgelaufen ist, trug sie Anfang der Achtziger
grüne Hemden, wenn das Trikot des Heimteams zu
ähnlich war. (Ich bin mir nicht sicher, was es zu bedeuten
hat, dass seit 2012 auswärts wieder in Grün gespielt
wird. Grundsätzlich vermute ich aber: Es kann nur etwas
Gutes sein.)
Zu Trikots ließe sich überhaupt einiges sagen. Schaut
man sich heute Spiele aus den Siebzigern an, wird einem
unmittelbar schwindelig angesichts der gewagten,
direkt unter Hintern und Gemächt endenden Hosen.
Wenn ich die Bilder sehe, von Günter Netzer mit fliegenden
Haaren und knappem Höschen oder dem zart
gelockten Beckenbauer in entsprechender Montur, finde
ich es ziemlich merkwürdig, dass damals nicht viel
mehr Frauen Fußball geguckt haben als heute. Ich glaube
eher: Die Frauen haben auch damals geschaut und
zwar ziemlich genau. Sie haben nur nicht darüber gesprochen.
An Einzelheiten des Spielverlaufs England gegen
Deutschland erinnere ich mich nicht. Aber an die grünweißen
Trikots. Grün-weiß. Das gab es für mich nur
einmal auf der Welt. An dieser Überzeugung hat sich
bis heute nichts geändert. (Gladbach, meinetwegen,
das lasse ich noch durchgehen, aber da kommt ja noch
das Schwarz hinzu. Wolfsburg, diese seelenlose Vorort-
Truppe, halte ich in jeder Hinsicht für indiskutabel,
nicht erst seit Magath. Und der Name Greuther Fürth
kommt mir allenfalls in den Sinn, wenn ich an die Regionalliga
denke. Das passiert eher selten.)
Grün-weiß, das war Werder. Das war die Mannschaft,
in deren Stadt ich geboren und aufgewachsen
war. Die Mannschaft mit den einzig natürlichen Vereinsfarben,
grün-weiß, wie das Spielfeld. Das war die
Mannschaft, deren Vereinswappen meinen Anfangsbuchstaben
trug. Jahrelang habe ich meinen Vornamen
mit einem – mehr oder weniger gekonnten – Werder-W
geschrieben. Das weiße W auf grünem Grund war meine
Signatur, praktischerweise in umgekehrter Farbgebung.
Ich würde nicht sagen, dass ich damals, als Deutschland
im Wembley-Stadion gegen England spielte und
ich im Schlafanzug neben meinem Bruder auf dem Sofa
saß, schon Fußball-Fan war. Ich war schlicht in dem
Wissen aufgewachsen, dass man Werder Bremen anfeuert,
wenn Werder Bremen spielt.
Nach meinen ersten zwei oder drei Einwürfen hatte
mein Bruder mich noch einigermaßen genervt zurechtgewiesen.
Als aber zum dritten Mal mein „Werder
vor, noch ein Tor!“-Ruf durchs Wohnzimmer geschallt
war, erhielt ich eine seiner gefürchteten, weil äußerst
schmerzhaften Backpfeifen. Das fand ich sehr seltsam.
Vor allem auch deshalb, weil eines dieser grünen Trikots
von Norbert Meier, Werders Linksfuß, getragen wurde.
Mein Bruder – neun Jahre älter als ich – schlug mich
selten ohne Grund. Er schlug mich, wenn ich seine neue
Morrissey-Platte ohne Hülle auf das Bett legte, weil ich
in seinem Zimmer ein bisschen Winnetou hören wollte.
Und dann gleich noch mal, wenn ich als Rache für die
Platten-Prügel, die ich einstecken musste, heimlich ein
paar Teile aus seinem Modellbaukasten zerbrach. Was
er natürlich immer herausfand. Meistens dann, wenn
ich schon nicht mehr damit rechnete.
Wenn ich keine Ruhe gab und bettelte, weil ich mit
ihm und seinen Freunden Fußball spielen wollte, tat es
auch ein gezielter Treffer ins Gesicht mit einem nassen
Lederball. Noch heute, wenn ich einen Spieler beim
missglückten Kopfball sehe, spüre ich den zwiebelnden
Schmerz auf der Wange.
Ich sage mir dann, dass es natürlich ein himmelweiter
Unterschied ist, ob ein fünfjähriges Mädchen von
einem Ball getroffen wird, der sich durch die Nähte seiner
weißen und schwarzen Lederflicken mit Regenwasser
vollgesogen hat. Oder ob ein wasserresistenter Synthetikball
auf die Stirn eines ausgewachsenen Mannes
prallt, der noch dazu für solcherart Eventualitäten einigermaßen
präpariert sein dürfte. Aber wirklich überzeugt
bin ich nicht von diesem Unterschied.
Es gibt solche Treffer und solche. Und solche Schläge
und solche. Die einen strotzen vor Ungerechtigkeit:
Kann ein fünfjähriges Mädchen wissen, dass man
Schallplatten niemals ohne Hülle auf ein flauschiges
Bett legen darf? Und dann sind da noch die Schläge,
von denen du schon als fünfjähriges Mädchen weißt,
dass du sie zu nehmen hast. Du spürst es einfach. Diese
Schläge haben, nennen wir es: einen Sinn.
Meine zweite sinnstiftende Ohrfeige erhielt ich am
25. Februar 1984. In diesem Fall stand tatsächlich Werder
auf dem Platz. Es war eine Bundesligapartie gegen
Nürnberg, die ich mit meinem Bruder in der „Sportschau
“ sah, was ein großes Glück bedeutete, für mich
genauso wie für ihn. In dieser Vor-„Ran“-Zeit zeigte
die „Sportschau“ drei Partien je Spieltag in Ausschnitten.
Bei allen anderen wurde nur das Ergebnis verlesen.
Auch von diesem Spiel weiß ich nicht mehr viel. Aber
seien wir ehrlich: Bei welcher Partie des 1. FC Nürnberg
wäre das anders?
Nur die rote Karte für Rigobert Gruber ist mir im
Gedächtnis geblieben und die wenigen Momente davor.
Die ewig langen Sekunden, als der Nürnberger Spieler
allein auf Dieter Burdenski zuläuft. Die große grüne
Leere, die sich plötzlich auftut zwischen den restlichen
Spielern und dem Bremer Torwart. Auf dieser unendlich
weiten Fläche: der Nürnberger Spieler, hinter ihm
Rigobert Gruber.
Und dann lache ich. Ich lache, weil der Gegenspieler
so jäh gebremst wird. Ich lache über die einigermaßen
beeindruckende Flugbahn des Spielers. Über das
Wort „Notbremse“, das die Reporterstimme ruft. Und
die überraschende, weil seltene und deshalb exklusive
rote Karte, die der Schiedsrichter zackig aus der Tasche
zieht. Ein wenig lache ich auch vor Schreck.
Diesmal traf mich der Schlag weitaus härter. Diesmal
war die Schwere der Konsequenzen – Sperre für
Gruber, Bremen in Unterzahl, das Spiel ging mit 0 : 2
verloren – in der Ohrfeige enthalten, die auf meiner
Wange brannte, schlimmer als der strammste Schuss
mit einem regengetränkten Ball. Aber auch dieses Mal
weinte ich nicht. Höchstens leise vor mich hin.
Natürlich kann man nicht einfach den Schluss ziehen:
Schläge führen zu Fußballbegeisterung. Das wäre
viel zu simpel und würde das Ganze mit unnötiger Härte
versehen. Bevor jemand anderes auf die Idee kommt,
bekenne ich es lieber selbst (die korrekte freudsche Be
zeichnung fällt mir gerade nicht ein): Ja, ich wollte fortan
auch deshalb Ahnung von Fußball haben, um meinen
großen Bruder zu beeindrucken.
Ich wollte, dass mein großer Bruder anerkennend
nickt, wenn ich mit süffisant gehobener Augenbraue
das Spielgeschehen kommentiere. Wenn ich einen leisen
Fluch ausstoße, weil Oliver Reck unter dem Ball
hindurchsegelt. Wenn ich verächtlich den Kopf schüttele
ob des jüngsten Spielertransfers.
Ist das so verwerflich? Jeder zweite Junge hat den
Traum, Fußballer zu werden. Dabei träumt er nicht
unbedingt von Reichtum, sondern davon, dass ihn alle
Welt bewundert, vor allem die Klassenkameraden, die
ihm tagtäglich das Leben schwer machen. Einmal Held
sein, einmal derjenige sein, der – gerade eingewechselt –
den Ball links oben in den Winkel drischt. Und dann das
Bad in der jubelnden Menge nehmen. Das Trikot ausziehen
und den dankbaren Fans hinüberwerfen – unter
ihnen der ärgste Peiniger vom Schulhof. Dagegen ist es
doch wohl nur recht und billig, wenn man sich durch
ein bisschen Fußballkenntnis davor bewahren will, am
Wochenende die nächste Kopfnuss zu kassieren.
Wenn es sich damit erledigt hätte – dann wäre der
Fußball nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Aber da
war noch mehr: Die brüderlichen Backpfeifen haben
etwas in mir ausgelöst. Wir haben nie darüber gesprochen,
was genau es ist, um das es meinem Bruder
beim Fußball geht. Genauso wenig, wie wir je darüber
gesprochen haben, worum es mir geht. (Vielleicht taten
wir es gerade deshalb nicht, weil mein Bruder mir
vor allem eines beibringen wollte: Beim Fußball redet
man nicht nur keinen Blödsinn – am besten redet man
gar nicht. Am besten hält man einfach den Mund und
schaut zu.)
Ohnehin existieren nur wenige wahre Sätze über
Fußball. Der erste lautet: „Man kann sich nicht aussuchen,
dass man Fan ist – und schon gar nicht, von
welcher Mannschaft.“ Der zweite: „Ein echter Fan hört
niemals auf, Fan seiner Mannschaft zu sein.“ Und der
dritte (es sind tatsächlich ein paar mehr) stammt von
Christoph Biermann: „Möge die bessere Mannschaft
gewinnen“, schreibt er in seinem Buch „Wenn du am
Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen“,
sei der dümmste Satz, den man über Fußball sagen könne.
„Denn es muss heißen: Möge meine Mannschaft gewinnen!
Und spiele sie noch so schlecht. Sei sie noch so
unfähig und hölzern, inkompetent und von allen guten
Geistern verlassen. Bitte, wenn es da oben einen gerechten
Gott gibt, lass mein Team in diesem Kampf des
Guten gegen das Böse gewinnen.“
Wie will man das komplett Irrationale dieser Wahrheit
erklären? Denn eine Wahrheit ist es, daran besteht
kein Zweifel. Vielleicht sollte ich die Frage zunächst
einmal umdrehen, nicht nach dem Ursprung der
Leidenschaft fragen, sondern nach ihren Folgen: Was
macht es mit dir, wenn du Fußball-Fan bist? Abgesehen
von so oberflächlichen Dingen, dass du Verabredungen
und berufliche Termine nach dem Spielplan des DFB
ausrichtest. Oder dass du, wenn du dich in einem Anflug
von Emanzipationswillen doch an einem
Spieltag verabredet hast, in letzter Sekunde und unter fadenscheinigen
Ausreden noch umfällst. Dass du, wenn die
eigene Mannschaft verliert, tiefschwarze Augenringe
bekommst vor Wut und Enttäuschung. Oder dass du
dir den Wochentag der Geburt deines Kindes deshalb
so gut merken kannst, weil er auf den Tag vor der ersten
Runde des DFB-Pokals gefallen ist.
Viel entscheidender als diese kleinen Dinge des Alltags
ist für mich die Frage, ob mein Leben anders verlaufen
wäre, wenn ich nicht als Werder-Fan, sondern
beispielsweise als Fan der Stuttgarter Kickers oder als
Fan des HSV auf die Welt gekommen wäre. Niemand
wird daran zweifeln, dass jeder Mannschaft ein bestimmter
Geist, ein bestimmter Charakter innewohnt –
die Spieler können im Laufe der Jahre wechseln, der
Geist einer Mannschaft bleibt derselbe. Und wenn du
Woche für Woche mit diesem Geist konfrontiert wirst,
deine ganze Leidenschaft für diesen Geist aufwendest:
Muss er dann nicht auch Einfluss auf deine Art zu Denken
haben?
Es wird auf den folgenden Seiten immer wieder mal
über den Geist von Werder Bremen gegrübelt werden.
Dem Prinzip nach aber gilt das, was ich über Werder
erzähle, auch für alle anderen Mannschaften der Liga.
Nur eben auf ihre jeweils eigene Weise.
Ein einziges Mal bin ich gemeinsam mit meinem Bruder
ins Stadion gegangen. Noch nicht einmal ins Weserstadion,
sondern zum Millerntor. St. Pauli spielte
eines dieser Zweitliga-Matches, die verdammt trostlos
wären, wenn es sich eben nicht um St. Pauli handelte.
Ich war gerade nach Hamburg gezogen und stand
pünktlich um zehn Uhr morgens bei meinem Bruder
im Wohnzimmer.
Der Tag folgte einer von ihm festgelegten strengen
Dramaturgie: zwei Brötchen pro Person mit Hackepeter,
Salz, Pfeffer, Zwiebeln, dann ins „Max und Konsorten
“, seine Stammkneipe in der Langen Reihe, St.
Georg. Dort: zwei Sekt auf Eis. Gegen zwölf in die U3
Richtung St. Pauli. Hier durfte/musste das erste Bier
des Tages geöffnet werden. Im „Letzten Pfennig“, der
traditionell finalen Anlaufstelle vor dem Stadion, folgten
weitere.
Ich war bester Stimmung. Und sie stieg beständig.
Hamburg, Frühling, und an der Seite meines großen
Bruders ins Stadion – in Bremen hatte er das immer
abgelehnt, so kategorisch, dass ich noch nicht mal zu
fragen gewagt hätte.
Offenbar war ich in diesem Sommer erwachsen geworden,
dachte ich und schaute in den strahlend blauen
Hamburger Himmel, der über dem Stadion aufgerissen
war, dieser Hamburger Himmel, der, wenn er denn mal
strahlt, immer so verheißungsvoll nach Meer aussieht.
Unterbrochen wurde ich durch einen Knuff in die
Rippen.
„Keks?“
Eine Prinzenrolle machte die Runde, keine Ahnung,
wer sie mitgebracht hatte, aber alle Umstehenden bedienten
sich. Ich habe mich immer wieder gefragt, ob
diese Kekse essenden Fans ein Grund für das Tabellen-
mittelmaß des FC sind. Natürlich, St. Pauli hat zweifellos
die lustigsten Fans überhaupt. Aber wie willst du als
Mannschaft ernsthaft Fußball spielen, wenn deine Fans
Schokokekse mümmeln oder Lieder singen wie „Wir
waschen uns nie – St. Pauli“ (Betonung auf der langgezogenen
letzten Silbe).
Ein paarmal wäre ich fast in die Knie gegangen, als
die Kumpel meines Bruders mir auf die Schulter klopften,
um die kleine Schwester, die Neu-Hamburgerin, zu
begrüßen. Aber natürlich gab ich alles darum, Standfestigkeit
zu demonstrieren, neben der Trinkfestigkeit,
um die ich ebenfalls redlich bemüht war. Irgendwann
musste ich zur Toilette, was ich offenbar in der Pause
verpasst hatte. Oder musste ich schon wieder? Mein
Bruder ging mit – vielleicht um das Bier zu halten, vielleicht
weil er ebenfalls mal musste, vielleicht wusste er
es auch selbst nicht so genau.
Meine Erinnerung setzt wieder ein, als mein Bruder
und ich einträchtig die Reeperbahn entlangschlendern.
Wir plaudern über meine Pläne für den Sommer, streiten
über meinen neuen Freund, der – wie alle anderen
zuvor und danach – seinen Unwillen erregt, dann kommen
wir an einer Uhr vorbei. Sie zeigt 16.51 Uhr. Wir
gehen weiter, schweigend.
Wir haben es beide gesehen und wissen, was es bedeutet.
Wir hatten völlig vergessen, dass das Spiel noch lief,
waren von den Toiletten einfach zum Ausgang marschiert.
Nicht etwa aus Protest oder Frust über eine
unabwendbare Niederlage – beim Fußball ein, in dop-
pelter Hinsicht, absolutes No-Go. War es Selbstvergessenheit?
Selige gemeinsame Trunkenheit trifft es wohl
besser. Mein Bruder und ich haben nie wieder über diesen
Tag gesprochen. Aber irgendwie glaube ich trotzdem,
dass er etwas Versöhnliches hatte.
„Porombka hat Ahnung vom Fansein, und ihre kleinen und größeren Betrachtungendazu, beschreibt sie liebevoll, treffend, aber auch schonungslos. Sie kann sich herrlich über Fußball-Touristen echauffieren. Leute, die nichts vom Fußball und schon gar nicht vom Fan-Sein verstehen. Und sie beschreibt viele ehrliche und amüsante Episoden aus ihrem eigenen Fan-Dasein.“
„Die Akteure wechseln, der "Geist" bleibt, und zum Geist gehört auch das Leiden am Lieblingsklub. Dass dieser Geist letztlich nichts anderes ist als das kleine Quantum Halt, das auch die Treue zum Heimatverein einer Lebensgeschichte verleihen kann, macht Porombkas Buch auf ganz unangestrengt heitere Art deutlich. Denn dies ist kein weiterer Beitrag zur Philosophie des Fussballs, die neuerdings so viele Intellektuelle umtreibt. [...]. Ihr Buch ist stattdessen, kurz gesagt, eine Autobiographie im Zeichen des W.“
„Vor allem Werder-Fans werden mit sympathischen Anekdoten unter anderem zu König Otto, Karl-Heinz Riedle, Tim Wiese und Marko Arnautovic ihren Spaß an diesem Buch haben. Damit darf es als Pflichtlektüre für die Grün-Weißen eingeordnet werden. Mit ihren treffenden Betrachtungen zum Thema Fansein schießt sich Wiebke Porombka in die Champions-League der Fußballbücher. Nicht nur Frauen, sondern gerade auch Männer werden ihre Freude an diesem Buch haben.“
„Man möchte aus jeder Seite einen Satz zitieren. … Selten wurde so deutlich und so plastisch, dass Fußballfans echte Gläubige sind und der Fußball in säkularisierten Gesellschaften den vakanten Platz der Religion einnimmt.“
"Porombkas Buch ist halb Hommage, halb kulturtheoretische Betrachtung, die eine Phänomenologie des Stadionbesuchs miteinbezieht. Liebevoll geschrieben, unbedingt parteiisch ("Fußball ist Heimat"), oft amüsant: Ein Kapitel heißt "0:4 beim Pokalfinale oder Warum es eine Charakterfrage ist, Bayern-Fan zu sein", ein anderes: "Wadenbeißer und Stiernacken oder Warum das Spiel wieder Typen wie Borowka braucht". Und weil Porombka bei allem Spott über allwissende Männer auch ihre eher an ästhetischen Bewertungen der Spieler interessierten Geschlechtsgenossinnen nicht verschont, braucht ihr niemand vorzuwerfen, sie wäre auf einem Auge blind. Ein Leben als Fan und als Frau: Wiebke Porombka ist nicht die einzige. Aber eine der ersten, die darüber schreibt."





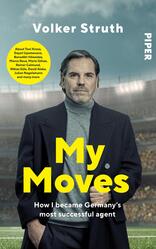



Ein großartiges Buch, das mit großer Liebe die Liebe und Leidenschaft für den geliebten Verein beschreibt, eintaucht in die Tiefe der Seele einer Begeisterten, ein stadionesker Entwicklungsroman von himmelhochjauchzend bis todesbetrübt, auch ein Erinnerungsstück an jene meine Tage, als ich die Spielstätte meiner Elf als einer der vielen Zwölften erstmalig betrat. Ich bin auf Seite 100, Halbzeit, gleich geht's weiter, wir werden, ich werde gewinnen!
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.