

Dichterkinder Dichterkinder - eBook-Ausgabe
Liebe, Verrat und Drama – der Kreis um Klaus und Erika Mann
„Was da im Laufe der Jahrzehnte an Lebenswirren bis hin zu Skandalen zusammenkommt, ist schwindelerregend – und in manchen Fällen tragisch.“ - Süddeutsche Zeitung - München
Dichterkinder — Inhalt
Erika und Klaus Manns extravagante Freundschaften
Was um 1920 hoffnungsvoll begann, endete ab 1933 in Exil und Untergang. Der Kreis um Erika und Klaus Mann bestand im Kern aus fünf Freunden, deren Kreativität sich gegenseitig beflügelte. Klaus Mann brach in seinen Romanen die Tabus um Homosexualität und freie Liebe, Mopsa Sternheim entwarf das Bühnenbild für seine Theaterfassungen, Erika Mann und Pamela Wedekind erarbeiteten Bühnenstücke, während Annemarie Schwarzenbach aus aller Welt berichtete. Die erotisch aufgeladene Freundschaft der fünf und deren Umkreis gewährt Einblick in radikale literarische und politische Umbrüche jener Zeit.
Leseprobe zu „Dichterkinder“
„Um die Leute zu schrecken“
Prolog: Klaus Mann und Pamela Wedekind verloben sich. 1924
Romantischer könnte das Ambiente für einen jungen, angehenden Literaten nicht sein: Das Frühjahr 1924 verbringt der gerade einmal siebzehnjährige Klaus Mann als Gast des Dichters, Schattenspielprinzipals, Bibliophilen und Alchemisten Alexander von Bernus auf dessen Anwesen Stift Neuburg bei Heidelberg. Der Blick von dem ehemaligen Benediktinerkloster geht hinunter auf den Neckar und die altehrwürdige Universitätsstadt. Die Familie Bernus hat das säkularisierte Kloster [...]
„Um die Leute zu schrecken“
Prolog: Klaus Mann und Pamela Wedekind verloben sich. 1924
Romantischer könnte das Ambiente für einen jungen, angehenden Literaten nicht sein: Das Frühjahr 1924 verbringt der gerade einmal siebzehnjährige Klaus Mann als Gast des Dichters, Schattenspielprinzipals, Bibliophilen und Alchemisten Alexander von Bernus auf dessen Anwesen Stift Neuburg bei Heidelberg. Der Blick von dem ehemaligen Benediktinerkloster geht hinunter auf den Neckar und die altehrwürdige Universitätsstadt. Die Familie Bernus hat das säkularisierte Kloster einst erworben und hier selbst Geistesgeschichte geschrieben: Im Jahre 1909 waren Stefan George und sein Kreis zu Gast. Damals trug der „Meister“ den „Jüngern“ aus seinen hermetischen Versen vor, und abends führte der noch junge Baron Alexander von Bernus, der in München-Schwabing erfolgreich ein Schattentheater betrieb, hinter einer Leinwand stehend und mit beweglichen Figuren hantierend, seinen illustren Gästen selbstverfasste Stücke vor. Nachts erging man sich – plaudernd, trinkend und schwärmerisch dem Freundschaftskult huldigend – in dem mit alten Bäumen bestandenen und mit Rosenbuketten geschmückten Park. Doch die Zeiten ließen den Freundeskreis nicht unberührt, Eifersüchteleien und Animositäten kamen auf. Der Zirkel zerbrach, nicht zuletzt an des hochbegabten Barons Weigerung, sich dem „Meister“ und seinen autokratischen Allüren zu unterwerfen. Er wolle ihm ja gern sein Königreich lassen, schleuderte Bernus George entgegen, aber er, Bernus, lasse sich sein Herzogtum nicht nehmen! Damit war das geistige Einverständnis zwischen den beiden zerrüttet.
Wenige Jahre später fegte der Erste Weltkrieg über Europa hinweg. Das Kaiserreich ging unter, die Republik erstand, gebeutelt von politischen und wirtschaftlichen Krisen, nicht zuletzt von der Inflation des Jahres 1923, in deren Folge man für die Beförderung eines Standardbriefes zehn Milliarden Mark hinblättern musste, Kinder auf den Straßen mit dicken Bündeln wertlosen Papiergeldes wie mit Bauklötzen spielten und weite Teile der Bevölkerung verelendeten. Auch Alexander von Bernus’ Vermögen schmolz dahin, übrig blieben seine bedeutende Bibliothek mit wertvollen Erstausgaben der deutschen Klassiker und Romantiker und zahlreichen Widmungsexemplaren der literarischen Größen der Gegenwart, das klösterliche Anwesen mit seinen nun verödeten Kreuzgängen, Fluren und Sälen, und ein exzellenter Ruf, den Bernus, mittlerweile ein Mann von Mitte vierzig, nach wie vor in der deutschen Geisteswelt genoss.
Es ist still geworden in Stift Neuburg: Bernus, in erster Ehe mit der Literatin Adelheid von Sybel verheiratet, hatte einen Sohn namens Alexander Walter, der sich 1912 mit acht Jahren beim Spielen im Garten unglücklich selbst erdrosselte. Ein Schicksalsschlag, über den der feinsinnige Baron lange nicht hinwegkam, obgleich er noch im selben Jahr die baltische Künstlerin Imogen von Glasenapp heiratete und im Jahr darauf ihre gemeinsame Tochter Ursula Pia geboren wurde. Umso willkommener erscheint Bernus im Frühjahr 1924 die Anfrage seines Freundes und Schriftstellerkollegen Thomas Mann aus München (der Baron hat Thomas Mann einst bei der Darstellung des höfischen Zeremoniells im Roman Königliche Hoheit beraten), ob dessen Sprössling Klaus, selbst ein angehender Literat, nicht für ein paar Wochen als Logiergast nach Stift Neuburg kommen könne? Der junge Mann sei ein Schulabbrecher, habe allerlei Flausen im Kopf und sei derzeit auf der Suche nach einem eigenen Weg, da könne eine Auszeit in der Klausur eines Klosters, selbst eines säkularisierten, nur guttun, man erwarte von der Stille und Abgeschiedenheit Stift Neuburgs und nicht zuletzt von des Barons väterlicher Menschenkenntnis eine wohltuende und klärende Wirkung auf die verworrenen Ansichten des frühreifen Burschen.
Der Koffer ist rasch gepackt, und mit der Eisenbahn trifft der siebzehnjährige Schriftstellersohn im Frühjahr 1924 in Heidelberg ein. Er bezieht ein Zimmer in dem ehemaligen Kloster, das er in den kommenden Wochen selten verlässt. Von der heimeligen Landschaft am Neckar und dem quirligen Studentenleben der Stadt bekommt der junge Mann kaum etwas mit, denn seine Welt ist die Literatur, und hier sind es vor allem die Abseitigen, Gebrochenen, Kranken, die er verehrt und denen er nacheifert: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Wilde, Bang … Ursula Pia von Bernus erinnert sich als ältere Frau an den seltsamen Logiergast jener Wochen: „Er schrieb und ging sehr wenig heraus aus dem Zimmer, das immer voll Rauch und dicken Parfümwolken war … Einmal machte meine Mutter gerade die Blumenbeete unter dem Fenster von Klaus Mann zurecht und rief ihm hinauf, da der Gärtner einen Haufen Mist zum Ausstreuen auf das Blumenbeet da hingelegt hatte, ›Klaus, machen Sie mal das Fenster auf, daß es hier schönere Düfte gibt!‹ Darauf öffnete er das Fenster und lachte … Er verbreitete einen unendlichen Duft von Parfüm. […] Was mir an ihm auffiel, war, daß er immer eine leichte Bindehautentzündung hatte, also immer leicht gerötete Augen. Wahrscheinlich stammte das davon, daß er immer bei geschlossenen Fenstern und zugezogenen Vorhängen im dichten Rauch von Zigaretten saß.“
Zigaretten und Parfüm sind mehr als nur berauschende, inspirationsfördernde Ingredienzen: Vielmehr sind sie Ausdruck einer Lebenshaltung. Der junge Mann will einerseits erwachsener wirken, als er ist, andererseits sollen diese Stoffe ein Image versinnbildlichen, das er sich als Dichter zulegt: das eines unangepassten Dandys und Bürgerschrecks, eines dekadenten Außenseiters und betont effeminierten Homosexuellen. Klaus Manns Liebe zu den französischen und englischen Dichtern des L’art pour l’art ist mehr als nur Imitation. Er will ihnen in seinem Schreiben, aber auch in seiner Lebensweise nacheifern und sich von seinem bürgerlichen Elternhaus abgrenzen. Vieles an diesem jugendlichen Aufbegehren ist verzweifelte Provokation, mehr kunstvolle Sublimierung als offene Revolte. Es ist Ausdruck eines hochintelligenten, dabei aber noch nicht gereiften und im Innersten unsicheren Individuums, dem es an tatsächlichen Vorbildern im eigenen Leben mangelt. Klaus Mann schreibt in jenen Monaten Gedichte und Prosaskizzen, die von Selbstfindung, Abgrenzung von der satten Generation der Väter und vor allem von aufkeimenden gleichgeschlechtlichen Gefühlen handeln. Bereits an der reformorientierten Odenwaldschule, wo er das Schuljahr 1922/23 verbrachte, hat er sich heftig in einen Mitschüler verliebt: Uto Gartmann aus Wimpfen. Noch in seinem Lebensrückblick Der Wendepunkt schwärmt der bereits über vierzigjährige Autor: „Er hatte das Gesicht, das ich liebe. Man mag für mancherlei Gesichter Zärtlichkeit empfinden, wenn man lange genug lebt und ein empfindendes Herz hat. Aber es gibt nur ein Gesicht, das man liebt. Es ist immer dasselbe, man erkennt es unter Tausenden. Uto hatte dies Gesicht. […] Er war ein guter Junge, bescheiden und sanft, ohne Bosheit; eitel genug, um sich meiner Huldigung zu freuen, doch zu naiv, um den wahren Charakter meiner Leidenschaft zu erkennen.“ Nun, in Klaus Manns parfümgeschwängertem Zimmer in Stift Neuburg, steht eine gerahmte Fotografie Utos auf dem Schreibtisch, umwunden von einem Rosenkranz – denn die Sinnlichkeit und Irrationalität des Katholizismus ist ebenfalls ein Mittel, sich vom nüchternen, protestantisch-hanseatischen Elternhaus abzugrenzen.
Doch mehr als Uto vermisst Klaus Mann seine um ein Jahr ältere Schwester Erika. Die beiden ergänzen sich wie Yin und Yang, sie sind zusammen alles, und getrennt nur unvollkommen. Klaus Mann weiß das von früher Jugend an. Die geschwisterliche Liebe zu Erika beglückt ihn und fügt ihm zugleich eine Wunde zu, an der er zeitlebens tragen wird. Äußere Trennungen werden als herbe Schicksalsschläge verbucht, gemeinsame Erlebnisse als höchste Vollendung und Seligkeit, Liebesbeziehungen Erikas als Verrat an der eingeschworenen Geschwisterlichkeit.
Doch eben jetzt, in den Wochen bei Alexander von Bernus, ist Klaus Mann von seiner geliebten Schwester getrennt. Die nämlich hat in jenem Frühjahr 1924 an einem Münchner Gymnasium das Abitur mit Ach und Krach bestanden, das sagenhaft schlechte Zeugnis gerahmt und an die Wand gehängt (mehr zur Erheiterung denn aus Stolz) und kurz darauf das Elternhaus und die Vaterstadt verlassen und ist nach Berlin gezogen, wo sie sich im Schauspielermilieu umtut. Klaus leidet unter der Trennung. Und er ist neidisch und ein wenig eifersüchtig. Neidisch auf Erikas Freiheit, sich in der Weltstadt selbstständig tummeln zu dürfen, eifersüchtig auf eine Liebe, die in Erika aufflammt. Das Objekt der Begierde: Pamela Wedekind.
Pamela, geboren am 12. Dezember 1906, ist die älteste Tochter des Dichters Frank Wedekind und der Schauspielerin Tilly Wedekind. Die Geschwister Mann haben die beeindruckende junge Frau mit dem „Haupt eines Renaissance-Jünglings“ einige Zeit zuvor bei einem Tee kennengelernt, den Mimi Mann, die Frau des Onkels Heinrich, in München gegeben hat. Pamela Wedekind sieht ihrem legendären Vater, der bereits 1918 verstorben ist, frappant ähnlich: Das scharf geschnittene Gesicht, die Hände, selbst die metallene Stimme gemahnen an den großen Dichter und Bänkelsänger. Und wenn Pamela zur Gitarre die mal frechen, mal melancholischen Chansons ihres Vaters singt, glaubt man eine weibliche Reinkarnation vor sich zu haben. „Ihr Liedvortrag“, so Klaus Mann in seiner ersten Autobiografie Kind dieser Zeit aus dem Jahre 1932, „war eine künstlerische Darbietung großen Stils, das Konzentrierteste, Reinste und Originalste, was sie zu geben hatte. Sie sang mit einem erschütternden Ernst und mit einer exakten, gleichsam eisigen Anmut. Ihr Mund, der bösartig, sehnsüchtig oder traurig lächelte, formte jedes der Worte, mit denen die zartesten und strengsten Fäden sie verbanden, zu einer von Leidenschaft vibrierenden Akkuratesse.“ Bald sind die Dichterkinder – Klaus, Erika und Pamela – „unzertrennlich“ . Freunde, auch Liebespaare: Denn Erika wird von einer verzehrenden Leidenschaft für Pamela ergriffen. Pamela lässt sich die Werbung gefallen. Die beiden jungen Frauen lassen sich von einem Fotografen ablichten: mit ähnlicher Frisur, gleich gekleidet, die Köpfe einander nah und zugewandt – ein Bild, das Einvernehmen, Vertrautheit und Zärtlichkeit ausstrahlt. Wie viel daran ernsthaft und tragfähig ist, wie viel Spiel und Image, ist nicht restlos zu klären. Tatsache ist, dass Erika Mann an dieser Freundschaft mehr leidet als Pamela. Und noch einer krankt: Klaus. Denn er fürchtet nicht nur um die Unversehrtheit des freundschaftlichen Dreierbundes, sondern auch um die geschwisterliche, androgyne Nähe zu Erika.
Er ist in jenen Wochen in Stift Neuburg wie abgeschnitten von der Welt. Ein moderner Eremit, eingeschlossen in seiner Klause, mit seinem Schreibtisch, seinen literarischen Ideen und Plänen, aber auch mit seinen Hoffnungen und Ängsten. Und diese Mischung der Gefühle, dieses Knäuel widerstrebender Empfindungen, die ihn, Vor dem Leben stehend (sein erster Erzählband von 1925 wird diesen Titel tragen), schier zerreißen, und vielleicht auch ein wenig die Lust an der Provokation, der Protest gegen den Vater und die Väter – all dies treibt ihn zu einem Entschluss, dessen Tragweite ihm wohl kaum bewusst sein dürfte: Am 24. Juni 1924 – sein Aufenthalt bei dem Baron neigt sich dem Ende entgegen – schreibt er an Pamela Wedekind einen werbenden Brief: „Ich habe schrecklich wehe Augen und trage auch einen schwarzen Schirm. Darum nur viele Grüße. […] Ich bin noch bis zum 3. hier. Dann fahre ich zunächst nach Hannover […], dann auf einen Tag nach Berlin und von dort aus in ein kleines Seebad in Mecklenburg, wo ich mit […] dear Arthur 8 Tage sein werde.“ Bei dem Begleiter des jugendlichen Kurgastes handelt es sich um Arthur Kunde, einen jungen Mann, den Klaus ein halbes Jahr zuvor während eines recht wilden Aufenthalts in Berlin kennen (und vielleicht auch lieben) gelernt hat. Doch gleich darauf unterbreitet der eben noch von seinen schwulen Abenteuern Schwärmende der Freundin einen Antrag: „Schreibe mir doch, solange ich noch hier bin und vor allem: komme ja nach Hiddensee. Ich fände es auch hübsch, wenn wir uns verlobten. Im Ernst. Was hältst Du davon? Denn ich liebe Dich und bin Dein Freund Klaus.“ Pamela muss nicht lange überlegen. Für sie ist das Zusammensein mit den Geschwistern Mann ein einziges Fest, ein unterhaltsames Abenteuer, und ein Verlöbnis kann dem Image, das alle drei sich verpassen, nur eine weitere schillernde Nuance hinzufügen. Also kritzelt sie auf eine Postkarte „Verlobung einverstanden“ und schickt sie an den Eremiten nach Stift Neuburg. Die Eltern in München werden informiert. Im Hause Mann reagiert man bestürzt und besorgt. „Was den Zauberer betrifft, so war unsere neue Gefährtin [Pamela] ihm entschieden unheimlich“ , erinnert sich Klaus Mann spitzbübisch. Thomas Mann, dem die offen gelebte Homosexualität seines Ältesten ein Dorn im Auge ist (wohingegen er selbst, der „Zauberer“, zeitlebens seine gleichgeschlechtlichen Neigungen unterdrückt und sublimiert), und der sich von Klaus Manns jugendlicher Schönheit und Vitalität gleichermaßen angezogen wie provoziert fühlt, ist keineswegs erbaut über die Heiratsabsichten des Sohnes und rät ihm, noch ein wenig zu warten, er sei ja erst siebzehn und für solch weitreichende Entscheidungen doch gar zu jung, „das ist das Malheur“ . Und auch Katia Mann klagt dem heiratswilligen Sohn gegenüber: „Was machen wir jetzt mit dir?“ Während man sich in der Poschinger Straße 1, dem Hause Mann in München-Bogenhausen, den Kopf zerbricht, ohne zu einem Schluss zu kommen, stürzt sich die Klatschpresse bereits auf das gesellschaftliche Ereignis. Denn dass die Kinder zweier bekannter deutscher Dichter heiraten, ist ein gefundenes Fressen. Zudem werden Gerüchte kolportiert, Pamela Wedekind habe als Schauspielerin ein Engagement an einer Berliner Bühne erhalten. Nur über den Namen des Theaters ist sich die Journaille uneins. Egal wie: ein „Geschmäckle“ hat die Sache allemal. Die Deutsche Allgemeine Zeitung fasst das einsetzende Pressegewitter spöttisch so zusammen: „Wir lasen in den Berliner Blättern, zuerst in denen, die um die dörrende Mittagszeit herauskommen: ›Pamela Wedekind, die Tochter Frank und Tilly Wedekinds, hat sich mit Klaus Mann, dem Sohne Thomas Manns, VERLOBT und ein Engagement am Deutschen Theater angenommen.‹ Am nächsten Tag: ›Intendant Jessner hat Pamela Wedekind, die sich mit Klaus Mann VERHEIRATET hat, an das Staatstheater verpflichtet.‹ Eigentlich hätte nun gestern die Meldung erscheinen müssen: ›Klaus und Pamela Mann sind mit ihren Kindern zur Erholung gereist.‹ […] Es ist ein eigen Ding um den Ruhm …“
Etwas pragmatischer als Klaus Manns Eltern reagiert in der ganzen Aufregung Pamelas Mutter Tilly Wedekind. Sie hat oft genug in Stücken ihres verstorbenen Dichtergatten vor und hinter der Bühne gestanden, um zu begreifen, dass Theater und Realität verschiedene Dinge sind, und dass manches Drama, das gegeben wird, allenfalls zur Farce taugt. In der Deutschen Allgemeinen Zeitung widerspricht sie allen Meldungen über ein Verlöbnis und Pamelas jähen Karrierestart. Noch viel später, in ihren Memoiren, erinnert sich die alte Dame kurz und knapp und mit einem hörbaren Stoßseufzer: „Diese Kinder! Als Klaus und Pamela sechzehn [sic] waren, stand plötzlich in allen Zeitungen, sie hätten sich verlobt. […] Ich hielt die Verlobung für Unsinn und ließ sie dementieren.“
Doch mit dem offiziellen Dementi sind noch keineswegs alle Wogen geglättet. Die Meldung hat so manches Familienmitglied nicht nur konsterniert, sondern auch verletzt. Wie reagiert Erika Mann unmittelbar auf die Nachricht vom Verlöbnis ihres Lieblingsbruders just mit der Frau, die von ihr begehrt wird? Wir wissen es nicht. Erst ein Brief vom 23. Juli 1924, den Erika von der Insel Hiddensee an Pamela schreibt, ist erhalten. Sie ist gemeinsam mit den Eltern in Kloster in der Pension „Haus am Meer“ der Irene von Sydow einlogiert. Die Manns verbringen viel Zeit mit Gerhart Hauptmann, der hier ebenfalls die Ferien genießt (das Haus Seedorn, heute Museum, wird er erst 1929 erwerben und zu einem repräsentativen Dichterdomizil umbauen lassen). Die Abende verlaufen recht feuchtfröhlich. Erika streicht Hauptmann, dem Nobelpreisträger von 1912 (Thomas Mann hat die höchste literarische Auszeichnung noch nicht erhalten und sieht dem Treiben recht verkniffen zu), „durchs schön weiße Häärle“ . Der revanchiert sich mit einem Kuss. Erika indes sehnt sich nach Klaus, und mehr noch nach Pamela, und tut so, als sei nichts „geschehen“, wenn sie die Freundin mit lockenden Worten umwirbt: „Liebes Leben! Du kannst es nicht ahnen, wie schön das Meer ist, – zum Weinen schön. […] Jetzt stürmt es toll und ich gehe baden. Komm doch, es ist so schön und die Wellen sind lebensgefährlich.“ Ja, das Leben ist für diese jungen Menschen noch ein einziges Abenteuer, selbst wenn es gefährlich ist, und rasch wird aus Spiel Ernst, und umgekehrt wird der Ernst gern ignoriert oder ins Lächerliche konterkariert. Freilich, die Schlusszeile von Erikas Brief an Pamela lässt aufhorchen, verweist sie doch auf ein nicht überliefertes Schreiben, das offensichtlich kurz zuvor, nach der Nachricht von der Verlobung, verfasst worden ist: „Ich kann es selbst nicht verstehen, wie ich so sauhäßlich schreiben konnte.“ Daraus klingt mehr als eine Entschuldigung: Auch Schmerz schwingt mit, und Enttäuschung über den Verrat von Bruder und Freundin. Ganz so leicht sind die erlittenen Wunden nicht zu verbergen, so schnell schließen sie sich nicht.
Noch jemand aus dem engen Kreis um Pamela sieht sich enttäuscht und verbirgt dies hinter der Maske des Spotts: Kadidja Wedekind, Pamelas fünf Jahre jüngere Schwester, ein ruhiges, sensibles, hochtalentiertes Mädchen. Von ihr sind Zeichnungen und Verse erhalten, die zu ihren Lebzeiten nie veröffentlicht wurden. Eine der Zeichnungen zeigt einen effeminierten Klaus Mann, die eine Hand abwehrend erhoben, das Gesicht hinter der anderen verborgen, als weinte er. Vor ihm steht Pamela als Domina, mit strengem Gesichtsausdruck. Sie sieht den Bräutigam strafend an, in der Hand hält sie eine Gerte. Über den Bräutigam schrieb Kadidja die Spottverse: „Das ist der Mann / der schreiben kann / trotzdem sein Vater schreibt / und dem trotz Vater’s feinem Kopf / das eigne Köpfchen bleibt. / Das ist ein Mann / und doch kein Mann / der wie ein Weib sich schmückt. / Oh ihr Verleger seht euch vor / er haut euch tückisch übers Ohr / und lächelt nur entrückt!“
Und der so angegriffene Klaus Mann? Er verhält sich irrational, kommt wenige Tage später ebenfalls nach Hiddensee, wo er sich von Gerhart Hauptmann, dem Inselkönig, den Segen spenden lässt, woraufhin Thomas Mann eifersüchtig witzelt: „Na, wenn das nicht anschlägt.“ „Eine Bemerkung“, so Klaus Mann noch acht Jahre später, „die mich nachhaltig verletzte.“ Wenig später verlassen die Dichterkinder die Insel und wechseln nach Bansin auf Usedom, wo sie – unbeobachtet von den Eltern und inkognito vor der Presse – sorglose Sommertage verbringen. Pamela stößt zu ihnen, und alles scheint wie vor dem großen Eklat. Ausgelassen genießen die drei jungen Leute den Sommer, das Strandleben, die Attraktionen und sind zu allerlei Unsinn und Schabernack aufgelegt – fast wie in den guten alten Zeiten der Kindheitsjahre in Bogenhausen. Klaus Mann erinnert sich voller Wehmut: „Der erste Sommer, den wir zusammen waren: schien uns nicht, daß nun kein Sommer anders mehr für uns werden dürfe? – Wir spazierten von Bansin nach Heringsdorf. Dort gab es den ordinärsten Rummel. Erika beteiligte sich in einem Strandcafé an einer schauspielerischen Konkurrenz; ein Tisch von sächsischen Chauffeuren sprach ihr den ersten Preis – eine Flasche Champagner – zu, weil sie Liliencrons ›Bruder Liederlich‹ so knorke aufgesagt hatte.“ Doch nach wenigen Tagen reist Klaus Mann überstürzt ab: „Immer war es meine unruhige, fatale Art, weg zu müssen, wenn gerade alles am besten schien.“ Er fährt nach München, zu Ricki Hallgarten, dem Nachbarssohn aus Bogenhausen, mit dem er eine Freundschaft, wohl auch eine Liebelei, unterhält. Die Illusion von der Verlobung war nur ein „Sommermärchen“, auch wenn Klaus Mann noch Jahre später behauptet: „Wir [Pamela und Klaus] meinten es ernst, höchstens sehr nebenbei aus Bluff und um die Leute zu schrecken.“
Die Leute (von den Eltern einmal abgesehen) sind weniger erschrocken denn belustigt. Und Federn lassen mussten eigentlich nur die Beteiligten. Dichterkinder spielten Theater. Klaus Mann wollte nicht nur zu seinem Freund Ricki. Er will nun echtes Theater machen: Ihm schwebt ein Bühnenstück vor, und er zieht sich in sein Kinderzimmer im Münchner Elternhaus zurück, um – mithilfe von Zigaretten und viel Parfüm – eines zu schreiben. Er hat ja schon so viel erlebt – glaubt er zumindest.
„Wir erschienen mit blutigen Bißwunden an Händen und Hals“
Dichterkinder und ihre Spiele. 1905 –1918
Er ist ein Prinz, und er weiß es: Thomas Mann, Schöpfer der Buddenbrooks, Sprössling aus lübischem Kaufmannsgeschlecht. Doch sosehr er selbst sich als etwas Besonderes, Hoheitliches sieht: Seine Umwelt ist sich im Jahre 1904 der literarischen Bedeutung seiner Bücher noch keineswegs durchweg bewusst. Der große Familien- und Gesellschaftsroman Buddenbrooks, 1901 im Verlag Samuel Fischers erschienen, hat keinen guten Start: Von der ersten Ausgabe werden gerade einmal eintausend Exemplare verkauft. Zwei Jahre später erfolgt eine günstigere Neuausgabe, auch hiervon können nur zweitausend Exemplare abgesetzt werden. Der große Erfolg des Romans setzt erst in den folgenden Jahren ein. Und 1929 schließlich wird Thomas Mann, inzwischen vierundfünfzigjährig, mit der höchsten literarischen Auszeichnung, dem Nobelpreis, bedacht: bezeichnenderweise nicht für seinen großen Zeitroman Der Zauberberg, sondern für seinen Erstling Buddenbrooks. Aber von diesem Welterfolg kann der Autor im Jahre 1904 nicht einmal träumen.
Dennoch wird dieses Jahr für Thomas Mann zur Schicksalswende. Der psychisch labile junge Mann, der – aus angesehenem, aber nach dem Tod des Vaters in Liquidation gegangenem Handelshaus stammend – mit seinem Status als Künstler hadert und sich durchaus der gesellschaftlichen und persönlichen Gefährdung bewusst ist, die von seiner verkappten homosexuellen Neigung ausgeht, begegnet einer Frau, in die er sich verliebt, und die – das kann er zum damaligen Zeitpunkt nicht ahnen – seine treue Lebensgefährtin werden wird, seine Stütze, die Mutter seiner Kinder, die Sachwalterin seiner Literatur, kurz: seine Prinzessin. Ihr Name: Katia Pringsheim.
Während Katias zukünftiger Ehemann einer zwar angesehenen, aber infolge des Bankrotts etwas zweifelhaften Familie entstammt, gehören die Pringsheims zu den prominentesten und wohlhabendsten Familien Münchens: Vater Alfred Pringsheim lehrt als Professor für Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität, die Mutter Hedwig ist eine Frau von Schönheit, Charme und Verstand, die in jungen Jahren als Schauspielerin Erfolge feierte. Deren Mutter wiederum ist die berühmt-berüchtigte schriftstellernde Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, die 1876 mit dem Pamphlet Der Frauen Natur und Recht, worin sie unter anderem das Stimmrecht für Frauen einforderte, für Furore sorgte. Die Pringsheims bewohnen ein repräsentatives Stadtpalais in der Münchener Arcisstraße 12, erbaut im Stil der Neorenaissance, im Innern üppig mit schweren Kassettendecken, erlesenen Parkettböden und wertvollen sezessionistischen Fresken ausgestattet. Es ist ein offenes, kunstliebendes Haus. Vater Pringsheim ist ein glühender Verehrer Richard Wagners, der rund vierzig Jahre zuvor unter dem kunstsinnigen König Ludwig II. an der Isar Erfolge feierte.
Die 1883 geborene Katia ist die jüngste Tochter des Ehepaars Pringsheim. Sie hat einen Zwillingsbruder namens Klaus (nach ihm wird später Katias erster Sohn benannt werden). Die fünf Pringsheim-Kinder sind in ganz München als ausgesprochen hübsch bekannt – kein Wunder, dass der Malerfürst Friedrich August von Kaulbach sie 1888 als Pierrots in Öl porträtiert hat. Das Bild erfreute sich vor dem Ersten Weltkrieg großer Popularität und wurde in Fotografien, über Zeitschriften und als Kunstpostkarte verbreitet. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass Thomas Mann als Siebzehnjähriger eine Reproduktion in der Leipziger Illustrirten Zeitung entdeckte, ausschnitt und mit Reißzwecken an die Wand seines Zimmers heftete.
Zwölf Jahre später begegnet er dem Pierrot, der auf dem Ölgemälde ganz links dargestellt ist, persönlich: Aus dem kleinen Mädchen ist eine hübsche, kluge, selbstbewusste Frau geworden. Katia Pringsheim, die als „Externe“ mit siebzehn das Abitur glänzend absolviert hat, ist nun einundzwanzig und Studentin der Naturwissenschaften. In seinem 1909 erschienenen Roman Königliche Hoheit hat Thomas Mann sich selbst und seine Braut in den Figuren des Prinzen Klaus Heinrich und der Imma Spoelmann augenzwinkernd literarisiert.
Weit bodenständiger hat Katia Mann im hohen Alter ihre Erinnerungen an das erste Treffen mit dem Schriftsteller wiedergegeben, eine Begegnung gleichwohl, von der sie damals gar nichts ahnte, wurde sie doch von Thomas Mann ohne ihr Wissen beobachtet. Die Szenerie: Eine Straßenbahn in München. Katia Mann erzählt:
„An einer bestimmten Stelle, Ecke Schelling-/Türkenstraße, mußte ich aussteigen und ging dann zu Fuß, mit der Mappe unterm Arm. Als ich aussteigen wollte, kam der Kontrolleur und sagte: Ihr Billet!
Ich sag: Ich steig hier grad aus.
Ihr Billet muß i ham!
Ich sag: Ich sag Ihnen doch, daß ich aussteige. Ich hab’s eben weggeworfen, weil ich hier aussteige.
Ich muß das Billet –. Ihr Billet, hab ich gesagt!
Jetzt lassen Sie mich schon in Ruh! sagte ich und sprang wütend hinunter.
Da rief er mir nach: Mach daß d’ weiterkimmst, du Furie!
Das hat meinen Mann so entzückt, daß er gesagt hat, schon immer wollte ich sie kennenlernen, jetzt muß es sein.“
Einige Zeit darauf begegnen sich beide im Hause gemeinsamer Bekannter. Wenig später laden Pringsheims den jungen Autor in ihr Stadtpalais ein. Dort macht der gut erzogene, höfliche Hanseat durchaus Eindruck – freilich ahnen die Eltern Pringsheim nicht, dass der Literat ein Auge auf die Tochter geworfen hat. Der jedenfalls ist von der selbstbewussten, burschikosen Studentin verzaubert. In einem Brief an seinen Bruder Heinrich vom 27. Februar 1904 preist er Katia in höchsten Tönen, sie sei „ein Wunder, etwas unbeschreiblich Seltenes und Kostbares, ein Geschöpf, das durch sein bloßes Dasein die kulturelle Thätigkeit von 15 Schriftstellern oder 30 Malern aufwiegt“.
Doch so rasch und umstandslos ist der Pierrot aus dem Hause Pringsheim nicht zu haben. Auf einem Radausflug im Münchner Umland fährt Katia dem verliebten, aber weniger sportlichen Literaten schlicht davon. Und obwohl Hedwig Pringsheim von ihrem Buchhändler versichert bekommt, Thomas Mann werde einmal mindestens so berühmt wie Gottfried Keller werden, ist Alfred Pringsheim doch skeptisch. Ebenso wie Katia übrigens: Sie sei, bekennt sie im Alter, „nicht so sehr enthusiasmiert“ gewesen: „Ich hatte erst einige Widerstände, dachte nicht daran, so früh zu heiraten, und habe gesagt: Wir kennen uns ja noch gar nicht genug.“
Die junge Frau will noch nicht ihre Freiheit aufgeben. Sie genießt das Leben und ihr Studium, sie spielt Tennis und ist viel mit ihren vier Brüdern unterwegs. Eine Ehe, so weiß sie, bedeutet die Preisgabe all dessen, denn ihre Freiheit wird ihr nur zugestanden, weil sie eine verwöhnte Tochter aus reichem Hause ist. Die Gesellschaft der damaligen Zeit erwartet aber von einer Ehefrau Unterordnung und Hintanstellung eigener Interessen, egal wie ihr sozialer Stand ist.
Doch der verliebte Literat lässt nicht nach und kann Katia und deren Eltern schließlich überzeugen. Am 11. Februar 1905 heiraten Thomas Mann und Katia Pringsheim. Der Schriftsteller, wie stets korrekt gekleidet, macht auf die Hochzeitsgesellschaft dennoch einen etwas eigentümlichen Eindruck, wie Katia erzählt: „Ich muß gestehen, sie nannten zunächst Thomas Mann immer den leberleidenden Rittmeister, weil er nämlich etwas bläßlich war und schmal, und dann war er sehr korrekt mit seinem Schnurrbart und in seinem ganzen Auftreten. Aber das war nicht bös gemeint. Wirklich gegen die Heirat war niemand.“ Doch, eine schon: Hedwig Dohm, Katias emanzipierte Großmutter; sie ist sehr wohl enttäuscht, weil Katia wegen der ehelichen Konvenienz ihr Studium nicht abschließt. Der Bräutigam ist ihr ohnehin suspekt. Noch Jahre später wird die uralte, aber nach wie vor resolute Dame den Ehemann der Enkelin als verdammten alten Anti-Feministen beschimpfen – und nicht einmal Widerspruch ernten.
Die Hochzeitsreise geht nach Zürich, ins Luxushotel „Baur au Lac“. Die Eltern Pringsheim bezahlen die Tour. Ebenso wie auch die Siebenzimmerwohnung samt Mobiliar, Bibliothek und Ausstattung, die Thomas und Katia nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen in der Münchner Franz-Joseph-Straße 2 beziehen. Dem Dichter, der sich selbst in seinem Roman Königliche Hoheit als Prinzen beschreibt, und seiner Frau soll es nicht an Bequemlichkeit und bürgerlicher Etikette mangeln.
München sonnt sich in seinem Nimbus einer Stadt der Künstler, der Schönheit, des freien Lebens. Die Nähe zu Italien, die bereits südliche Atmosphäre, die barocke und klassizistische Aura der Isarstadt und die geruhsame Sinnlichkeit der oberbayerischen Landschaft locken Maler und Schriftsteller, Architekten und Musiker an. Der Dichter Karl Wolfskehl lobpreist die Stadt: „Es gab durch das ganze Jahrhundert und darüber hinaus […] neben Paris nur noch eine Geisteshauptstadt mit nach allen Seiten offenen Toren, alles aufnehmend, allverstehend und allbildend und in seinem kleineren Ausmaß ebenso wichtig: München und noch einmal München. […] Hier wurde alles menschlicher, in einem fast griechischen Verstande sinnenhaft, hier kam man ›zu sich‹, hier fielen die Hemmungen von Herkunft und Gewohnheit, hier mochte man sich geben oder bewahren, hier war Licht und helle hohe Luft, Freiheit und Einsamkeit für jeden, den danach verlangte.“
Auch Thomas Mann, ein „Reingeschmeckter“ aus dem protestantischen Norden, fühlt sich von Anbeginn in der Isarmetropole wohl, aufgehoben und angenommen. In seiner Erzählung Gladius Dei von 1902 rühmt er die Stadt geradezu hymnisch: „München leuchtete. Über den festlichen Plätzen und weißen Säulentempeln, den antikisierenden Monumenten und Barockkirchen, den springenden Brunnen, Palästen und Gartenanlagen der Residenz spannte sich strahlend ein Himmel von blauer Seide […].“
Bereits am 9. November 1905, genau neun Monate nach der Hochzeit, kommt im Hause Mann das erste Kind zur Welt, ein Mädchen, das auf den Namen Erika getauft wird. Eigentlich hat sich Thomas Mann einen Stammhalter gewünscht, und so schreibt er ernüchtert an den Bruder Heinrich: „Es ist also ein Mädchen: eine Enttäuschung für mich, wie ich unter uns zugeben will, denn ich hatte mir sehr einen Sohn gewünscht und höre nicht auf, es zu thun. Warum? ist schwer zu sagen. Ich empfinde einen Sohn als poesievoller, mehr als Fortsetzung und Wiederbeginn meinerselbst unter neuen Bedingungen.“
Auch der alten Hedwig Dohm gegenüber äußert er sich den negativen Erwartungen gemäß: Als sie den werdenden Vater fragt, ob er sich lieber einen Jungen oder ein Mädchen wünsche, gibt der zur Antwort: „Natürlich einen Jungen. Ein Mädchen ist doch nichts Ernsthaftes.“ Und selbst Katia Mann gibt sich enttäuscht: „Es war also ein Mädchen, Erika. Ich war sehr verärgert. Ich war immer verärgert, wenn ich ein Mädchen bekam, warum, weiß ich nicht.“ Noch ahnen die Eltern nicht, dass just diese Tochter – es werden noch fünf weitere Kinder folgen – ihnen im Alter die größte Stütze sein wird, ja, dass Erika sogar des Vaters treueste und fähigste Managerin und literarische Sachwalterin werden wird, bis über dessen Tod hinaus. Es wird jedoch nicht lange dauern, und der junge Vater wird sein erstes Kind sehr lieb gewinnen, es in späteren Jahren den jüngeren Geschwistern sogar vorziehen. Katia Mann selbst hat das bezeugt: „Mein Mann war viel mehr für die Mädchen. Obgleich er ein Mädchen für nichts Ernsthaftes hielt, war Erika immer sein Liebling.“
Wie dem auch sei: Dem erhofften Stammhalter ist schon im Voraus eine Bürde in die Wiege gelegt. Als ein Jahr später, am 18. November 1906, ein Knabe zur Welt kommt, wird er symbolbeladen nach der Hauptfigur des eben entstehenden neuen Romans Königliche Hoheit auf die Namen Klaus Heinrich getauft – oder auch nach Katias Zwillingsbruder Klaus. Jedenfalls ist es ein Name, der schwer wiegt: Es ist ein literarisches Spiel, worin der immer berühmter werdende Thomas Mann sich selbst dupliziert. Der Prinz hat einen Prinzen gezeugt. Diesem hohen Anspruch kann Klaus Mann zeitlebens nicht gerecht werden.
Andererseits scheint sich das engste Verhältnis, das zwei Menschen wohl aneinander binden mag, zu wiederholen: die Zwillingschaft. Katia Mann und ihr Zwillingsbruder Klaus Pringsheim stellen eine symbiotische, verschworene Gemeinschaft dar. Klaus Mann hat dies bereits als Kind beobachtet und später in Der Wendepunkt so analysiert: „Das Gespräch zwischen den beiden wimmelte von geheimen Formeln, zärtlichen Anspielungen, rätselhaften Scherzen. Die zwei seltsamen Kinder schienen in einer Welt für sich zu leben – beschützt von ihrem Reichtum und von ihrem Witz, bewacht und verwöhnt von Bedienten und Verwandten.“
Das Zwillingsmotiv wiederholt sich: Erika und Klaus Mann werden sich zeitlebens als solche fühlen, mit allen Freuden, Belastungen und Komplexen. „Denn im Bereich des wirklichen Lebens gehörten Erika und ich zusammen“, schreibt Klaus Mann rückblickend noch in den Vierzigerjahren, „unsere Solidarität war absolut und ohne Vorbehalt. Wir traten wie Zwillinge auf.“
Bis 1919 folgen noch weitere Geschwister, zwei Mädchen und zwei Knaben: 1909 kommt Angelus Gottfried Thomas zur Welt, der zeitlebens nur Golo gerufen und unter diesem Namen als Historiker berühmt werden wird. 1910 folgt Monika (auch sie wird Schriftstellerin). Nach einer längeren Pause bringt Katia im Jahre 1918 Elisabeth zur Welt, die später eine anerkannte Meeresbiologin wird, und 1919 das sechste und letzte Kind Michael, der Bratschist und Germanist werden wird.
Die Geschlechterrollen der ältesten Geschwister Erika und Klaus scheinen von Anfang an vertauscht. Das äußert sich bereits in der Kleidung. Klaus erinnert sich: „Unsere ›künstlerische Aufmachung‹, das sind die Leinenkittel mit den hübschen Stickereien aus den Münchener Werkstätten. Mielein [Katia Mann] hat sie selber ausgesucht, rote Kittel für die Buben, blaue für die Mädchen, wie es sich gehört.“ Doch nicht nur äußerlich scheinen Erika und Klaus komplementär. Auch in ihren Verhaltensmustern, was „typisch“ Weibliches und Männliches anbelangt, tauschen sie die Rollen: Erika ist die Jungenhafte, die klettern, schwimmen, raufen kann, den bayerischen Dialekt spricht, damit in der Münchner Tram ihren derben Schabernack mit Fahrgästen treibt und vor nichts Angst hat. Klaus hingegen ist eher furchtsam, früh zum Außenseiter gestempelt – und: er bewundert und verehrt seine Schwester. „Erika“, so schreibt er, „war die Rüstigste von uns. Sie konnte wie zwei Buben turnen und raufen, und sah aus wie ein magerer, dunkel hübscher Zigeunerjunge, dessen braune Stirn sich manchmal trotzig verfinstert. Als einzige von uns beherrschte sie die bayerische Mundart, die ich niemals erlernt habe. Wenn eines von den Kindern des [Tölzer] Zwickerbauern, mit denen wir manchmal spielten, sie fragte: ›Ärika, magst an Äpfi?‹, konnte sie in ganz ähnlichem Tonfall antworten, was mir doch einfach unmöglich gewesen wäre.“
Dies sind Erinnerungen an die glücklichen Wochen und Monate im Sommerhaus der Familie, das Thomas Mann, der nach und nach zu einem wohlhabenden Bestsellerautor arriviert ist, sich im Jahre 1908 in Tölz im bayerischen Oberland hat erbauen lassen. Die Villa ist inmitten eines großen, baumbestandenen Grundstücks gelegen. Hier verbringt die Familie bis zum Jahre 1917 – als Thomas Mann das Haus veräußert, um in patriotischer Begeisterung Kriegsanleihen zu zeichnen – die Sommermonate. Einige Erzählungen Klaus Manns – so die Kindernovelle – spielen hier. „Das Paradies“, so Klaus wehmütig, „hat den bittersüßen Duft von Tannen, Himbeeren und Kräutern, vermischt mit dem charakteristischen Aroma des Mooses, das von der Sonne durchwärmt ist, der großen, mächtigen Sonne eines Sommertages in Tölz.“
Das Haus am Hang oberhalb des Städtchens steht noch heute. Hier ersinnen Erika und Klaus ihre Spiele, mit den kleinen Geschwistern Monika und Golo als Komparsen. Da ist zum Beispiel das „Gro-Schi-Spiel“: Haus und Garten verwandeln sich in einen Ozeandampfer, das Kindermädchen, die kleinen Geschwister, der Vater und der Hund Motz stellen in der Fantasie der Kinder Kapitän, Matrosen und Passagiere dar. Erika ist eine Prinzessin, Klaus und Golo sind die reichen Herren Steinrück und Löwenzahn. „Sie waren keine frivolen Draufgänger, unsere reisenden Millionäre“, erzählt Klaus, „vielmehr handelte es sich um zwei Herren gesetzten Alters, die eine schwere Last von Verantwortlichkeiten und väterlichen Sorgen zu tragen hatten. Kurze, aber inhaltsschwere Radiogramme informierten sie über die beunruhigenden Schwankungen an der Börse; atemlose Geheimboten überbrachten furchtbare Bulletins, das Betragen der fernen Söhne betreffend. Diese jungen Leute – typische Repräsentanten frivol-sybaritischer jeunesse dorée – verschwendeten Millionen für grandiose Ankäufe von Karamellbonbons und Schokoladentorten, worüber die geplagten Väter, nebeneinander auf dem Promenadendeck spazierend, sorgenvoll die Köpfe schütteln mußten.“
In der Nähe des Tölzer Sommerhauses befindet sich der Klammerweiher, ein mooriger Teich, dessen Wasser die Glieder golden färbt. Erika und Klaus lernen hier das Schwimmen, die Schwester leicht, der Bruder nur unter Mühen. In der Kindernovelle hat Klaus Mann das Gewässer verewigt: Dort schwimmt und taucht der junge Till – erotische Projektion des jugendlichen Autors – und verwirrt die Betrachter durch seine nackte Schönheit. George Hallgarten, Rickis älterer Bruder, verbindet in der Rückschau den Klammerweiher mit dem Verlust kindlicher Unbedarftheit: „In ihrem [Manns] Garten [in Tölz], oder ihm nahe, war ein Weiher […], worin verschiedene von uns, darunter Erika und ich, im Stande der Unschuld herumpuddelten, als ich Manns mit meinen Eltern beratschlagen hörte, ob denn das Baden, ganz ohne etwas an, in solchem Alter noch statthaft und ratsam sei. Nun, man kann ein großer, ja vielleicht der größte Menschenkenner der Zeit und Psychologe sein, und es doch mit Kindern nicht ganz verstehen. Jene Bemerkungen, so schrieb ich ›Onkel Thomas‹ später […], hätten mich plötzlich sehend gemacht, so daß ich mich wie Adam gefühlt hätte, als man ihm den Apfel gereicht.“
Der Klammerweiher indes führt die Kinder Erika und Klaus auch zum ersten Mal bewusst an den Tod heran: Eines Tages ertrinkt darin ein Bäckergeselle, und die Geschwister kommen mit dem Kindermädchen Affa zur Leichenhalle, wo der Verunglückte aufgebahrt liegt. Klaus’ eigene fatale Nähe zu den Verführungen des Todes mag damals berührt worden sein. „Worauf tat er sich denn so viel zugute, der Schweigende dort zwischen den Blumen und Kerzen?“, schreibt er später über dieses Schlüsselerlebnis. „Hatte er denn eine Heldentat vollbracht, indem er im Klammerweiher ertrank? Oder war es die bloße Tatsache, daß er tot war, die ihn so prinzlich und so kostbar machte? […] wir standen reglos, versunken in das Bild dieser unbegreiflichen Hoheit, als Affas Stimme uns mahnte: ›Zeit zum Nach-Hause-Gehen, Kinder! Jetzt habt ihr ihn ja gesehen.‹“
Erika und Klaus zeigen schon früh eine ausgeprägte sprachliche Fantasie mit eigenen Codierungen. Sie unterhalten sich in einem Idiom, das von den Erwachsenen nur schwer verstanden wird (wie es ja auch Katia Mann und ihr Zwillingsbruder Klaus tun). Nahezu alle Mitglieder der Familie Mann besitzen Necknamen, die meist auf die ältesten Geschwister zurückzuführen sind. So heißt Katia Mann „Mielein“, Klaus „Eissi“, die Großeltern Pringsheim „Offi und Ofey“ oder einfach nur die „Urgreise“. Thomas Mann ist der „Zauberer“ oder kurz „Z.“, weil er einmal ein angebliches Gespenst (Klaus nennt es „Me-Me“), das im Kinderzimmer sein Unwesen trieb, mit Erfolg in die Schranken gewiesen hat: „Sagt ihm nur, daß ein Kinderschlafzimmer kein Ort ist, wo anständige Geister sich herumtreiben, und daß er sich schämen sollte. Und wenn das immer noch nicht genügt, so tut ihr gut daran hinzuzufügen, daß euer Vater sehr reizbar ist und häßlichen Spuk in seinem Haus nicht duldet. Dann wird er sich bestimmt aus dem Staube machen. Denn es ist eine in Geisterkreisen wohlbekannte Tatsache, daß ich wirklich sehr schrecklich sein kann, wenn ich einmal die Geduld verliere.“
Nicht nur im Erfinden neuer Wörter sind Erika und Klaus Meister. Erika kann auch die unterschiedlichsten Idiome nachahmen. In der Kindheit ist das noch der bayerische Dialekt, in dem sie sich mühelos mit den Bauernkindern unterhält, während Klaus hingegen in der Schule als „Saupreiß“ gehänselt wird. Später, als erwachsene Frau, imitiert sie des Vaters Literatursprache und deren ironische Brechung im alltäglichen Gespräch, sodass der Schriftsteller Ludwig Marcuse fassungslos feststellt: „Sie beherrschte die Thomas-Mann-Sprache fließend, wie nur eine Eingeborene. Der Schöpfer dieses bekannten deutschen Dialekts schrieb ihn nur; die Tochter aber sprach ihn – und trieb soviel Allotria damit, daß er sie gewiß beneidete.“
Nicht nur im ländlichen Tölz treiben die Mann-Kinder ihren Schabernack, auch in München-Bogenhausen sind sie und ihre Freunde verschrien. 1910 wechselte die Familie von Schwabing nach Bogenhausen, rechts der Isar, damals noch ein ländlich-vorstädtischer Bezirk, der sich jedoch mehr und mehr zum Villenviertel wandelte. Zuerst bezogen sie eine Wohnung in der Mauerkircherstraße 13, Anfang 1914 schließlich eine neu erbaute herrschaftliche Villa in der Poschingerstraße 1, im sogenannten Herzogpark. Dieses Gelände, um 1910 als Baugebiet ausgewiesen, gehörte einst Herzog Karl Theodor von Bayern. Es ist damals halb Wiesengrund, halb vernachlässigter Wald. Thomas Mann hat den Charme dieser vorstädtischen Wildnis in seiner Erzählung Herr und Hund verewigt. Die „Poschi“ indes, wie die Villa von allen liebevoll genannt wird, ist der Dreh- und Angelpunkt der wachsenden Familie, und der Entstehungsort bedeutsamer Literatur – der von Thomas Mann, bald aber auch der ersten Romane, Dramen und Erzählungen Klaus Manns.
München ist in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg eine zwar glänzende und kulturell hochstehende Residenzstadt unter einem kunstbeflissenen, liberalen und volksnahen wittelsbachischen Herrscherhaus, besitzt aber durch die kleinbürgerlichen und handwerklichen Vorstädte und das stark traditionsgebundene bäuerliche Umfeld noch sehr bodenständigen, urigen Charakter. Bogenhausen ist noch wie ein groß gewordenes Dorf, bestehend aus den Alteingesessenen und den „Zuagroasten“: Man kennt sich, frotzelt ein wenig übereinander, aber verhält sich nach der urbayerischen Devise „leben und leben lassen“.
Ein gutes Maß an Liberalität – oder besser: gleichmütiger Nachsicht – müssen die Bewohner Bogenhausens in jenen Jahren gleichwohl aufbringen. Denn Erika und Klaus Mann und deren Freunde formieren sich – halb in kindlichem Übermut, halb aus einer vorpubertären Freude am bösen Spaß – zur „Herzogparkbande“ und treiben ihren nicht immer arglosen Unfug mit Bewohnern und Passanten (natürlich ohne Wissen der Eltern). Zu dieser „Gang“ gehören Kinder aus der Nachbarschaft: Lotte und Gretel Walter (die Kinder des Dirigenten Bruno Walter) und Ricki (Richard) Hallgarten.
Ricki gehört zu den Gefährdeten, wie sie wiederholt die Lebenswege von Erika und Klaus kreuzen: Der Sohn des Juristen und Germanisten Robert Hallgarten und der Frauenrechtlerin Constanze Hallgarten wird am 14. Januar 1905 geboren. Die Familie wohnt in der nahen Pienzenauerstraße 15. Rickis vier Jahre älterer Bruder George, der später ein bekannter Historiker wird, erinnert sich in seinem Lebensrückblick an die Bekanntschaft mit den beiden ältesten Mann-Kindern (wenngleich er sich in den Alterszuschreibungen ein wenig irrt): „Es handelte sich um ein braunäugiges und frisches, etwas schelmisch dreinschauendes Mädchen, das damals etwa zehn Jahre alt gewesen sein mag – ich war wohl [im Jahre 1913] gerade zwölf –, und einen etwa acht Jahre alten, also meinem Bruder [Ricki] gleichaltrigen Knaben, blond, etwas versonnen, und gleich seiner Schwester, mit ganz leicht betonter und geschweifter Nase. […] Die Namen der Kinder waren Erika und Klaus, und ihr Vater […] führte den Namen Thomas Mann. Es war der Beginn von Beziehungen, die von langer Dauer, und für meinen Bruder seelisch bestimmend werden sollten, doch ließ sich das noch nicht ahnen.“
Früh schon zeigt Ricki, dessen Taufpate kein Geringerer als der damals bekannteste deutsche Schriftsteller, der mit den Hallgartens befreundete Ludwig Ganghofer ist, zeichnerische Begabung. Später wird er Erika Manns Märchen Jans Wunderhündchen (1931) illustrieren, ebenso ihr Kinderbuch Stoffel fliegt übers Meer (1932). Aber er besitzt einen fatalen Hang zur Depression, einen Drang zur Selbstzerstörung – und steht vielleicht gerade deshalb Klaus Mann, der sich ein wenig in ihn verliebt, so nah. Der beschreibt ihn voller Zärtlichkeit: „Sohn einer hochkultivierten jüdischen Familie, war [er] ein attraktiver und besonderer Knabe. Wir kannten ihn seit frühester Kindheit […]. Er wirkte zugleich delikat und verwegen, wild und sensitiv. Die Fülle des dunklen, widerspenstigen Haares hing ihm in eine niedrige Stirn, die sich oft nervös verfinsterte. Die Augen, nah beieinanderliegend unter schön geschwungenen, starken Brauen, spiegelten mit rührender Aufrichtigkeit die stürmisch wechselnden Stimmungen seiner Seele. Er hatte den komplizierten, beunruhigenden Reiz eines morbiden Hirtenknaben, eines hysterischen Zigeuners. Er war witzig und naiv, unschuldig und verschlagen. […] wir gingen schwimmen und Schlittschuh laufen. Wir rauften und philosophierten und lachten und hörten Musik zusammen. […] zusammen, immer zusammen …“
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, verstärkt durch das Gespür für das Verwegene, Verruchte, Verbotene, wird zum inneren Antrieb für die nicht immer unschuldigen Streiche der „Herzogparkbande“: Sie erschrecken mit bunt geschminkten Gesichtern und wildem Geheul Spaziergänger. Mit verstellten Stimmen (Erika ist eine begnadete Stimmenimitatorin) rufen sie wildfremde Leute an: „Auch wie Delia Reinhardt konnte Erika sprechen, das ist die wunderbare Sängerin, für die damals alle Backfische Münchens schwärmten. So bat Erika, mit Delia-Stimme, verschiedene Backfische ans Telefon, um sie sanft und würdevoll zu einem Tee einzuladen, den sie für alle ihre jungen Freundinnen zu geben gedächte. Sämtlich sagten sie zu, mit Stimmen, die vor Freude zitterten. Es muß gräßlich für die arme Delia Reinhardt gewesen sein.“ Besonders mit Diebereien tun sich die Bandenmitglieder hervor: „Einmal arrangierten wir ein kleines Festmahl, bei dem alles gestohlen sein mußte, vom Rollschinken über die Orangen und den englischen Kuchen bis zum Mineralwasser und zum Klosterlikör – mit Bienenfleiß hatten wir’s innerhalb einiger Tage zusammengerafft.“ In der Straßenbahn entsetzt Erika in breitestem Bayerisch die anderen Fahrgäste mit grausigen Details über einen sadistisch veranlagten Verwandten. Gewonnen hat sie das Spiel – so die Regel –, wenn die Fahrgäste angewidert die Flucht ergreifen und vorzeitig aussteigen.
In der Poschinger Straße wird der böse Jux mit den Erwachsenen fortgesetzt: „Wir erschienen mit blutigen Bißwunden an Händen und Hals und mit kunterbunt hergerichteten Gesichtern zum Mittagessen.“ Die Eltern sehen diesem Allotria mit hilflosem Groll zu. Eine Zeit lang werden die Hanswurstiaden geduldet – solange der eigentliche Hausfrieden in der „Poschi“ nicht darunter leidet. Der besitzt einen Dreh- und Angelpunkt: Thomas Manns großzügig geschnittenes Arbeitszimmer, sein „Allerheiligstes“, befindet sich an zentraler Stelle des repräsentativen Hauses, im Erdgeschoss, mittig, mit einem großen Erker, dessen Türen auf die Veranda und den Garten hinausführen. Vormittags zwischen neun und zwölf ist im Haus Silentium zu wahren, wenn der „Zauberer“, der nicht nur Gespenster zu verscheuchen vermag, sondern vor allen Dingen ein Wortmagier ist, an seinen wundersamen Dichtungen arbeitet. Auch für die Kinder, so klein sie auch sein mögen, gilt dieses Gebot. Das Arbeitszimmer zu betreten ist ein Tabu (allenfalls Katia darf das, aber auch nicht ohne triftigen Grund). Abends liest Thomas Mann, gleichsam um die Seinen für die erwiesene Rücksicht und Geduld zu belohnen, aus den eben entstehenden Geschichten vor – Erika und Klaus Mann kommen so schon früh mit des Vaters Romanen und Erzählungen in Berührung und gehören wohl zu den besten Kennern seines Werks.
Doch nicht nur im großen Salon im Erdgeschoss entsteht Literatur: Im karg eingerichteten Knabenzimmer im zweiten Stock, unterm Mansardendach, übt sich der pubertierende Klaus im Erfinden von Geschichten und nötigt seinen Bruder Golo zum Zuhören: „Ich konnte erfinden wie die listige Dame der Tausendundeinen Nacht, so endlos und so phantastisch. […] Ich fabulierte von Königen, Hexen und orientalischen Großkaufleuten, wobei ich etwas mit der Zunge anstieß. Golo trippelte nebenher, das finster-schlaue Mäusegesicht vom glatten Pagenhaar witzig gerahmt, verzaubert von den Verwicklungen meiner Mären […].“ Kaum hat Klaus schreiben gelernt, füllt er Dutzende von Heften mit seinen Elaboraten. „In schärfstem Tempo entstand jene Fülle von Dramen, Romanen, Skizzen und Balladen, die ich mir fast alle aufgehoben habe und deren Masse mich so erschreckt“, urteilt er aus der zeitlichen Distanz. „Was ich mir nicht alles habe einfallen lassen!“ Golo wird von seinem Dichterbruder, der mit kindlich-unbeholfener Schrift seine Dramenhefte an Münchner Theater gesandt hat, sogar zu den Intendantenbüros geschickt, mit dem Auftrag, sich im Namen des „Herrn Klaus“ zu erkundigen, wann man die bedeutenden Werke aufzuführen gedenke?
Mehr zum gesprochenen Wort, zur Kunst der Schauspielerei, neigt Erika in jenen Kindheitsjahren – der „Familienfluch“ der Schriftstellerei ereilt sie erst später auf der Reise um den Globus. Wenn es dem Mädchen in der Schule nicht gefällt, täuscht sie gekonnt eine Kreislaufschwäche vor und sinkt ohnmächtig nieder. Als Onkel Peter Pringsheim einmal zu Besuch ist und bei Tisch Goethes Der neue Amadis rezitiert – immerhin ein Gedicht von dreißig Versen –, brilliert die siebenjährige Erika Stunden später damit, dass sie das Gedicht fast fehlerlos nach einmaligem Hören hersagt. Allerdings wird die Vorstellung für sie zur herben Enttäuschung, glaubt ihr doch keiner der Erwachsenen – Onkel Peter ausgenommen –, dass sie unterdessen das Gedicht nicht nachgeschlagen hat.
Gemeinsam verfassen die Geschwister in jenen Jahren auch erste eigene Verse. Ein Beispiel hierfür zitiert Klaus Mann in seinem Lebensbericht Kind dieser Zeit: „Meine ersten Gedichte machte ich mit Erika zusammen. Wir schrieben sie säuberlich ab, malten was Phantastisches drum und legten sie unserem armen Vater morgens unter die Serviette. Wenn er sich zum Frühstück niedersetzte, fand er, nahe seinem Eierbecher, Balladen von dieser Art: ›Der böse Mörder Gulehuh, / Der jagte eine bunte Kuh. / Die bunte Kuh, die sträubt sich sehr, / Der Gulehuh kriegt das Messer her. / Er haut der Kuh das Köpfchen ab, / Der Bauer kommt dabei im Trab. / Er hat den Gulehuh eingefangen, / In drei Tagen soll er am Galgen hangen. / Da weint der Mörder Gulehuh. / Da weint er sehr und schreit huhu – / Ich wills gewiß nicht wieder tun, / Um Gottes will’n, verzeiht mir nun!‹ – Und dann“, so Klaus augenzwinkernd, „sollte einem das Frühstück noch schmecken.“
Erika und Klaus erhalten zunächst Unterricht im Institut von Fräulein Ebermayer, einer Verwandten des Schriftstellers Erich Ebermayer, mit dem die Geschwister Jahre später Freundschaft schließen. Unterdessen ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen, und Thomas Mann brütet über seinen kulturpatriotischen Betrachtungen eines Unpolitischen – das Buch ist auch eine literarische Fehde, die er mit seinem kosmopolitischen Bruder Heinrich, dem „Zivilisationsliteraten“, ausficht. Thomas Mann wird zunehmend gereizt und ungeduldig, auch seinen Kindern gegenüber. Klaus schreibt als Erwachsener allerdings versöhnlich: „›Vater‹ bedeutet eine freundliche, sonore Stimme, die langen Bücherreihen im Arbeitszimmer – feierliches Tableau voll geheimnisvoller Lockung! –; der wohlgeordnete Schreibtisch mit dem stattlichen Tintenfaß, dem leichten Korkfederhalter, der ägyptischen Statuette, dem Miniaturporträt Savonarolas auf dem dunklen Grund; gedämpfte Klaviermusik, die aus dem halbdunklen Wohnzimmer kommt. […] Von neun Uhr morgens bis zwölf Uhr mittags muß man sich still verhalten, weil der Vater arbeitet, und von vier bis fünf Uhr nachmittags hat es im Hause auch wieder leise zu sein: Es ist die Stunde der Siesta. Sein Arbeitszimmer zu betreten, während er dort mysteriös beschäftigt ist, wäre die gräßlichste Blasphemie. Keines von uns Kindern hätte sich dergleichen je in den Sinn kommen lassen.“
Weniger verklärt sind hingegen die Erinnerungen Golos, der als alter Mann bekennt: „Am Vater hatte ich, hatten wir früher mit beinah gleicher Zärtlichkeit gehangen wie an der Mutter, das änderte sich während des Krieges. Wohl konnte er noch Güte ausstrahlen, überwiegend aber Schweigen, Strenge, Nervosität oder Zorn. Nur zu genau erinnere ich mich an Szenen bei Tisch, Ausbrüche von Jähzorn und Brutalität, die sich gegen meinen Bruder Klaus richteten, mir selber aber Tränen entlockten.“
Hart ist auch die Reaktion des Vaters auf eine lebensgefährliche Erkrankung des Sohnes Klaus im Frühsommer 1915. An die Verlegergattin Hedwig Fischer schreibt er zunächst erschüttert: »Ich wollte Ihnen Nachricht geben über unseren kleinen Dulder. Er macht Unglaubliches durch. Die schwere Bauchfellentzündung war so gut wie überstanden und wir wurden von Tag zu Tag zuversichtlicher, als Anzeichen für Darmverschluß auftraten – Verklebungen und Verwachsungen als Folge der Eiterung und des Heilungsprozesses. Es war eine neue, wirklich fast phantastische Operation nötig, die ungefähr darin bestand, daß die ganze Bauchhöhle geöffnet, das Gedärm herausgenommen, auf einen gewärmten Tisch gelegt, durchsucht, geöffnet und wieder eingenäht wurde: eine Sache von 1 ¾ Stunden. Das Herz hielt aus, auch nachher. Aber dann kam Darmlähmung – ein absolutes Versagen des Apparates, das drei Tage lang anhielt und eine neue Bauchfellentzündung wahrscheinlich machte. Gestern hielten wir das Kind für verloren.« Nach der überraschenden Rekonvaleszenz des Sohnes schreibt Thomas Mann hingegen schnoddrig: „Daß er durchkam, zeugt von einer Lebenskraft, die ich dem schlaffen kleinen Träumer nicht zugetraut hätte.“
Klaus Mann behauptet später hartnäckig, seine Mutter habe ihm das Leben gerettet, indem sie ihm – die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben – den Körper mit Kölnischwasser eingerieben und so die Tätigkeit des Organismus wieder angeregt habe. „So hat sie [die Mutter] eigentlich doppeltes Recht auf mein Leben“, schreibt er 1930 in einem Aufsatz mit dem Titel Das Bild der Mutter. „Der Gebrauch, den sie von diesem Recht macht, besteht darin, daß sie weiter hilft, wenn es nottut (es tut manchmal not), im übrigen allem den Gang läßt, den es nehmen will. Es war nicht immer ein einleuchtender Gang. Aber solange sie zuschaut, wird er sich niemals hoffnungslos verwirren.“ Zeitlebens ist seine Bindung an Katia Mann neben der zu Erika die wohl engste. Die Mutter hilft in ihrer unkomplizierten, praktischen Art und steckt dem Sohn immer wieder Geld zu (er kann seine bisweilen aufwendige Lebensführung – meist wohnt er in Hotels – nie durch eigene Honorare decken und ist bis zum Tode finanziell von den Eltern abhängig). Sie schenkt ihm Gehör, wenn ihn berufliche oder private Sorgen plagen, versucht stets, zwischen Vater und Sohn ausgleichend und versöhnend zu vermitteln. Dass sie – besonders gegen Ende seines Lebens – vielfach von Klaus’ Problemen überfordert ist, kann man ihr kaum verdenken.
Der Krieg und die zunehmenden Versorgungsengpässe gehen indes auch am vermögenden Hause Mann nicht spurlos vorüber. Nicht nur, dass Thomas Mann 1917 das Tölzer Domizil verkauft und das Geld in Kriegsanleihen anlegt; auch der „Kohlrübenwinter“ von 1917/18 verlangt von allen Opfer. Die Heizung fällt aus. Es gibt Margarinebrot mit Kunsthonig. Selbst im so vornehmen Haus der Großeltern Pringsheim wird am Sonntag nur ein „ausgemergelter Vogel“ aufgetischt, eine „Art Reiher von penetrant tranigem Geschmack“, und „scheußlicher rosa Ersatzpudding“ . An einem kalten Wintermorgen beschließen Erika und Klaus – denn so furchtbar ungebärdig und selbstsüchtig sind sie gar nicht –, die Mutter mit Eiern, die es auf dem freien Markt kaum noch gibt, zu überraschen. „Irgendwo in der Vorstadt“, erinnert sich Klaus, „hatten wir einen winzigen Laden entdeckt, in dem solche Kostbarkeiten zu haben waren, vorausgesetzt, daß man genug Zeit und Geduld hatte, um von sechs Uhr morgens bis zur Mittagsstunde anzustehen. Eben das taten wir – der köstliche Preis schien jedes Opfer wert. Wir bekamen die Eier. Wie glatt und appetitlich sie sich anfühlten! Sechs zerbrechliche Kleinode, ein halbes Dutzend zarter Talismane … Glückstrahlend machten wir uns auf den Heimweg. Ich trug die Eier in meiner Pelzkappe, da der Ladenbesitzer uns eine Papiertüte verweigert hatte. Aber meine bloßen Hände waren starr vom Frost. Das Schreckliche, das Unvermeidliche geschah: Die sechs Eier rollten aus der Mütze, die ich ungeschickt hielt, und zerbrachen vor unseren entsetzten Augen. Es war unbeschreiblich traurig, ja, es war wirklich zum Weinen, die schönen Dotter zu sehen, die – ein gelblich seimiges Bächlein – zwischen den Pflastersteinen versickerten. Wir brachen denn auch prompt in Tränen aus. Mir scheint es jetzt, daß unsere Tränen zu Eis erstarrten, während sie unsere Wangen hinunterliefen. Nie ist mir die Welt so kalt, so unfaßlich hart und grausam vorgekommen.“
In jenem Winter 1917/18 bricht im fernen Russland die Revolution aus, nachdem die deutschen Behörden Vladimir Iljitsch Lenin die Durchquerung des Reichsgebietes Richtung St. Petersburg in einem plombierten Zug zugestanden haben. Ein Jahr später werden auch in München, wo Lenin vor dem Krieg in unmittelbarer Nähe zu Thomas Mann gelebt hat, die Unruhen der Räterepublik wüten. Das bürgerliche Zeitalter geht zu Ende, aber nicht in melancholischem Verblühen wie in den Buddenbrooks, sondern mit einem lauten Knall. Im Hause des hanseatischen Dichters wird der Untergang der alten Werte symbolträchtig vom „niederen“ Stand besiegelt: Affa, das langjährige Dienstmädchen, unangreifbare Institution des Hauses, hat über Jahre hinweg gestohlen und sich ein ganzes Warenlager angelegt! Klaus Mann berichtet in einer Mischung aus ironischer Schadenfreude und scheuer Achtung:
„Es war anläßlich des Streites um den roten Wein, daß Affa die Hand gegen den Vater erhob. Ja, das Ungeheuerliche geschah: Sie schlug nach ihm mit geballter Faust und hätte ihm vielleicht das Nasenbein zertrümmert, wäre er nicht mit überraschender Geistesgegenwart beiseite gesprungen. Immerhin traf sie seine linke Schulter, woraufhin er, nach übereinstimmendem Bericht aller Chronisten, vernehmlich ›Au!‹ sagte. Einige Historiker wollen wissen, daß er nach kurzem Nachdenken auch noch hinzufügte: ›Da hört sich aber wirklich alles auf!‹ […] Affa hatte sich am Herrn des Hauses vergriffen! Es war das Äußerste, die Katastrophe. Es war Revolution. […] Ich begann, Affa zu bewundern. So viel Verderbtheit war eindrucksvoll. Einen schlechten Menschen kann man verurteilen und verachten; aber für das Symbol aller Schlechtigkeit, den Ausbund aller Laster empfindet man eine Art von bestürztem Respekt, in welchen sich Mitleid mischt.“
Die Welt ist tatsächlich aus den Fugen geraten, im Großen wie im Kleinen. Unheimliches scheint sich in jenem Sommer 1918 anzubahnen. Der Krieg hat bislang an den fernen Fronten in Russland, Galizien und Flandern gewütet, in der Heimat hat man ihn in erster Linie in Gestalt von Hunger und Kälte erfahren. Doch wenige Wochen nach diesem ungehörigen Ereignis um die diebische Elster im eigenen Haus flutet der Krieg zurück nach Deutschland und wird in München besonders greifbar. Sein Name: Revolution!
„Jugend war eine Verschwörung, eine Provokation, ein Triumph“
Revolutionen. 1919 –1924
Mit dem Aufstand der Matrosen der in Kiel und Wilhelmshaven vor Anker liegenden deutschen Flotte am 29. Oktober 1918 beginnt in Deutschland die Revolution. Die Seeleute weigern sich, dem in ihren Augen sinnlosen Befehl zum Auslaufen nachzukommen, gilt doch der Krieg, nachdem die Westfront in breiten Abschnitten eingebrochen ist, als verloren. Die Aufstände weiten sich aus: In Bremerhaven, Bremen, Hamburg und andernorts verweigern die Matrosen den Dienst, verlassen die Schiffe und Kasernen und besetzen die Rathäuser. Ihrem Beispiel folgen Soldaten und Arbeiter in etlichen Städten des Deutschen Reichs und rufen nach dem Beispiel Russlands lokale Sowjetregierungen aus. Innerhalb weniger Tage danken alle regierenden deutschen Fürsten ab. Kaiser Wilhelm II. verlässt das Hauptquartier des deutschen Heeres im belgischen Spa und geht ins niederländische Exil. Ein Versuch des Reichskanzlers Max von Baden, die Monarchie innerhalb einer parlamentarischen Demokratie zu retten, scheitert bereits in den Anfängen: Der honorige Mann wird von den Hohenzollern erpresst, die Kaiserin droht ihm, seine Homosexualität öffentlich zu machen. Max von Baden zieht sich gekränkt zurück (und gründet in der Folge das angesehene Internat in Schloss Salem). Am 9. November ruft Staatssekretär Philipp Scheidemann (SPD) vom Balkon des Berliner Stadtschlosses die Republik aus. Mithilfe von Polizei und regierungstreuen Soldatenverbänden werden die lokalen Arbeiter- und Soldatenräte und deren Stadtregierungen bald beseitigt.
Auch im vermeintlich so friedfertigen München, dessen Bevölkerung den kunstsinnigen, liberalen Wittelsbachern grundsätzlich mit Sympathie gegenübersteht, bricht sich die stürmische Entwicklung Bahn. Am 8. November proklamiert der Schriftsteller Kurt Eisner (USPD) den „Freien Volksstaat Bayern“ und wird Ministerpräsident einer provisorischen Revolutionsregierung. Bereits am Abend zuvor hat König Ludwig III., den die Münchner wegen seines schlampigen Auftretens und seiner Liebe zur Landwirtschaft gern den „Millibauern“ genannt haben, die Residenz verlassen und ist mit seiner Familie nach Anif im Salzburger Land geflohen. Die Legende will wissen, dem König sei noch kurz vor seiner Flucht bei einem Spaziergang im Münchner Hofgarten ein Arbeiter begegnet, der, besorgt um seinen Landesherrn, ihm zugerufen habe: „Majestät! Gangan S’ hoam! Revolution is!“
Die Novemberrevolution in München verläuft im Großen und Ganzen unblutig. Allenfalls die Bürger in der Innenstadt bemerken etwas von den erregten Aufläufen, Demonstrationen und Versammlungen. Der Herzogpark rechts der Isar liegt in jenen Tagen friedlich da. Dennoch fühlt der zwölfjährige Gymnasiast Klaus Mann sich als Chronist berufen. In seinen Jugenderinnerungen Kind dieser Zeit zitiert er aus seinem Tagebuch jener Wochen: „Revolution! Revolution! Militärautos durchsausen die Stadt, Fensterscheiben werden eingeschmissen. Kurt Eisner ist Präsident; – zu lächerlich. Und trotzdem schmeichelt es einem zu denken, in hundert Jahren rede man von der bayerischen wie von der Französischen Revolution.“
Doch die so idealistisch begonnene Republik versinkt bald in einem blutigen Kampf um Revolution und Gegenrevolution. Ministerpräsident Kurt Eisner, dessen Partei USPD bei den ersten freien Wahlen zum bayerischen Landtag am 12. Januar 1919 eine empfindliche Niederlage einstecken muss (sie kommt landesweit auf gerade einmal 2,5 Prozent), wird am 21. Februar auf dem Weg zum Landtag von dem Studenten und Reserveleutnant Graf Anton von Arco-Valley erschossen. Am 18. März wird der Mehrheitssozialist Johannes Hoffmann zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Doch die junge Republik kommt nicht zur Ruhe. Am 7. April rufen kommunistische und sozialistische Kräfte unter Max Levien, Eugen Leviné, Ernst Toller und Gustav Landauer die Räterepublik aus. Es sind humanistisch gebildete Anführer, die recht idealistische Ansichten und Ziele hegen. Doch die Gewalt können sie nicht stoppen: Aus Berlin ziehen regierungstreue „Weiße“ Truppen auf München zu und schließen einen Belagerungsring. In der Stadt kommt es zu Übergriffen und Gewaltattacken, von linken wie rechten Kräften. Das Gros der Bevölkerung denkt und fühlt konservativ und hat nur ein Bedürfnis: dass die Ordnung wiederhergestellt werde.
Als am 30. April 1919 Rotarmisten im Hof des Luitpold-Gymnasiums mehrere Geiseln erschießen, um die anrückenden Regierungstruppen abzuschrecken, bewirkt dies gerade das Gegenteil: Die Arbeiterräte zerfallen in einen radikalen und einen gemäßigten Flügel (zu Letzterem gehören Toller und Landauer). Toller ist es auch, der eine Plünderung der „bourgeoisen“ Mann’schen Villa durch Rotarmisten gerade noch verhindern kann. Die „Weißen“ Truppen, die in den nächsten Tagen München einnehmen, gehen rigoros, brutal und unterschiedslos gegen tatsächliche und vermeintliche Revolutionäre vor. Beim Münchner Bürgertum – Bourgeoisie und Kleinbürgern – herrscht ohnehin Erleichterung über das – wenn auch blutige – Ende dieses „Spuks“.
George Hallgarten hat dies später so analysiert: „Bei uns in Bayern schlug das politische Pendel heftiger aus als im Norden. Die Mißstimmung Bayerns über das Vorherrschen des Preußentums im Krieg und insonderheit der Ärger der bayerischen Bauern über das von Berlin aus festgesetzte Höchstpreis-System erlaubte dem äußersten linken Flügel der Sozialdemokratie unter Eisner, sich in der Novemberrevolution der Gewalt zu bemächtigen. Nach Eisners Ermordung im Februar 1919 führte diese eigenartige Kombination sogar zur Errichtung einer Räterepublik und nach deren gewaltsamem Ende im Mai 1919 schlug dann der Wind um, und Bayern wurde binnen kurzem der Sitz einer ausgesprochenen Rechtsopposition. Diese Wendung hatte sich stimmungsmäßig im bayerischen Bürgertum von dem Augenblick an vorbereitet, als Eisner die Macht ergriff.“
Am 1. Mai 1919 erobern die „Weißen“ Truppen unter Einsatz von Artillerie die Münchner Innenstadt. Mehrere Hundert Räte und deren Sympathisanten werden getötet, sei es im Straßenkampf oder wenig später in den Gefängnissen. Ernst Toller kommt für mehrere Jahre ins Zuchthaus. Gustav Landauer wird am 2. Mai im Gefängnis Stadelheim von einem nationalistisch gesinnten Offizier brutal erschlagen – nicht nur wegen seiner Rolle in der Räterevolution, sondern auch wegen seines Judentums. Der antisemitische Korpsgeist in den Reihen der völkisch-nationalen Truppen bricht sich wieder Bahn. Die junge Weimarer Republik wird in den nächsten knapp vierzehn Jahren ihres Bestehens unter diesem Wiedererstarken antisemitischer und völkischer Tendenzen leiden und letztlich daran zugrunde gehen. Aber davon ahnt man im Deutschland des Jahres 1919 nichts.
Der jugendliche „Chronist“ Klaus Mann notiert am 8. Mai 1919 betroffen: „In unserer Schule war das Regiment einquartiert, das Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht getötet hat. – In unserem Schulhof sind zwei Spartakisten erschossen worden. Der eine, ein siebzehnjähriger Junge, ließ sich nicht einmal die Augen verbinden, [Lehrer] Poschenrieder sagte, das wäre fanatisch. Ich finde es heldenhaft.“
Es kehrt wieder Friede in München ein. Und dennoch: Mit der Ruhe im Hause Mann ist es vorbei, denn Erika und Klaus stehen mitten in der Pubertät. Und zugleich mit der körperlichen Entwicklung vollzieht sich ein geistiger Auf- und Ausbruch, dessen Heftigkeit die Eltern verunsichert. Wiederholt schleichen sich die Geschwister in das „Allerheiligste“, das Arbeitszimmer des Vaters, und lesen Bücher, für die sie nach Ansicht der Erwachsenen noch gar nicht reif sind: Es sind die Abseitigen, Verfolgten, Missverstandenen, Dekadenten, so Klaus Mann, denen damals sein ganzes Interesse und sein Mitgefühl gehören. Zu diesem etwas anrüchigen „Olymp“ zählen Autoren wie Novalis, Oscar Wilde, Walt Whitman, Georg Trakl, Herman Bang, Stefan George, Friedrich Nietzsche, Paul Verlaine und Arthur Rimbaud.
Es bleibt indes nicht bei der bloßen Lektüre. Die Geschwister wollen die dramatischen Werke der Weltliteratur auf die Bühne bringen. Am 1. Januar 1919 gründen Erika und Klaus zusammen mit Ricki Hallgarten den „Laienbund Deutscher Mimiker“. Mitglieder sind außer ihnen Lotte und Gretel Walter, Wilhelm Emanuel Süskind, Gerta Marcks, George Hallgarten sowie die kleineren Geschwister Golo und Monika. Bei der Gründung der Truppe wird so viel gelacht und geblödelt, dass, so berichtet Klaus, „Erika auf offener Straße etwas Grauenhaftes passierte [sie machte sich in die Hose]“. Bald gibt man bei Hallgartens und Manns die ersten Stücke: Lessings Minna von Barnhelm, Molières Der Arzt wider Willen, Shakespeares Was ihr wollt, Theodor Körners Die Gouvernante, Oscar Wildes Bunbury und schließlich Klaus Manns Jugenddrama Ritter Blaubart. Bruno Walter höchstselbst steuert Musik bei. Kostüme werden geschneidert, Kulissen gezimmert und gemalt, Programme geschrieben. Die Schauspieler schminken und verkleiden sich nach allen Regeln der Maskenkunst. Eintritt zu verlangen weisen die jungen Künstler stolz von sich, eine Spendenbüchse stellen sie dennoch auf, in welche die Eltern der Mimen Münzen und Scheine zu werfen aufgefordert sind. Die Erlöse sollen „notleidenden Tonkünstlern“ zukommen. Aber nicht nur Manns und Hallgartens sind geladen: „Wir […] baten auch schließlich das gesamte literarische München hochmütig zu Gast.“
In das „Mimikbuch“, die Vereinschronik, schreibt Thomas Mann gut gelaunt eine Kritik (nach Erikas Ansicht eine seiner „geglücktesten Arbeiten“ ): „Der ›Laienbund‹, jenes junge theatralische Unternehmen, von dessen Begründung und Zwecken auf vorstehenden Blättern Nachricht gegeben, hatte sich vorgesetzt, am verwichenen Sonntag einen ersten Beweis seiner künstlerischen Daseinsberechtigung zu liefern, was ihm denn auch nach dem wohl einstimmigen und vom Ref[erenten]. gern zu bestätigenden Urteil der gebildeten Öffentlichkeit recht wohl gelang. In Szene ging ›Die Gouvernante‹ […]. Die Gouvernante wurde von Fräulein Titi [Erika Mann] mit verständiger Distinktion verkörpert. […] Als Luise bewies Herr Klaus viel Biedersinn, doch bleibt der hoffnungsvolle Darsteller aufmerksam zu machen, daß das Sprechen gegen den Hintergrund in Kennerkreisen mit Recht als Unsitte gilt, da es das Verständnis der Dichterworte, von denen ein jedes dem Gebildeten teuer ist, erschwert. […] Die Kostüme waren stilvoll, die Dekorationen würdig, die Zuhörerschaft erlesen […].“
Über diese Zeit der ersten Bühnenerfahrung schreibt Erika Mann später in ihrer Glosse Kinder-Theater: „Damals, während ich die Viola spielte [in Was ihr wollt], erfand ich für mich das Theater als Beruf.“ Von der Bühne kommt sie nicht mehr los. Engagements bei den Münchner Kammerspielen, bei Max Reinhardt in Berlin, in Bremen und Hamburg und auf den Tourneen der Skandaldramen des Bruders folgen wenige Jahre später, bis sie schließlich 1933 Prinzipalin eines eigenen Kabaretts wird.
Thomas Mann ist ob der schauspielerischen und literarischen Ambitionen seiner Ältesten weniger erfreut denn verunsichert. Ähnlich wie bei der Münchner Revolution des Frühlings 1919 fühlt er sich bedroht, nun aber auch persönlich, nämlich durch Klaus’ selbstbewusstes Auftreten und durch dessen körperliches Reifen. Der arrivierte bürgerliche Autor, der noch wenige Jahre zuvor eigene homoerotische Gefühle in seiner Novelle Der Tod in Venedig (1911) ästhetisierte und sublimierte und seinen Antihelden Gustav von Aschenbach für Tadzios Anmut in den Tod gehen ließ, verliebt sich nun schlechten Gewissens in die Schönheit des eigenen Sohnes. Bereits im Herbst 1918 notiert er in sein Tagebuch: „Gestern abend bemerkte ich durch die verschlossene Glastür der Kinderwohnung Licht, und da ich Katja ohnehin wecken mußte, denn sie hatte mich ausgesperrt, so wurde nachgeforscht. Es zeigte sich, daß Eissi [Klaus] bei beleuchtetem Zimmer und fantastisch entblößt in seinem Bette lag. Er wußte auf Fragen keine Antwort zu geben. […] Jemand wie ich ›sollte‹ selbstverständlich keine Kinder in die Welt setzen.“
Noch anderthalb Jahre später – Thomas Mann hegt die Idee zu einer „Vater-Sohn-Novelle“ – heißt es im Tagebuch: „Entzücken an Eissi [Klaus], der im Bade erschreckend hübsch.“ Und wenige Monate darauf: „Ich hörte Lärm im Zimmer der Jungen und überraschte Eissi völlig nackt vor Golo’s Bett Unsinn machend. Starker Eindruck von seinem vormännlichen, glänzenden Körper, Erschütterung.“ Die Verbindung von jungem Körper und aufmüpfigem Geist hat Thomas Mann verunsichert: „Das Mannwerden Eissi’s zu betrachten, ist mit wunderlichen Empfindungen verbunden. Er wechselt die Stimme jetzt, sein Kehlkopf wächst, seine bloßen Beine sind kolossal, die Richtung seiner Meinung revolutionär.“
Die Meinungen des ältesten Sohnes werden Thomas Mann bald zu herausfordernd. Im Herbst 1919 erscheint in der Schülerzeitung des Wilhelmsgymnasiums Klaus Manns Prosaskizze Die Gotteslästerin, worin er sich über die Spartakistenangst der Bürger mokiert. Die Redaktion der Zeitschrift druckt den Text zwar ab, um ihren Lesern ein Beispiel für die jüngste expressionistische Dichtung zu liefern, distanziert sich jedoch gleichzeitig vom Inhalt.
Als die Mutter Hefte und Tagebücher des Pubertierenden mit Texttiteln wie Visionen der Unzucht findet, gerät das Fass zum Überlaufen. Thomas Mann notiert erregt in sein Tagebuch: „Gestern Abend erschütterndes Vorkommnis mit K[atia]. Sie hatte Klaus’ Tagebuch offen liegend gefunden und gelesen. Ohne gerade eigentlich Schlechtigkeit zu offenbaren, zeugt es von so ungesunder Kälte, Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Verlogenheit, abgesehen von den literarisch-radikalistischen Flegeleien und Albernheiten, daß das arme Mutterherz tief enttäuscht und verwundet war.“
Zunächst versucht man es mit gutem Zureden. Doch als den Eltern zu Ohren kommt, dass die Geschwister sich mit dem jungen Schauspieler Bert Fischel, einem rechten Stutzer, in der Münchner Boheme herumtreiben, wissen sie sich nur noch einen Rat: Sie schicken Erika und Klaus im April 1922 an die Bergschule Hochwaldhausen im Hohen Vogelsberg. Im Grunde sind Erika und Klaus froh, dem verhassten Gymnasium in München entkommen zu sein, zumal sie zusammenbleiben können.
Doch trügt der reformpädagogische Schein der Bergschule. Das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern ist auch hier gestört – ein Generationenkonflikt, nicht untypisch gerade für Umbruchphasen wie jene der Nachkriegsjahre. Klaus Mann schreibt später über dieses Gefühl der Jugendlichen: „Nie zuvor in der Geschichte vielleicht sind junge Leute so bewußt, so eklatant, so herausfordernd jung gewesen wie die deutsche Generation dieser Jahre. Man sagte: ›Ich bin jung!‹ und hatte eine Philosophie formuliert, einen Schlachtruf ausgestoßen. Jugend war eine Verschwörung, eine Provokation, ein Triumph. Wenn wir uns in unseren kahlen Stuben trafen oder draußen im Wald oder beim Krämer im Dorf, tauschten wir geheime Blicke und Winke: ›Ich bin jung!‹ ›Ich auch!‹ ›Dein Glück! Die Alten sind Schweine und Narren.‹“
Die Eltern, von der Direktion alarmiert, müssen erkennen, dass ihre Sprösslinge in das Schulleben nicht zu integrieren sind, sondern nur allerlei Jux und Allotria treiben. Also nehmen sie die beiden bereits im Juli 1922 wieder aus dem Internat und trennen sie. Erika kommt an das Münchner Luisengymnasium, wo sie sich recht halbherzig auf das Abitur vorbereitet. „Aus purer Liebe zu meiner Mutter habe ich das Abitur ›gebaut‹“, bekennt sie später, „und mit einem Zeugnis bestanden, das in der Welt einzig sein dürfte: es ist so miserabel, daß ich es mir eingerahmt habe, und jeder, der mich besucht, kann es in der Diele lesen.“
Klaus hingegen wird im Herbst 1922 – zuvor wurde er im Internat Salem abgelehnt – auf die ebenfalls von der Reformpädagogik geprägte Odenwaldschule Paul Geheebs in Oberhambach geschickt. Die Kollegen in Salem warnen Geheeb brieflich vor dem frühreifen, manierierten, selbstgefälligen jungen Mann. Doch Paul Geheeb, ein Mann in den Fünfzigern mit langem, weißem Rauschebart, ist lebenserfahren genug, das Gute im Wesen seines neuen Zöglings zu erkennen, dessen Talente zu fördern und ihn in seinen künstlerischen und literarischen Interessen nicht zu beschneiden. Geheebs Leitspruch ist „Werde, der du bist!“, und Klaus Mann dankt es dem Pädagogen noch viele Jahre später in Briefen und rühmenden Aufsätzen.
Zum ersten Mal in ihrem Leben sind die Geschwister für längere Zeit voneinander getrennt. Besonders Klaus empfindet dies schmerzlich. Seine Briefe aus der Odenwaldschule sind bemüht fidel, verhüllen aber kaum Sehnsucht und Heimweh. So erkundigt er sich – es ist die Zeit der Inflation –, ob in München eine Tafel Schokolade auch vierzig bis sechzig Mark koste? Er könne schließlich ohne Schokolade nicht dichten und gleiche darin Annette Kolb, die, wie man wisse, auch nur im Kaffeehaus habe arbeiten können. Er sei sogar noch interessanter als Annette Kolb, so albert er, trotz seiner, wie er glaubt, biederen Züge. Er lässt die Eltern nicht außen vor, wenn er seine Schwester anweist, sie solle den Brief den „Greisen“ ruhig zeigen und möge nur darauf achten, Frivolitäten – oder was er eben darunter versteht – nicht unnötig hervorzukehren. Hinter solchen Scherzen verbirgt sich Bitterkeit, fühlt Klaus sich doch von den Eltern vernachlässigt. Auch in anderen Briefen an Erika klingt dies an: Erika möge ihm Lebensmittel schicken, schreibt er, als sei er am Verschmachten. Insbesondere Marmelade, Wurst und Konserven, „– was dir in die Hände fällt. Du, die Nachbarsmörderin, wirst nicht auch noch zur Bruderverhungerlasserin werden wollen.“ Und in einem anderen, undatierten Brief auf Papier der Odenwaldschule trägt er der Schwester auf, sie solle eine „Hilfsaktion“ einleiten, aber der Mutter nichts verraten, das wäre ihm peinlich. Sein Stand in der Schule sei schwierig, er habe sich mit Paul Geheeb gestritten und fürchte einen Brief des Schulleiters an den Vater. Erika solle im Übrigen dafür Sorge tragen, dass der Zauberer keinesfalls ein in Klaus’ Zimmer liegendes Heft mit Novellenentwürfen in die Finger bekomme.
Solche Briefe wollen gewitzt klingen, und sind es doch nicht. Die Klagen wegen mangelhafter Essensrationen sind Koketterie, von Hungern kann an der Odenwaldschule, wohin wohlhabende Bürger ihre Sprösslinge schicken, nicht die Rede sein. Und doch spricht aus solchen Zeilen ein seelisches Ungenügen: Der Heranwachsende fühlt sich entfremdet, missverstanden, enttäuscht. In Erika sieht er eine konspirative Verbündete – und mehr als das: das Zwillingswesen, dem allein er sich im tiefsten Innern verpflichtet fühlt, ja das ihn in Zeiten psychischer Erschütterung und Not am Leben erhält – dieser Komplex wird bis zu Klaus Manns frühem Tod bestehen.
Er belässt es in diesen Monaten im Internat nicht bei Bitten um Lebensmittel und Klagen über die Eltern. In den sonst überwiegend heiter-scherzenden Ton der Briefe mischen sich Pathos und beinah rührende Unbeholfenheit. Liebesgeständnisse werden übermittelt. Klaus schwärmt der Schwester gegenüber von Schulkameraden. Und er geht in seinen irritierenden Geständnissen noch weiter: „Ach – mein’ Ruh’ ist hin – – – (Ich liebe doch leider den Knaben UTO und muß viel kostbare Geschenke für ihn erhandeln, da er so sehr nett ist. […]) Ich habe ein sehr schönes Gedicht an dich gemacht, daß [sic] dich rühren wird. […] Was denkt man [die Eltern] über meine unbedeutende kleine Zukunft? – Ich hab’ keine Angst. Und es wird schon recht werden. (dieses kleine Kulturdokument braucht unseren Eltern, die ich im übrigen grüße, nicht in die Hände zu fallen.)“
Wenig später schickt Klaus Mann seiner Schwester das angekündigte Liebesgedicht. Freilich scheut er sich, es als solches zu bezeichnen: „Übrigens habe ich jetzt ein Gedicht gemacht, das fängt an: ›Seltsam sind die Augen derer, / die die große Sehnsucht kennen –‹ und dann heißt es: ›Auf der Stirne tragen sie ein Zeichen, / das von heißer Lust und heißem Elend kündet – / Aber all die andren, all die Stumpfen weichen / Scheu zurück davor –‹ Und dann: ›Wir sind ganz allein mit unsrem Gotte / Und mit unsren lüsternen Gebeten, / Denn mit unsrem Lachen, unsrem Spotte / Treiben wir davon die Wackren, Wohlberedten, / Die gesund sind und ganz ohne Wunde.‹ Ob ich mit dem ›wir‹ wohl auch Dich meinen darf? – – –“ Bestürzt schiebt er hinterher: „Aber, mein Gott, was schreibe ich da für einen seltsamen Brief. Ich weiß, Du magst es nicht, wenn so viel ausgesprochen wird.“
Als Klaus im Sommer 1923 die Odenwaldschule verlässt, weil er sich nicht einmal deren lockeren Zügeln fügen will, reist er mit Erika – die Eltern wähnen die beiden beim Wandern – heimlich nach Berlin. Kaum beisammen, kokettieren sie wieder mit ihrer naiven Verdorbenheit. Die Weltstadt tanzt im Delirium von Schieberei und Inflation. Die Geschwister sehen in der Friedrichstraße die Dirnen mit hochhackigen roten und grünen Stiefeln, und eine von ihnen lässt ihre Gerte an der Wange des sechzehnjährigen Klaus vorbeisausen und raunt ihm heiser ins Ohr: „Magste Sklave sein?“ Klaus schwärmt: „Ich fand es wundervoll.“
Klaus Mann knüpft Kontakt zu einem Kabarettisten und darf in einem Tingeltangel, dem „Tü-Tü“, vorstellig werden. Ehe er es sich versieht, steht er auf der Bühne und kräht – geblendet von den starken Scheinwerfern – ins Dunkel hinein sein Lied von der Schminke: „Mögen Sie auch – mögen Sie auch – mögen Sie auch – Schminke so gern? – Aber ich liebe sie, aber ich liebe sie, aber ich liebe sie, meine Herrn! – Schminke, Schminke, Schminke wirkt so festlich – Schminke, Schminke, Schminke riecht so köstlich …“ Als eine Stimme von unten „Aufhören!“ brüllt, bringt er gerade noch hervor: „Ohne Schminke geht’s nun einmal nicht!“, und schon senkt sich der schwere Vorhang. Erst Jahre später erfährt er, dass der Saal leer war und nur ein paar Bühnenarbeiter und Putzleute zugange waren und dem wortwörtlich Geblendeten einen Streich spielten.
Geblendet sind Erika und Klaus auch von anderen Attraktionen, bei denen Schminke von Vorteil sein kann: Sie erkunden – Klaus mit seiner Vorliebe für Jünglinge, Erika mit Gefallen an jungen Frauen – die Homosexuellenszene Berlins, ein Erlebnis, woraus Klaus zwei Jahre später für seinen Debütroman Der fromme Tanz schöpfen wird: „Wir kamen das erstemal […] in ein Lokal, wo Jünglinge miteinander tanzen. Daß es so was gab, fanden wir toll; und nun gar das fette alte Ungeheuer, das in Damenkleidern drollige Strophen zum Vortrag brachte. Sündiger und widerlicher konnte nichts mehr sein, es war wirklich ganz herrlich, denn der Zwitter-Greis schwabbelte mit dem Fett, wenn er tanzte und sprang, sein großes Gesicht mit Hängebacken und verquollenen Augen war teils kreidig weiß, teils von obszöner Buntheit.“
Nach München zurückgekehrt, lernt Klaus Mann Pamela Wedekind kennen, die Tochter des Dichters Frank Wedekind. Er ist von ihrem herb-männlichen Wesen und ihrer Art, die Lieder des Vaters zu singen, fasziniert. Klaus und Pamela verloben sich – und Pamela und Erika verlieben sich. Es ist Provokation und Spiel – aber mit der Liebe spielt man nicht, das werden sie alle bitter erkennen müssen. Ein Spiel mit den Wogen der Gefühle, Wogen, die mitunter so hoch und gefährlich heranrollen wie die Wellen an den Stränden Hiddensees und Usedoms, wo die drei im Sommer 1924 scheinbar unbeschwerte Wochen verbringen.
Und plötzlich stehen sie im Rampenlicht der Klatschpresse: Man weiß in der Öffentlichkeit inzwischen von den homosexuellen Neigungen des jungen Klaus Mann, und er provoziert die Journaille noch mehr, als er einige Zeit später mit seiner Verlobten auf dem Standesamt erscheint und wegen seiner Unmündigkeit – er ist noch nicht einundzwanzig – abgewiesen wird.
Vielleicht war die Idee mit der Verlobung auch nur aus dem Wunsch heraus geboren, der Schwester Erika über den Umweg ihrer Zuneigung zu Pamela näher zu sein. Erika jedenfalls verlässt im September 1924 München und geht als Schauspielerin nach Berlin, wo sie mit finanziellen Zuwendungen des Vaters Schauspielunterricht nimmt und unter der Intendanz Max Reinhardts am Deutschen Theater kleine Rollen erhält. Pamela hingegen zieht nach Köln. Dort versucht sie unter Gustav Hartung ebenfalls ihr Glück als Schauspielerin. Und Klaus erhält – durch Vermittlung seines schwulen Onkels Klaus Pringsheim – einen Posten als dritter Theaterkritiker des Berliner 12 Uhr-Blatts. So geht er nach Berlin, den „Sündenpfuhl“, die Stadt, in der Erika lebt – und freut sich auf beide.
„Eine spannende Geschichte junger Menschen, die in der Zeit der Weimarer Republik Liebe und Anerkennung suchten, in der NS-Zeit um ihre künstlerische Arbeit kämpften und nach Kriegsende im Exil auch versuchten, die Scherben gescheiterter Beziehungen wieder aufzulesen.“
„Was da im Laufe der Jahrzehnte an Lebenswirren bis hin zu Skandalen zusammenkommt, ist schwindelerregend – und in manchen Fällen tragisch.“
„Fühlbar präsente Lektüre“



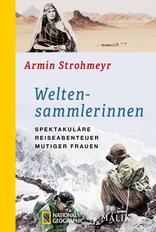


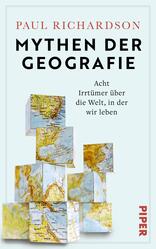


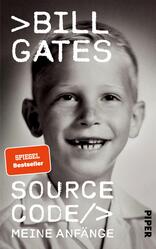
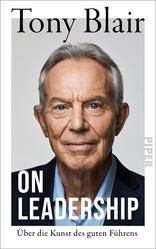




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.