

Die Bibliothek der guten Taten Die Bibliothek der guten Taten - eBook-Ausgabe
Roman
— Der französische Wohlfühlroman für alle, die Bücher lieben„Wunderbar zu lesen – auch wenn es um Trauer und Herzschmerz geht, ist er dennoch erfrischend, lebensbejahend, mit viel gutem Humor und witzigen Dialogen.“ - Radio Euroherz
Die Bibliothek der guten Taten — Inhalt
Vom Verlieren und Finden des Glücks
Lucie liebt Worte und Menschen. Als ihr Leben durch einen Schicksalsschlag aus den Fugen gerät, verlässt sie Paris und zieht nach Saint-Malo ins Haus ihrer Großeltern. Es ist ein großes, altes Haus, das sie schon bald mit Leben, frischem Butterkuchen und neuen Mitbewohnern füllt: dem ewig mürrischen Witwer Léonard, der psychisch fragilen Buchhändlerin Vivianne und der jungen Ausreißerin Camille. Um ihnen allen zu helfen, gründet Lucie eine kleine Bibliothek, einen Ort des Glücks. Doch wird es ihr gelingen, auch ihre eigenen Dämonen zum Schweigen zu bringen?
Der zauberhafte Wohlfühlroman aus Frankreich über ein Haus in der Bretagne, den Duft von Butterkuchen und die heilende Kraft von Büchern.
Leseprobe zu „Die Bibliothek der guten Taten“
Kapitel 1
Der Aufbruch
„Wenn du nicht gehst, Lucie, gehen wir beide zugrunde.“
Mit diesen Worten hatte mich Lionel nach unserem Sonntagsbrunch, während wir mit Toast und Schinken hantierten, ganz unerwartet konfrontiert.
Seine traurigen Augen und der Schmerz, der in ihnen lag, hatten mir deutlich klargemacht, dass er es ernst meinte und recht hatte. Es war schon lange etwas zugrunde gegangen. Und zwar in mir. Seit eineinhalb Jahren. Während ich den Blick auf mein Rührei gerichtet hielt und mit meiner Gabel herumspielte, fand ich gerade noch den Mut, ihn zu [...]
Kapitel 1
Der Aufbruch
„Wenn du nicht gehst, Lucie, gehen wir beide zugrunde.“
Mit diesen Worten hatte mich Lionel nach unserem Sonntagsbrunch, während wir mit Toast und Schinken hantierten, ganz unerwartet konfrontiert.
Seine traurigen Augen und der Schmerz, der in ihnen lag, hatten mir deutlich klargemacht, dass er es ernst meinte und recht hatte. Es war schon lange etwas zugrunde gegangen. Und zwar in mir. Seit eineinhalb Jahren. Während ich den Blick auf mein Rührei gerichtet hielt und mit meiner Gabel herumspielte, fand ich gerade noch den Mut, ihn zu fragen: „Und was bedeutet das für uns?“
„Es gibt schon eine ganze Weile kein uns mehr …“
Er war aufgestanden, hatte seinen Stuhl geräuschvoll zurückgeschoben und war mit leeren Händen in die Küche hinübergegangen. Die eigentliche Leere aber herrschte in mir. Mein Bauch, der zu nichts mehr nütze war. Diese Leere, die ich seit unserem Unglück ganz tief in meinem Innern spürte. Ich hatte meinen Koffer gepackt und am nächsten Morgen unsere Pariser Wohnung verlassen. Während ich zu einer Freundin unterwegs war, hallten die letzten Worte, die wir miteinander gewechselt hatten, in meinem Kopf nach wie ein falsches Echo.
„Ich liebe dich …“
„Ich liebe dich auch.“
Zum ersten Mal begriff ich, wie und vor allem warum zwei Menschen, die sich liebten, gezwungen waren, sich zu trennen – um weiterzumachen, um sich nicht zu verabscheuen, um nicht zusammenzubrechen.
Um nicht länger dem einen oder der anderen die Last der Schuld aufzubürden.
Als ich eine Woche später vor der Wohnungstür meiner Mutter ankomme, spielt sich ein ganz anderes Drama in meinem Kopf ab: War es eine gute Idee, sie in meinem Zustand aufzusuchen? Ich liebe meine Mutter sehr, aber … sie ist meine Mutter. Annick, vierundsiebzig Jahre alt, seit dem Tod meines Vaters vor gut zehn Jahren Witwe und nicht wirklich daran gewöhnt, mit einem anderen menschlichen Wesen zusammenzuleben. Und vor allem sehr begabt darin, mir eine Moralpredigt zu halten, ohne dass sie dies explizit tut.
Kaum habe ich an der Tür ihres Wohnblocks im zweiten Arrondissement geklingelt, bereue ich auch schon, hierhergekommen zu sein.
Alles, was ich in diesem Augenblick brauche, ist ein alkoholisches Getränk! Und zwar ein ordentliches! Und etwas zu rauchen. Auch wenn ich in normalen Zeiten gar nicht rauche. Die „De-facto-Trennung“ von meinem Ehemann kann aber doch wohl als mildernder Umstand eingestuft werden. Ich will gerade kehrtmachen, da öffnet sich die Wohnungstür. Offensichtlich besitzt meine Mutter noch immer ein sehr gutes Gehör, und sie sieht mich mit besorgter Miene an, als sei ich verantwortlich für das Sterben der Seehundbabys.
„Mein Liebes! Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir?“
„Oh, ein bisschen so, als sei ein Diplodocus, der drei Tyrannosaurier trägt, über mich hinweggestampft, aber abgesehen davon super. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Mama.“
Und das stimmt tatsächlich, auch wenn ich mich beinahe wieder davongestohlen hätte. Meine Mutter ist mein Zufluchtsort, mein Leuchtturm bei stürmischer See, mein Fels in der Brandung. Es gibt keine krisenhafte Situation, derer sie nicht Herr wird. Ihr einziger Fehler? Sie mag nicht, dass ich trinke! Sie schließt mich in die Arme, und ich entspanne mich auf der Stelle.
„Komm herein! Möchtest du eine Tasse Tee?“
Was habe ich gesagt? Meine Welt ist zusammengebrochen, und sie bietet mir eine Tasse Tee an. Nachdem ihre Chihuahua-Hündin Chichi mich wiedererkannt hat, springt sie um mich herum, wedelt mit dem Schwanz und versucht, mir über die Finger zu lecken, während ich sie zur Begrüßung streichele. Um meiner Mutter einen Gefallen zu tun, ziehe ich meine Schuhe aus, damit ihr schöner weißer Teppich geschont wird, und hänge meine Jacke ordnungsgemäß an den Garderobenhaken im Flur, bevor ich mich umdrehe und sie frage: „Hast du nicht vielleicht etwas Stärkeres?“
„So etwas wie Kaffee?“
„Nein, ich dachte eher an so etwas wie Wodka oder Alkohol zum Desinfizieren, den ich auf ex trinken könnte, einfach um zu vergessen?“
„In der Bibliothek habe ich Portwein. Setz dich schon mal, ich komme gleich.“
Hurra! Ich nehme an, dass mein fahles Gesicht und meine Panda-Augen ihr hinreichend Aufschluss über meinen Zustand gegeben haben. Ich stelle meine Tasche im Gästezimmer ab, blicke mit Wehmut auf die Fotos von meinem Vater und meiner Hochzeit, dann gehe ich zu meiner Mutter ins Wohnzimmer zurück, wo das im Geschäft der Emmaus-Gemeinschaft erstandene orangefarbene Sofa steht, das ich bekanntermaßen verabscheue (was mir erstaunlicherweise niemand zugestehen will). Ein weißes Sofa und ein weiterer Sessel vervollständigen die Sitzecke. Meine Mutter entkorkt die Flasche und schenkt die braunrote Flüssigkeit in zwei kleine Kristallgläser, an denen sie besonders hängt, da sie von ihren Eltern stammen. Sie stöhnt, als sie bemerkt, dass ich einmal mehr das alte orangefarbene Möbelstück anstarre, und verzieht die Lippen zu einem Schmollmund.
„Hör auf, dieses Sofa anzustarren, als hätten gerade noch Gespenster darauf gesessen.“
„Mach mir nicht weis, dass du sie nicht siehst! Nicht einmal Chichi klettert jemals darauf!“
Sie runzelt die Stirn. Ich setze noch einen drauf und zeige mit dem Finger auf das besagte Möbelstück: „Schau da, genau da!“
Sie wirft mir einen entsetzten Blick zu, und jetzt mache ich den Sack zu: „Es ist ein Paar, Mama, zwei ganz alte Leutchen. Sie sind hier, bei uns und …“
„Hör auf, das ist nicht lustig.“
„Aber Mama, sieh das Ganze doch einmal positiv: Du bist nicht allein in dieser Wohnung! Ich bin sicher, dass ihr drei euch gut verstehen könntet!“
Ich lache los, während sie sich jetzt aber doch lieber zu mir auf das andere Sofa setzt. Sie versucht, ihre Bestürzung zu kaschieren, aber ich sehe, dass sie immer wieder einen skeptischen Blick zu dem Sitzmöbel hinüberwirft.
„Buh!“
Sie springt auf und wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu: „Jetzt reicht es aber mit deinen Kindereien, Lucie!“
Wir mustern uns einen Augenblick, mühsam unterdrücke ich die aufsteigenden Tränen, dann setze ich mich im Schneidersitz auf den mit dicken Kissen bestückten Sessel und greife nach dem Glas, das sie mir reicht, um es in einem Zug hinunterzustürzen. Unter ihrem besorgten Blick straffe ich meine Glieder.
„Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Mama! Mir geht es nicht gut, da habe ich das Recht zu trinken.“
„Du solltest …“
„Mama! Lionel hat mich gebeten, unsere Wohnung zu verlassen. Ich bin krankgeschrieben seit … du weißt schon, seit wann, und ich schaffe es auch nicht, meinen Roman fertig zu schreiben. Ich bin eine jämmerliche Gestalt, zu nichts nütze. Man muss schon ehrlich mit sich sein. Und sich seinen klaren Verstand bewahren! Diese beiden Eigenschaften sind vielleicht das Einzige, das mir geblieben ist.“
„Nein, du bist außerdem hübsch.“
„Mama, das ist doch keine Eigenschaft! Und sexistisch ist es auch, eine Frau über ihr Aussehen zu definieren.“
„Bei euch jungen Leuten ist alles so kompliziert geworden. Jetzt darf ich nicht einmal mehr meiner Tochter sagen, dass sie die Hübscheste von allen ist. Wie dem auch sei, du gehst zu hart mit dir ins Gericht, mein Liebes.“
„Keineswegs, ich bin nur realistisch.“
„Du musst nur wieder etwas Ordnung in dein Leben bringen, du musst wieder Fuß fassen und dir die Zeit nehmen zu verarbeiten, was geschehen ist, um dann noch einmal unbeschwert ganz von vorn anzufangen.“
Ich habe gute Lust, sie zu fragen, wo ich diese Unbeschwertheit hernehmen soll, aber ich halte mich zurück.
„Du bist die Weisheit in Person, Mama. Das macht mir beinahe Angst.“
„Ich habe eine Idee.“
Ich sehe sie mit zusammengekniffenen Augen an. Das klingt verdächtig. Ich habe gelernt, diesem funkelnden Blick, diesem Lächeln und diesem plötzlichen Enthusiasmus mit einem gewissen Argwohn zu begegnen. Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Zum Glück zögert meine Mutter dieses Spannungsmoment nicht länger hinaus, sondern präsentiert mir ihren Vorschlag, als sei es der Einfall des Jahrhunderts: „Fahr dorthin!“
Dorthin, wo alles neu und wild ist!
Geh nicht dorthin!
Mein Gehirn verdreht den Text dieses schönen Liedes Là-bas von Jean-Jacques Goldman aufs Ärgste. Aber die Melodie geistert mir jetzt im Kopf herum, während ich, nun erst recht argwöhnisch, die Stirn runzele.
„Was soll denn das heißen … dorthin? Wohin?“
„In die Bretagne, Liebes. Ins Haus deiner Großeltern.“
Da lag ich also gar nicht so falsch. Die Bretagne hat tatsächlich etwas Wildes. Es gibt Unmengen frecher Seemöwen, die aus der Luft herabstoßen, um einem in die Finger zu beißen (es heißt zwar, sie seien nur hinter den Crêpes her, die wir in den Händen halten, aber ich bin sicher, dass das nicht stimmt).
„In das Haus, in das wir früher immer mit Papa gefahren sind? In Saint-Malo? Wozu? Soll ich dort Fische fangen? Ich bin zu alt für eine Umschulung. Und außerdem bin ich allergisch gegen Muscheln.“
„Du bist fünfunddreißig, du bist jung. Und die Muscheln können dir egal sein.“
„Jung, jung … das ist relativ. Ist dieses Haus überhaupt noch bewohnbar? Oder wird es womöglich für horrende Preise an Touristen vermietet?“
„Klar, es wird ein bisschen staubig dort sein, aber bewohnbar ist es allemal, das kannst du mir glauben. Dein Vater wollte es nie vermieten. Er hing viel zu sehr daran, als dass er das Risiko eingegangen wäre, es am Ende durch Fremde beschädigt zu sehen. Die Möbel, das Geschirr, die Ausstattung und manche Gegenstände seiner Großeltern befinden sich immer noch dort. Das Haus seiner Vorfahren war immer ein Ort wertvoller Erinnerungen für ihn. Übrigens kostet mich der Unterhalt eine schöne Stange Geld, solange niemand es bewohnt.“
Nachdem sie ihren zweiten Portwein ausgetrunken hat, gibt sie mir die Schlüssel und setzt dabei das Lächeln von Müttern auf, die überzeugt davon sind, dass sie recht haben.
Damit ist die Abreise für den nächsten Tag in aller Frühe fest eingeplant. Wenn man schon ein so ungeordnetes Leben führt, kann man es auch gleich am Ozean in der Gesellschaft von angriffslustigen Seemöwen führen, oder etwa nicht?
Diese Geschöpfe und ich, wir müssten uns eigentlich großartig verstehen. Ihr Name ist eine Leihgabe des bretonischen Wortes „gwelan“, das soviel bedeutet wie „weinen“. Vielleicht fühle ich mich in ihrer Gesellschaft sogar etwas weniger einsam.
Und so kommt es, dass ich an einem Montagmorgen tatsächlich meinen kleinen Twingo nehme und in Richtung Saint-Malo düse. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, was ich dort tun werde, aber ich fahre dorthin. Immerhin habe ich ein Ziel. Wenn ich erst einmal da bin, werde ich mir schon etwas einfallen lassen. Und ich werde Wein, Cidre und kouign-amann, den von mir heiß geliebten bretonischen Butterkuchen, kaufen. Wenn ich an die Leckereien meiner Kindheit denke, an die galettes bretonnes, diese herzhaften Buchweizenpfannkuchen oder die Crêpes mit gesalzener Butter, die wir nach den Nachmittagen am Strand zu Hause verschlungen haben, schleicht sich sogar ein Lächeln auf meine Lippen. Vielleicht ist das Leben doch nicht so mies, wenn man ordentlich Salzbutter aufträgt, oder?
Jedenfalls ist das der Gedanke, an dem ich mich festhalte, während ich die Autobahn Richtung Nordwesten nehme. Ansonsten geben mir die langen Wegstunden Gelegenheit, eine ziemlich trostlose Bilanz meines Lebens zu ziehen. Zum Glück gehöre ich zu den verstandesbetonten Frauen, sonst hätte mein Auto unter Umständen bereits Bekanntschaft mit einer Leitplanke gemacht.
Job: Als Ausbilderin für „Techniken bei der Arbeitssuche“ helfe ich arbeitslosen Menschen bei ihren Versuchen, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ich leite verschiedene Workshops, in denen sie lernen, Motivationsschreiben und Lebensläufe zu verfassen. Es kommt vor, dass einige dieser reizenden Personen von sich aus überhaupt keine Lust verspüren, meinen Kursen beizuwohnen, was sie mir deutlich zu verstehen geben, indem sie geräuschvoll stöhnen oder in den Himmel starren, sobald ich den Mund aufmache. Ganz zu schweigen von den finsteren Blicken, die sie mir zuwerfen, wenn ich ihnen zum x-ten Mal predige, ihren ehemaligen Chef während eines Bewerbungsgesprächs keinesfalls als „alte Drecksau“ zu bezeichnen.
Leidenschaft: Bücher und Schreiben. Ich habe bereits sieben Romane veröffentlicht, bleibe aber eine weitgehend Unbekannte im Literatursektor. Ich warte immer noch darauf, dass sich ein ähnlicher Erfolg wie bei Aurélie Valognes einstellt.
Heirat: Dieses Thema sparen wir aus, danke für Ihr Verständnis.
Stimmung: unterirdisch. So unterirdisch, dass sich nur Würmer daran laben können.
Ziel im Leben: meine Finger zählen. Und wieder von vorn zählen. Mit anderen Worten: keines.
Oder … doch. In ein paar Monaten so viel kouign-amann essen wie möglich, so viel far breton wie möglich, diesen köstlichen bretonischen Flan, und so viele Karamellbonbons wie möglich, um dann nach Paris zurückzukehren und mein Leben in die Hand zu nehmen. Mit zwanzig Kilo mehr als jetzt.
Fast drei Wegstunden später biege ich endlich nach Saint-Malo ab und fahre den Quai de Trichet entlang in Richtung Befestigungsmauern. In der Ferne erblicke ich schon den Ozean. Ich öffne das Autofenster, um diese Seeluft zu spüren, die ich mir so lange nicht mehr habe um die Nase wehen lassen. Ich erinnere mich nicht einmal mehr daran, wie viele Jahre mein letzter Besuch zurückliegt. Sind es fünfzehn Jahre, vielleicht schon zwanzig? Auf jeden Fall war es kurz vor Großmutters Tod. Ich habe dieses Haus fast vergessen, genauso wie man die Dinge aus der Kindheit vergisst – zu sehr von meinem Leben in Beschlag genommen, von meiner Arbeit und von meinen Plänen mit Lionel.
Ich folge der rechten Linie der Mauern und fahre weiter, bis ich die große Plage du Sillon erreiche. Jetzt brauche ich noch gerade einmal fünf Minuten, um das etwa fünfzig Meter vom Meer entfernt liegende Haus von Oma Gigi und Opa Gégé (zu Lebzeiten Ginette und Gérard) zu erreichen. In dem von hohen Gräsern überwachsenen Garten parke ich Titine und sage mir sogleich, dass ich endlich mit meiner Manie aufhören muss, mir für alles und jedes lächerliche Diminutiva auszudenken.
Der trübe Himmel passt großartig zu meiner Stimmung. Und die grauen Wolken, die ich beim Aussteigen aus dem Auto beobachte, verheißen auch nichts Gutes. Die bretonischen Kumulonimbus sind bösartig, das weiß ich.
Das Backsteinhaus, das sich immer im Besitz der Familie befand, hat drei Stockwerke und eine von Efeu überwucherte Fassade. Ein großer Garten erstreckt sich bis zum Terrassenbereich, und eine Welle der Wehmut erfasst mich, als ich an die Mahlzeiten im Kreis der Familie denke und an die Gesellschaftsspiele, die wir hier draußen bis spät in die Nacht gespielt haben. An einer Mauer entdecke ich eine Plakette, an der der Zahn der Zeit genagt hat, aber ich entziffere, immer noch lesbar: „La Malouinière“.
Auch wenn der Name es nahelegt, ist dieses Haus nicht der Zweitwohnsitz eines im 18. Jahrhundert hier in Saint-Malo ansässigen Reeders oder Kaufmanns. Es wurde weder von einem Reeder erbaut, noch liegt es außerhalb der Stadt. Aber ich habe dieses für mich als Kind so geheimnisvoll klingende Wort sehr geliebt und deshalb beschlossen, das Haus so zu nennen. Meine Großeltern hatten es dann auf diesen Namen getauft und diese Bezeichnung übernommen, um dem kleinen Mädchen, das ich damals war, eine Freude zu machen.
Ich lächele, als ich mich daran erinnere.
Während ich aus meinem Auto steige, fegt mir ein Windstoß durch die Haare, die ersten Regentropfen fallen, und ich beeile mich, um mein Gepäck rasch aus dem Kofferraum zu nehmen und es so schnell wie möglich nach drinnen zu verfrachten. Ich kenne das trügerische Wetter in der Bretagne noch gut genug, um zu wissen, dass Optimismus fehl am Platze ist: Ein Unwetter zieht auf.
Auf der Außentreppe tapst eine junge Seemöwe, deren Gefieder noch grau und flaumig ist, hin und her und beobachtet, wie ich mich verbissen mit meiner Fracht abmühe. Ich werfe ihr einen bitterbösen Blick zu, als ich meine Gepäckstücke schwer schnaufend vor der Tür absetze, was nur allzu deutlich verrät, dass ich in letzter Zeit meine sportliche Ertüchtigung sträflich vernachlässigt habe. Müsste die Wortbedeutung von „in letzter Zeit“ nicht vielleicht auf den kompletten Zeitraum der letzten zehn Jahre ausgedehnt werden? Ich nehme an, dass ich in den kommenden Tagen ausreichend Muße haben werde, dieser Frage nachzugehen und mir Gedanken darüber zu machen. Genauso wie über andere entscheidende Fragestellungen, beispielsweise: „Haben Pinguine Knie?“ oder „Sind Zebras weiß mit schwarzen Streifen oder umgekehrt?“
Denn in Wahrheit ängstigt mich die viele Zeit, die ich hier haben werde. Die Minuten und Sekunden, die verrinnen, werden mich zurückwerfen auf meine Leere, meine Einsamkeit, meine Verzweiflung, mein Unglück und den Tod. Werde ich stark genug sein, um all dem standhalten zu können?
Das Geräusch der tapsenden Vogelfüße auf den Holzlatten der Terrasse reißt mich aus solchen Erwägungen, und ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Möwe. Sie muss mich bedauernswert finden. Zum Glück kann sie meine Gedanken nicht lesen! Äh … Eine Seemöwe kann keine Gedanken lesen, klar? Lucie, du musst damit aufhören, dir idiotische Fragen zu stellen!
Aber Lucie, glaubst du etwa …
Grr! Ich fasse mir mit beiden Händen an den Kopf. Ich bin sicher, dass sie mich trotz ihrer gerade einmal zwanzig Zentimeter im Grunde von oben herab betrachtet. Ich kann nicht umhin, in eine Art Kommunikation mit ihr treten zu wollen, weil ich ihr irgendwie klarmachen will, wer hier der Chef ist. Man kann schließlich nie wissen – vielleicht hat sie das gleiche Gehirn wie ein Hund, und dann muss sie von Anfang an wissen, wer das Sagen hat.
„Was hast du denn?“
„Mhiiiii.“
„Kannst du etwas deutlicher reden, ich habe dich nicht richtig verstanden?“
Sie schüttelt den Kopf und das Gefieder, als wolle sie mir nachdrücklich mitteilen, dass ich idiotisch bin. Mich überkommt die Lust, ein paar forsche Schritte in ihre Richtung zu machen, um sie zu verscheuchen. Aber da ich neugierig bin, kneife ich lediglich die Augen zusammen, starre sie mit meinem allerbösesten Blick an, neige den Kopf etwas zur Seite und richte drohend meinen Finger auf sie. Es ist, als würden wir uns miteinander messen.
„Hör mir gut zu, mein Freund. Ich habe sehr schlechte Laune. Und ich will keinen meiner Finger hergeben! Könntest du bitte an einer anderen Stelle als hier bei mir nach etwas zu fressen Ausschau halten?“
Auch das Tier neigt den Kopf jetzt zur Seite und krächzt wieder spitz: „Mhiii!“
„Schon recht, quatsch du nur. Aber dass du es weißt, ich glaube dir gar nichts.“
Die Seemöwe tippelt drei kleine Schrittchen zur Seite, als hätte sie nichts mit mir zu tun, während ich in meiner Tasche wühle, um den Schlüsselbund ausfindig zu machen. Ich muss etwas nachhelfen, um die Türe aufzudrücken, dann betrete ich das Haus und lasse meine neue Bekannte draußen, nachdem ich mich mit einem versteckten Blick vergewissert habe, dass sie mir nicht folgt.
Bei diesen komischen Vögeln weiß man schließlich nie.
In diesem Augenblick aber trifft mich die Frage aller Fragen mit voller Wucht. Die Frage, der ich mich diesmal wirklich stellen sollte: Was mache ich eigentlich hier? Irgendwie hege ich wohl die geheime Hoffnung, hier vor Ort von einer plötzlichen Eingebung erfasst zu werden und einen Wink über meine Zukunft zu erhalten, sobald ich die Türe öffne und das Haus betrete, und jetzt … nichts.
Nada, niente!
Ich hebe den Blick zum Himmel und fluche gegen wen auch immer: „Vielen Dank auch! Ich habe auf ein wenig mehr Anteilnahme gehofft! Ist es denn zu viel verlangt, mir irgendeinen Hinweis darauf zu geben, wie es jetzt weitergehen soll? Nein, denn außer der Möglichkeit, mich ins eiskalte Wasser zu stürzen und den Mund aufzusperren, um so viel wie möglich zu schlucken, sehe ich keine ernsthafte Perspektive für meine Zukunft.“
Ich gehe in den großen Salon und fröstele, als ich meinen Blick durch den Raum schweifen lasse und im Halbschatten die Möbel erahne, die unter Plastikplanen stecken. Als ich die Fensterläden geöffnet habe, um Licht hineinzulassen, wird mir der Umfang der bevorstehenden Aufgabe klar. Ich werde in den nächsten Tagen reichlich zu tun haben, um diese Räume gemütlich und wieder bewohnbar zu machen. Bei all den Spinnenweben, dem Staub und meiner fehlenden Motivation scheint mir das ungefähr so anspruchsvoll zu sein wie der Bau einer Pyramide.



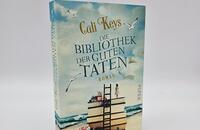










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.