

Die Buchhändlerin von Königsberg Die Buchhändlerin von Königsberg - eBook-Ausgabe
Roman
— Historischer Roman über den 2. Weltkrieg und die Kraft, die Bücher spendenDie Buchhändlerin von Königsberg — Inhalt
Eine tapfere Buchhändlerin und die Kraft der Worte
Frieda ist Buchhändlerin mit Leib und Seele. Der Krieg hat ihr schönes Königsberg bisher kaum erreicht, aber die Spannungen sind deutlich spürbar. Ihre Lieblingsbücher werden verboten, in der Buchhandlung, dem Ort der freien Gedanken, trauen die Leute sich nicht, offen zu sprechen. Und dann musste auch ihr Verlobter an die Front. Frieda klammert sich an die Bücher, bis Königsberg angegriffen wird und die Bomben fallen. In diesen dunklen Stunden sucht Frieda nach Hoffnung zwischen den Seiten. Doch wie weit können Worte durch schwere Zeiten tragen?
Wenn Sie Ines Thorns „Die Buchhändlerin“ und Kerri Mahers „Die Buchhändlerin von Paris" gelesen haben, werden Sie diesen Roman lieben!
Leseprobe zu „Die Buchhändlerin von Königsberg“
Ein Sommerspaziergang durch Königsberg
Königsberg, 3. Juni 1940
„Donnerlittchen“, rief Frieda laut aus, als sie die Haustür hinter sich zugezogen hatte. „So ein herrlicher Tag!“ Sie atmete tief ein und roch die salzige Seeluft, die der Wind vom Kurischen Haff über die sandigen Dünen der Nehrung und die grünen Felder des Samlandes direkt bis vor ihr Elternhaus blies. Für einen Moment blieb sie mitten auf dem Bürgersteig an der Vorstädtischen Langgasse stehen, schloss die Augen und ließ die warmen Sonnenstrahlen ihr Gesicht bedecken. Ein wohliges Kitzeln [...]
Ein Sommerspaziergang durch Königsberg
Königsberg, 3. Juni 1940
„Donnerlittchen“, rief Frieda laut aus, als sie die Haustür hinter sich zugezogen hatte. „So ein herrlicher Tag!“ Sie atmete tief ein und roch die salzige Seeluft, die der Wind vom Kurischen Haff über die sandigen Dünen der Nehrung und die grünen Felder des Samlandes direkt bis vor ihr Elternhaus blies. Für einen Moment blieb sie mitten auf dem Bürgersteig an der Vorstädtischen Langgasse stehen, schloss die Augen und ließ die warmen Sonnenstrahlen ihr Gesicht bedecken. Ein wohliges Kitzeln durchzog ihre Mundwinkel, und sie reckte die Nase nach der lauen Brise, die auf ihrem Weg durch die preußisch-königliche Residenzstadt Königsberg den süßlichen Schweißgeruch abgekämpfter Pferde aufgenommen hatte. Den ganzen Tag über hatten die Tiere Getreidewagen aus den entlegensten Gebieten Ostpreußens zu den Speichern der Altstadt transportiert.
Frieda öffnete die Augen und schaute die Straße hinunter, die gesäumt war von Altbauten mit aufwendig verzierten Fassaden und Erkern. In großen Schaufenstern präsentierten Händler ihre Waren – von Seidentüchern und Schmuck bis hin zu frischem Obst und Gemüse. Aus der Ferne hörte Frieda zwischen dem Lachen spielender Kinder das vertraute Klingeln der Straßenbahnglocken heraus. Noch bekannter war ihr das heisere Husten, das sie in dem Moment hinter sich wahrnahm. Sie drehte sich um und erkannte ihren Vater, der durch die Eingangstür zu seinem Ladengeschäft im Erdgeschoss ihres vierstöckigen Hauses trat.
Hermann Wehlau wischte sich mit seiner karierten Schiebermütze den Schweiß von der Stirn, musterte seine Tochter und bemerkte beim Anblick ihrer auffälligen Wonne: „Na kiek mol an! Wat is denn schon en Book gegen dat schöne Wedder hier buten, nich wohr?“
„Aber ja, Vati“, antwortete Frieda und blinzelte ihn an. Wenn ihr Vater gute Laune hatte, verfiel er regelmäßig ausgeprägt in die ostpreußische Mundart. Seine Tochter mochte das, obwohl sie selbst stets darauf achtete, sauberes Hochdeutsch zu sprechen. Akademikern und Künstlern war das ausgesprochen wichtig. Sie war zwar weder das eine noch das andere, aber immerhin doch ziemlich belesen. Sie antwortete daher klar und deutlich: „Und wie viel zauberhafter ist es noch, wenn man bei dieser liebreizenden Wetterlage keine Schule hat, stattdessen durch die Stadt spazieren kann, nur um sich dann in seinem Lieblingsbuchladen einen brandneuen Roman kaufen zu können?“
Frieda trat nah an ihren Vater heran, streckte sich in ihren weißen, mit Holzperlen besetzten Schnürschuhen auf die Zehenspitzen und drückte dem leicht untersetzten Mann in brauner Schürze einen Kuss auf die Wange mit den rotgrauen Bartstoppeln. „Einen, den der liebste Vater der Welt seiner allerbesten und einzigen Tochter spendiert.“ Sie kicherte. „Danke, Vati.“
„Mensch, un ick hebb gehofft, mien Bookgutschein to dien Abituhr würd vielleicht wenigst’ns in en paar Fachböker für Kolonialwohrenkunde investiert, die du bold in de Beruffschool bruken könnst. Du weißt doch, dat ick de hülpenden Hänn miner eenzigen Dochter dringend in’t Familiengeschäft bruken do.“
„Papperlapapp, wo denkst du hin? Ich weiß doch auch so immer, was unsere Kunden wünschen, und kann dir deshalb immer im Laden helfen.“ Frieda hüpfte von einem Bein auf das andere und schleuderte den Trageriemen ihrer Leinenhandtasche gekonnt um das Handgelenk. Während sie zügig die Straße hinunterlief, drehte sie sich noch einmal zu ihrem Vater um, winkte ihm zu und rief: „Und so lange lese ich natürlich nur die schmutzigsten Sittenromane.“
„Ei, warscht du woll dat Muul hoalde“, jauchzte Hermann Wehlau, „du dreidammlicher Dämlack.“ Er lachte laut und warf Frieda seine Mütze hinterher. Aber sie war schon außer Reichweite. Sie wusste, dass ihr Vater sie manchmal gerne triezte und seinen Spruch mit dem Fachbuch sicher nicht ernst gemeint hatte, obwohl er damit auf ein sensibles Thema anspielte. Die Entscheidung über ihre berufliche Zukunft hatte Frieda in den vergangenen Monaten anstrengende Diskussionen mit ihren Eltern gekostet. Aber nun war alles durchgestanden. Am Freitag letzter Woche hatte sie nach einer kleinen Feier ihr Abgangszeugnis der höheren Mädchenschule erhalten – das beste ihres Jahrgangs. Alles Einsen und nur in Mathematik eine mit einem Minus davor. Eigentlich war sie prädestiniert dafür, zu studieren, das hatten ihr die meisten Lehrer persönlich gesagt. Insgeheim träumte sie schon lange davon, sich für Literatur einschreiben und danach Bibliothekarin werden zu können. Das war Friedas langersehnter Traum, aber eben nicht mehr als das, und dass er spätestens nach dem Abitur zerplatzen würde, war ihr immer schmerzlich klar gewesen. Sie hatte früh gewusst, dass ein Studium für sie nicht angedacht war, denn sie hatte schon darum kämpfen müssen, statt die Hauptschule das Mädchenlyzeum besuchen zu dürfen. Friedas Eltern besaßen nicht das Geld, um sie finanziell länger unterstützen zu können, das musste sie wohl oder übel akzeptieren.
Eine hell bimmelnde Glocke riss Frieda aus ihren Gedanken und ließ sie auf die Straße schauen. Sie erkannte, wie der Straßenbahnfahrer der Linie 2 hinter dem Fenster seinen Hut anhob und sie grüßte. Sie war eben eine echte Vorstadtdame und fühlte sich hier, wo sich über zwei Kilometer lang ein buntes Ladengeschäft an das andere reihte, im Grunde pudelwohl. Mit Bravour würde sie ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvieren, das wusste sie. Irgendwann würde sie zwischen der Konditorei Adomeit und der Fahrradbereifung Skibowski den elterlichen Kolonialwarenladen übernehmen und eben auf diese Weise glücklich werden. Ihre so geliebte literarische Welt würde damit nicht Geschichte sein. Im Gegenteil, schließlich hatte sich, sollte sie ihrem Vater diesbezüglich Glauben schenken, während einer Lesereise sogar schon einmal Thomas Mann hierher verirrt. Er hatte bei Kolonial- und Rauchwaren Wehlau Zigarren gekauft – bei ihrem Vater persönlich –, und das, nachdem der Schriftsteller den Literaturnobelpreis erhalten hatte.
Es war nicht ausgeschlossen, dass ebendieses große Vorbild eines Tages, wenn der überflüssige Krieg ein Ende gefunden hatte, noch einmal Königsberg besuchte und dann zu ihr in den Laden käme, um über den Zauberberg zu sprechen. Das war natürlich eine Spinnerei, aber Frieda schmiedete schon Pläne, die ihr Tabakverkäuferinnendasein versüßen könnten und die realistischer wären als der Besuch eines literarischen Genies wie Thomas Mann im elterlichen Laden. Sie dachte darüber nach, eines Tages Romanheftchen mit ins Verkaufssortiment aufzunehmen oder heimlich im Nebenberuf und unter Pseudonym als erfolgreiche Romankritikerin zu veröffentlichen. Vieles war möglich und das Leben für sie hoffentlich noch lang. Außerdem, bestimmt würde sie auf der Berufsschule nette Freundinnen finden. Und das war schon was wert.
Als Frieda auf der Vorstadtstraße ankam, die direkt zum Pregelufer führte, blieb sie einen Moment stehen und schloss die obersten Knöpfe ihrer weißen Bluse, die sie über einem hellblauen Sommerkleid trug. Ihr fiel jetzt deutlich auf, dass trotz des ausgezeichneten Wetters nur wenige Spaziergänger auf den Beinen waren. Das beobachtete sie jedes Jahr zu Anfang der Sommerferien. Der Großteil der Königsberger Familien reiste gleich am ersten Ferientag ab, um sich keine Minute Erholung an ihren Urlaubsdomizilen an der Samlandküste oder in den Fischerdörfern auf der Kurischen Nehrung entgehen zu lassen. Und in diesem Jahr war zusätzlich Pfingsten auf den Beginn der Ferien gefallen. Vom Nordbahnhof fuhren jetzt täglich mehr als dreißig Bäderzüge ab, die fast immer voll besetzt waren.
Frieda lief weiter über die alte und unebene Straßenpflasterung, aus der kleine Grasbüschel zwischen den Steinen hervorsprossen. Sie genoss die Stille ihrer Stadt und beobachtete, wie die Blätter der großen Lindenbäume sanft im Wind wogten. Ihre Gedanken wanderten zurück zu den Geschichten, die sie liebte, und sie stellte sich vor, wie es wäre, wenn ihre Lieblingsfiguren durch die historischen Straßen ihrer Stadt wandelten. Warum gab es eigentlich keinen erstklassigen Roman, der in Königsberg spielte? Der fehlte noch. Sie lächelte. Vielleicht würde sie eines Tages selbst dieses Buch schreiben.
Frieda konnte schon das Geländer der Grünen Brücke erkennen, die über den blaugrün schimmernden Pregel führte, als sie das Getrappel beschlagener Hufe hinter sich wahrnahm. Kurz darauf polterten mit zusammengeschnürten weißen Getreidesäcken bepackte Wagen, die von schweißnassen Pferden gezogen wurden, in Kolonne an ihr vorbei. Vor dem Ufer bogen sie nach Westen in Richtung Große Krahngasse ab, wo die Kornkammern der neuen Speicher darauf warteten, mit Getreide für den Winter vollgepackt zu werden.
Ein Gaul, der sie passierte, wieherte laut, sodass es fast wie ein Lachen klang. Das ist die pure Vorfreude, dachte Frieda, die am heutigen Tag vom gleichen Gefühl befallen war. So wie sie sich an der Pforte zur Altstadt auf ihre Bücher freute, erkannten die Pferde beim Anblick des Pregels und der hohen Kräne, dass man ihnen in ein paar Minuten die wuchtige Last, die sie viele anstrengende Stunden lang gezogen hatten, abnehmen würde. Während die Arbeiter dann die Getreidespeicher der riesenhaften, spitzen Fachwerkhäuser und die Silos befüllen würden, dürften die Pferde sich endlich ihren wohlverdienten Hafer schmecken lassen.
„Hallo, Hexe, he, Frieda.“ Von der anderen Straßenseite kreuzte ein rostiges Fahrrad, auf dem Horst saß. Er klingelte. „Wohin des Weges?“
„Haus der Bücher“, rief sie ihm zu. „Ich habe einen Gutschein von meinem Vater.“
„Toll“, schrie der Zehnjährige im Vorbeifahren. „Vergiss bloß nicht, mir Der Schatz im Silbersee zu kaufen.“
Frieda tippte mit dem Zeigefinger auf ihre Stirn, doch das sah der Junge, der bei ihnen Milch auslieferte, schon nicht mehr. Sie mochte Horst, selbst wenn er sie wegen ihrer roten Haare triezte. Da hatte es auch nicht geholfen, dass sie ihm vor ein paar Wochen erklärt hatte, dass Hexenverbrennungen in der Frühen Neuzeit Frauen und selbst Männer aller Haarfarben getroffen hatte und dass Horst einem Mythos aufgesessen war. Frieda machte sich nichts aus den Neckereien, sie liebte ihre Haare, die obendrein nicht rot, sondern erdbeerblond waren. Außerdem glaubte sie, dass Horst in sie verliebt war und nicht anders konnte. Nun ja, er war ein paar Jährchen zu jung für sie, und obwohl sie von Männern jeden Alters bezirzt wurde, hatte Frieda bislang kein großes Interesse am anderen Geschlecht. Jedenfalls nicht im realen Leben. „Die besten Kerle finden sich in Romanen“, sagte sie, wenn sie von Bekannten mal wieder gefragt wurde, ob sie denn endlich jemanden gefunden hätte. Der Richtige würde schon kommen – irgendwann.
Nun zurück zu den wichtigen Dingen, dachte sie. Wie sie die fünfzehn Reichsmark, die auf dem Gutschein ausgewiesen waren, anlegen wollte, wusste Frieda längst. Theoretisch könnte sie sich zwar davon zwei brandaktuelle Romane leisten, andererseits einen neuen und dazu ein paar ältere Schmöker oder aber einen ganzen Korb voller Romanheftchen. Doch warum sollte sie sich überhaupt begrenzen? Frieda brauchte das großzügige Geschenk ihres Vaters schließlich nicht in Neuwaren investieren. Dazu gab es doch zu viel, das man lesen musste. Zum Glück war der Abiturientin das Sommerangebot der sich im Haus der Bücher befindlichen Leihbibliothek nicht entgangen, die sie seit Jahren mehrmals die Woche und immer, wenn sie ein bisschen Freizeit hatte, besuchte, um alles lesen zu können, was sie sich zu kaufen nicht leisten konnte. Das liebte sie so am Verkaufsprinzip von Deutschlands umfangreichster Buchhandlung, dass selbst in den Verkaufsräumen alle Interessenten zu fast jedem Werk Leseexemplare fanden, mit denen sie sich in Ruhe in eine Leseecke setzen durften. In der Leihbibliothek, die allein über 45.000 Titel umfasste, konnten sich seit Ende Mai Kunden gegen eine Pfandgebühr von zehn Reichsmark pro Woche fünf Bücher entleihen. Dafür waren dann fünfzig Pfennig fällig. Bezahlte man zwei Mark im Monat obendrauf, erhielt man zusätzlich das Recht, täglich ein Buch nach Belieben zu wechseln. Eine Rechnung, die sich für Frieda ganz sicher bezahlt machen würde. Ein Traum! Die Bibliothek im Haus der Bücher war eben keine normale städtische Leihanstalt oder langweilige Volksbibliothek, wo man nur Titel der vergangenen Jahre in tristen, einfarbigen Schutzumschlägen ausgehändigt bekam. Die Auswahl war riesengroß. Das bedeutete, dass Frieda sich, sofern sie schnell genug war, dort für ihr Geld immer die neuesten Romane, schon am Tag, an dem sie in den Verkauf gingen, entleihen konnte. Natürlich waren die nur in stark begrenzter Anzahl zu haben, aber Frieda hatte überhaupt kein Problem damit, jeden Tag am Haus der Bücher vorbeizugehen. Sie liebte diese Besuche, nicht nur wegen der Romane, sondern auch der Menschen halber, die sich dort versammelten – andere Buchliebhaber, Studenten, Professoren und gelegentlich ein Schriftsteller oder Dichter, der seine neuesten Werke signierte. Gerade jetzt in den Ferien, wo sich weniger Kunden in die Buchhandlung verirrten, standen die Chancen sogar mehr als gut, ihre Wunschtitel zu finden. Außerdem hatte Frieda sich längst gemerkt, um welche Uhrzeit die Bibliothekarinnen die Bücher, die am späten Abend des vergangenen Tages zurückkamen, auf ihre Wagen legten und neu einsortierten. Während Frieda auf die Grüne Brücke lief, rechnete sie im Kopf noch mal genau nach. Natürlich, am findigsten wäre es, die kompletten fünfzehn Mark direkt in der Bibliothek anzulegen, so hätte sie schon sechs Wochen im Voraus für insgesamt mindestens dreißig Bücher bezahlt, getauschte Titel nicht eingerechnet.
„Warum habe ich eigentlich ein Minus vor der Eins in Mathe?“, sprach sie leise zu sich selbst, als sich vor ihr das Panorama des Hundegatts eröffnete. Auf dem sonnenglänzenden Wasser sah Frieda die großen, rauchenden Dampfschiffe, die morschen Fischerkutter und die schnittigen Segelboote kreuzen. Dann fiel ihr Blick auf die am östlichen Flussufer in ihren Verkaufsständen hantierenden, in schwarzen Westen steckenden Fischersfrauen. Ihr Krakeelen hörte man bis hier rauf auf die Brücke: „Dörsche, freesche Dörsche – Karpe, Karpe, goode Karpe, wohlfeil – Strämling – Späckflundre – ei Butterzant – Hie freeschen Krabben.“
Eine Horde Kinder war damit beschäftigt, mit Besen oder Brettern aufdringliche Möwen von den aufgebahrten Dorschen, Flundern, Plötzen und besonders von den kostbaren geräucherten Aalen fernzuhalten. Frieda schmunzelte, weil dies so ein typisches Bild für ihr einmaliges Königsberg abgab. Doch ihre Mundwinkel fielen schon wieder herab, als sie im nächsten Moment auf ihre Armbanduhr schaute.
Mist, es ist elf Uhr dreißig! Frieda hatte ihrer Freundin Lotti, mit der sie sich um zwölf Uhr treffen wollte, versprochen, dass sie etwas eher am Blutgericht sein würde, um für sie einen Tisch auf der Außenterrasse zu reservieren. Jetzt aber zackig!
Frieda hatte ihrem Vater lieber nicht erzählt, dass sie vor ihrem Einkauf in die historische Weinstube im Schlosshof einkehren wollte. Obwohl er natürlich wusste, dass es Tradition für alle Königsberger Schüler war, sich nach ihrem Schulabschluss – welcher Art auch immer – in der sagenumwobenen Gaststätte ein Glas Wein abzuholen. Er nahm jedoch sicherlich an, dass seine Tochter an so etwas gar nicht interessiert wäre, und damit hätte er auch recht. Frieda setzte sich weder gerne unter betrunkene Menschen, noch konnte sie in der Regel selbst dem Alkohol etwas abgewinnen. Aber sie hatte es Lotti versprochen, die unbedingt ein letztes Mal mit ihr zusammenkommen wollte, bevor sie verreisen würde. Und das Blutgericht lag ja genau auf dem Weg, den Frieda zum Haus der Bücher nehmen musste. Also weiter!
Die Grüne Brücke führte zu den vierstöckigen, hanseatischen Häusern mit schmaler Front und straßenseitig gewölbten Giebeln der Kneiphofschen Insel, dem Zentrum der Stadt, das von den Einheimischen schlicht die Pracht genannt wurde. Um die geschäftige Stadtinsel flossen die Arme des Neuen und des Alten Pregel zusammen, bevor sie gemeinsam östlich ins Frische Haff mündeten. Frieda lief schnellen Schrittes durch die enge Kneiphofsche Langgasse, vorbei am vierhundert Jahre alten Rathaus mit seiner weitläufigen Freitreppe und am imposanten Dom, in dem die Gebeine des Philosophen Immanuel Kant ruhten, dessen Schriften sie fast vollständig gelesen hatte. Zwischen den hohen Türmen des Gotteshauses, von denen einer nie fertiggestellt wurde, konnte sie schon die Dächer der Albertina sehen, der alten, ehrwürdigen Universität, in der auch das wunderschöne Bernsteinmuseum untergebracht war.
Beim Anblick dieser bedeutenden Stätten spürte Frieda immer etwas, das sie selbst als Lokalpatriotismus bezeichnen würde und das sie weit mehr ergriff als der Stolz aufs Vaterland oder gar die Treue zum Führer. Königsberg war viel älter als all das. Frieda lebte innerhalb einer Festung, ihr zu Füßen lag die Seele der preußischen Armee. Wenn sich unsere Vorfahren auf eines verlassen konnten, dann auf den Festungswall von Königsberg, hatte ihre Mutter, die aus einer alten Soldatenfamilie stammte, gesagt. Das hatte sie betont, als Frieda sich anfänglich Sorgen über den Ausbruch des Krieges gemacht und sogar befürchtet hatte, ihr eigener Vater könnte zum Kampf eingezogen werden. Ihre Mutter hatte daraufhin versichert, dass Frieda sich auch heute nirgendwo so sicher fühlen könne wie innerhalb der Mauern ihrer Heimatstadt. Dieses Gefühl spürte sie nun selbst. Es war unvorstellbar, dass auf Königsberg einmal Bomben fallen könnten.
Mit erhobener Brust verließ Frieda die Pracht über die Krämerbrücke. Gedankenversunken wäre sie dahinter beinahe in die Altstädtische Langgasse eingebogen und ihren täglichen Schulweg gegangen. Ganz am Ende der Straße lag die Körte-Schule für Mädchen, die jetzt ihrer Vergangenheit angehörte. Also Augen geradeaus, Frieda!
Sie lief auf den Kaiser-Wilhelm-Platz zu, am Bismarck-Denkmal und an einem Geigenspieler vorbei, der sich vor einem der Fontänen-Brunnen aufgestellt hatte. Ein paar kleine Kinder und ein bildschöner brauner Hund hüpften und tanzten um den Musiker herum. Friedas Blick wanderte über die massiven, mit Moosen und Kletterpflanzen bewachsenen Wehrtürme und Burgmauern hoch bis zur Uhr auf dem Dach des spitzen, weit in den Himmel ragenden Schlossturmes, von dem eine mindestens zehn Meter lange Hakenkreuzfahne herabfiel. So schwer und scheinbar fest verwachsen mit den Steinen, dass kein Windstoß sie bewegte. Die Zeiger der Uhr standen auf fünf vor zwölf. Also früh genug.
Jetzt musste sie nur hoffen, dass Lotti noch nicht da war. Frieda bog um die Ostflanke der Schlossmauer und schaute dahinter schon direkt auf die neuen Außentische des Blutgerichts, die unter aufgespannten schwarz-gelben Sonnenschirmen standen und bis auf einen einzigen nicht besetzt waren. Das war doch klar, dass da keiner sitzen wollte, dachte Frieda, schließlich sollte den Reiz des Blutgerichts ausmachen, dass sich die Gäste unten in dem Kellergewölbe gruselten, während sie ihren Wein tranken. So wie es der Text auf dem bronzenen Schild versprach, das an der Schlossmauer vor der in jedem Reiseführer als beste Weinstube der Stadt beworbenen Gaststätte hing:
Schaurig Gewölbe, drohend einst den Sündern mit Pein und Marter – aber heute bluten nur Pullen hier für Böse und Gerechte.
Als Frieda den Text las, meinte sie, dass das doch nun wirklich keine schmackhafte Einladung sein könnte. Warum sollte überhaupt jemand Blut und Folter mit Weingenuss assoziieren wollen? Aber vor allem bei den Besuchern Königsbergs kam das offensichtlich gut an. Auch heute hörte Frieda aus dem Gewölbe lautes Grölen und Lachen aus Männerkehlen und war nur froh, dass sie da unten nicht reingehen musste, und auch, dass sie sich erst ein paar Tage nach der Abschlussfeier hier verabredet hatten.
Vom einzigen besetzten der vier Tische prosteten ihr drei Fischersleute zu. Mit wettergegerbten Gesichtern und rauen Händen hoben sie ihre Gläser, aus denen Bierdunst aufstieg, und brabbelten irgendetwas von „schicket Marjellchen“. Ihre groben, abgetragenen Wollpullover und schmutzigen Hosen, die von den vielen Tagen auf See erzählten, verstärkten den Eindruck ihrer harten Lebensweise. Frieda lächelte verlegen und suchte sich schnell den äußersten Tisch aus, wo sie sich mit dem Rücken zu den Männern niederlassen konnte. Sie hatte keine Lust auf einen derben Spruch und schon gar nicht auf ein unangenehmes, aufgezwungenes Gespräch mit mittelalterlichen Fischersfritzen.
„Willkommen in der ostpreußischen Pein- und Weinkammer. Darf ich Ihnen schon etwas bringen?“ Als Frieda die aufgesetzt freundlich klingende Stimme hinter sich hörte, drehte sie sich um. Der Kellner, ein hochgewachsener Mann mit gebückter Haltung, trug eine abgenutzte blaue Weste über einem weißen, leicht vergilbten Hemd. Eine schmale schwarze Krawatte hing lose um seinen Hals. Er hielt ein Tablett in der Hand, auf dem sich einige leere Gläser und eine Weinflasche befanden.
„Nein danke“, antwortete Frieda. „Ich warte noch auf …“
„Nicht nötig“, drang es von der anderen Seite an ihr Ohr. „Bin schon da, und, der Herr, wir wissen schon lange, was wir wollen. Seit dreizehn Schuljahren warten wir darauf. Bringen Sie uns zuerst zwei Gläser Türkenblut und danach zwei bis oben hin volle Gläser ihres über alle Grenzen hinaus bekannten und geschätzten Hausweins.“
„Selbstverständlich, die Damen. Und ganz herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden zum Abitur.“ Der Kellner zog einen Schreibblock aus seiner umgebundenen Lederschürze, notierte etwas darauf und lief zurück zum Eingang des Gewölbes.
„Wie unglaublich frech du bist, Lotti“, sagte Frieda, während sie aufstand und ihre Schulfreundin lächelnd in den Arm nahm. Lotti mit ihren langen braunen Locken, die weich auf ihre Schultern fielen, trug ein schlichtes, aber elegantes Sommerkleid in Hellgrün, das ihre schlanke Figur betonte. Ihre großen blauen Augen funkelten vor Freude, und ihre Wangen waren leicht gerötet vor Aufregung.
Sie herzten sich ein paar Sekunden, dann setzten sich beide Mädchen an den Tisch, steckten die Köpfe eng zusammen und ließen die letzten Schultage Revue passieren. Als ihr Sekt mit dem Schuss Rotwein kam, sprudelte die blubbernde Flüssigkeit in den schmalen Gläsern und schimmerte im Licht der Sonne. Sie stießen auf ihren glorreichen Abschluss an, und Frieda konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, denn sie wusste, dass Lotti mit ihren Noten eigentlich nicht zufrieden sein konnte. Aber ihrer Freundin waren die vielen Dreier augenscheinlich egal. Sie strahlte eine ungezwungene Fröhlichkeit aus, mit der sie jeden in ihrer Nähe anzustecken vermochte.
Als der Kellner den Hauswein in einem stilechten braunen 1,5-Liter-Krug brachte, zusammen mit einem übervollen Teller voll Schmalzbroten, hatten sich die Klassenkameradinnen bereits darüber ausgetauscht, was jede von den anderen Mädels wusste: wer nach dem Abitur welchen Weg einschlagen würde, wer aktuell einen Freund hatte und wer sogar schon von einer Hochzeit sprach.
„Ei, tut das gut“, sagte Lotti und kicherte, nachdem sie einen großen Schluck aus ihrem Tonbecher mit aufgemaltem Königsberger Wappen genommen hatte. Ihre Augen leuchteten vor Genuss. „Eine unglaublich süße Rebe, sorgfältig gelesen von unseren fleißigen französischen Kriegsgefangenen.“
Frieda musste lachen. Sie griff nach einer Scheibe des frisch gebackenen Brotes, das mit einer großzügigen Schicht Schmalz bestrichen war, und biss herzhaft hinein. „Ja, das hat Charme“, antwortete sie, während sie den warmen, würzigen Geschmack genoss. Dann trank sie selbst. „Mmh, wirklich erfrischend.“
Sie stießen nacheinander darauf an, keine Hausaufgaben mehr erledigen zu müssen, endlich für immer die albernen Schulkleider in den Schrank räumen zu können, nie wieder BDM-Dienst machen zu brauchen, und vor allem darauf, frei und erwachsen zu sein. Sie fanden so viele Gründe zum Zuprosten, dass der Krug nach einer Stunde fast leer war und die Brote aufgrund der anregenden Wirkung des Getränkes aufgegessen.
„Und jetzt trinken wir noch auf den Führer“, sagte Lotti und goss den Rest in ihre Becher. „Auf dass er bald England niederringe und wir wieder frei in der Welt herumreisen können.“
„Trinken wir doch lieber gleich auf den Frieden“, sagte Frieda, strich sich mit der linken Hand verlegen eine Locke hinter ihr Ohr und stieß dann mit Bedacht ihren Becher gegen den ihrer Freundin.
„Ei ja, warum eigentlich nicht gleich auf den Weltfrieden?“, antwortete Lotti und lachte in ihr Getränk. Nach einem weiteren großen Schluck waren die Freundinnen für ein paar Sekunden still, in denen sie überlegten, über was sie sich mit der jeweils anderen noch dringend austauschen wollten.
„Du, Frieda, ich freu mich ja so auf Cranz“, sagte Lotti schließlich. „Das Meer ist an der Küste jetzt so hellblau und glänzend und erscheint unendlich weit, wenn man vom Steg rausschaut.“
„Kann ich mir vorstellen. Und ihr fahrt morgen schon los?“
„Ei ja, deswegen kann ich auch nicht so lange heute, ich muss ja alles noch packen. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Wolltest du noch eine zweite Karaffe bestellen?“
„Donnerlittchen, du spinnst wohl“, lachte Frieda. „Mir dreht sich ja jetzt schon alles. Ich will gleich unbedingt zum Haus der Bücher und meinen …“
„Gutschein einlösen“, ergänzte Lotti. „Jaja. Du hast mir das doch am Freitag schon alles erzählt. Du und deine Bücher. Das ist echt eine Liebe für die Ewigkeit. Ich verstehe das nicht. Was findest du darin nur?“
Sie schüttelte den Kopf und hielt dabei die Krempe ihres weißen Strohhutes fest. „Ich werde nicht ein einziges Buch mitnehmen in den Urlaub. Wenn ich in meinem gemütlichen Strandkorb am Badestrand sitze, höre ich nur den Möwen zu und dem lieblichen Orchester aus dem Musikpavillon. Ich werde den ganzen Tag die Promenade beobachten und schauen, wer sich diese Saison sehen lässt. Mensch, bis zu fünfzehntausend Gäste erwartet das kleine Cranz. Ein Wahnsinn. Und das mitten im Krieg.“ Sie überlegte: „Vielleicht ist ja dieser unglaublich attraktive Litauer wieder da, der Schachspieler, der Deutschbalte, der im gleichen Hotel untergekommen ist im vergangenen Jahr. Du weißt schon. Damals an der Bar, als er mir den Hof gemacht hat vor allen. Dieses Mal werde ich ihm sicher keinen Tanz abschlagen.“
„Genau das“, sagte Frieda, trank ihren letzten Schluck und lächelte.
„Wie bitte?“ Lotti schaute sie fragend an. „Ich verstehe nicht, was du meinst.“
„Na, genau das“, wiederholte sie. „Wegen deiner Frage eben. Genau das finde ich in meinen Büchern. Die schönen Dinge, die du gerade beschreibst.“
„Wie? Cranz?“
„Zum Beispiel.“
„Welches Buch spielt denn an der Samlandküste?“ Lotti zog die Stirn in Falten und nahm dann Friedas Hand. „Ach, entschuldige, Liebchen. Ich habe nicht daran gedacht, dass ihr kein Geld habt und nie in den Urlaub fahren könnt. Wie unsensibel von mir. Das muss wirklich schrecklich für dich sein. Und jetzt schwärme ich auch noch so.“
„Ist es nicht“, antwortete Frieda. „In meinen Büchern kann ich sogar noch viel weiter reisen. Was ist schon Cranz, wenn ich an einem Tag im luxuriösesten aller Speisewagen durch die schneebedeckten Alpen fahren kann, am nächsten Tag mit einem Glas Champagner auf dem Balkon meiner römischen Villa an der Adria sitze und den Wellen zusehe oder wieder einen Lesetag später von meiner Erste-Klasse-Kabine auf einem Hochseedampfer bei Sonnenaufgang die Freiheitsstatue vor New York bestaune?“
„Ei, du spinnst ja“, raunte Lotti und lachte. „Amerika. Roosevelt will doch gar keine Deutschen mehr haben in seinem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.“
„Dir fehlt einfach die Fantasie.“
„Nein, du hast zu viel davon.“
„Vielleicht. Aber in meinen Büchern habe ich die absolute Freiheit, tun und lassen zu können, was immer ich will. Ich kann nicht nur sein, wo ich sein möchte, sondern auch, wer ich sein möchte. Egal, ob Mann oder Frau, Kind oder Greis. Ich bin mal Prinzessin Cleopatra in der heißen Sonne Ägyptens, dann der Walfänger Kapitän Ahab auf stürmischer See oder Alice im Wunderland und spreche mit Hasen. Ich kann auch der Litauer sein oder die Litauerin oder ein Engländer oder ein Jude.“
„Tss“, zischte Lotti. „Jude? Also bitte, der Wein geht mit dir durch. Wer will denn heutzutage ein Jude sein?“ Sie hob den Arm und winkte nach dem Kellner. „Zahlen bitte!“
„Bist du jetzt neidisch?“, fragte Frieda mit ernster Miene und brach kurz darauf in Gelächter aus, weil Lotti sie entgeistert angeschaut und entgegnet hatte: „Nein, du etwa?“ „Wirklich nicht“, antwortete Frieda. „Also nicht auf Cranz oder deine Reisen. Aber dass du studieren kannst, wenn du zurück bist, das macht mich schon neidisch, das gebe ich zu.“
„Erinnere mich jetzt bloß nicht daran“, sagte Lotti. „Ich hoffe eher darauf, dass mir der Litauer vorher einen Heiratsantrag macht und mich mitnimmt auf sein Schloss nach Reval.“
„Wilna.“
„Hä? Wo willst du hin?“ Lotti verzog eine Augenbraue.
„Du meinst Wilna“, sagte Frieda. „Das ist die Hauptstadt von Litauen. Reval ist in Estland. Davon abgesehen ist das keine gute Idee, weil beide Länder seit letztem Jahr von der Sowjetunion besetzt sind.“
„Ei, wie auch immer“, antwortete Lotti. „Hauptsache, er liebt mich und beschenkt mich reich, dann ist mir egal, wo.“ Sie zog ihre Geldbörse aus der Handtasche, weil der Kellner mit der Rechnung zum Tisch gekommen war. „Ich lade dich ein.“
Frieda schüttelte den Kopf. „Oh, danke“, sagte sie. „Aber das musst du nicht. Also, ich wollte nicht darauf anspielen, dass … So war es nicht gemeint.“
Lotti lächelte und gab dem Kellner den Schein. „Stimmt so“, sagte sie und winkte ab, als der Ober sich bedankte. Dann nahm sie erneut Friedas Hand und streichelte sie sanft. „Denk doch nicht immer so viel, Menschenskind.“
Frieda seufzte und murmelte: „Cogito, ergo sum.“
Lotti lachte leise. „Was auch immer. Versprich mir, dass du auf dich und unser Königsberg aufpasst, solange ich weg bin, ja?“
„Natürlich. Versprochen.“
Lotti strahlte. „Wenn ich wiederkomme, haben wir noch ein paar Tage Zeit, und wir kommen noch mal her, ja? Und gehen ins Freibad am Oberteich, einverstanden?“
Friedas Augen leuchteten bei der Vorstellung. „O ja“, antwortete sie begeistert. „Das klingt wunderbar.“
Die beiden Freundinnen standen auf und nahmen sich noch lange in den Arm. Sie kannten sich seit dem ersten Tag in der Volksschule und hatten jeden einzelnen Schultag, sofern niemand krank gewesen war, nebeneinandergesessen. Nichts hatte sie bisher auseinanderbringen können – auch nicht der völlig unterschiedliche Lebensstandard ihrer Familien. Lotti war die Tochter des wohlhabenden Eisfabrikanten August Froese, der alle Cafés und Restaurants in der Stadt mit seinen Kugeln, Eisschnitten und selbst gebackenen Waffeln belieferte. Außerdem war er Ehrenmitglied der Königsberger SA und mit allen Politbonzen befreundet. Es war also kein Wunder, dass seine Geschäfte nach der Machtergreifung immer weiter expandieren konnten und er heute nahezu konkurrenzlos war. Zum Glück machte sich Lotti nicht viel aus Politik, doch ab und an ließ sie Ansichten durchblicken, die sie von ihrem Vater übernommen hatte. In der Regel ignorierte Frieda blöde Bemerkungen aus der NS-Kiste, der sie selbst gar nichts abgewinnen konnte. Ihre Eltern hatte sie immer unpolitisch erlebt. Das gefiel ihr.
Nachdem sich Lotti endgültig verabschiedet hatte und in Richtung Roßgärtner Markt davongelaufen war, schlenderte Frieda zufrieden den Weg zum Paradeplatz entlang, wo sich das Haus der Bücher neben den Gebäuden der Universität befand. Dabei merkte sie, dass sie leicht wankte, und nutzte die Gelegenheit, sich noch einmal kurz auf eine Bank am Ufer des Schlossteiches zu setzen, den sie auf ihrem Weg passierte.
Frieda genoss den leichten Schwindel, der in ihrem Kopf aufzog, das wohlig warme Kribbeln in ihrer Brust und schaute träge den Schwänen und Ruderbooten zu, die sich auf den flachen grünen Wellen gegenseitig spielerisch, aber gekonnt auswichen. Auf der Promenade erspähte sie ein paar junge Männer in Wehrmachtsuniform. Einige trugen Verbände um Kopf und Arme, einer humpelte auf Krücken, ein weiterer wurde von einer Krankenschwester in einem Rollstuhl geschoben.
Donnerlittchen, wenn wir uns da bloß mal nichts vormachen in unserer schönen, heilen Königsberger Welt. Nicht weit von uns tobt anscheinend die Hölle.







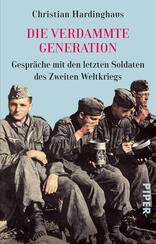




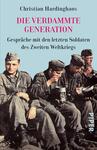

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.