

Die Einmaligkeit des Lebens - eBook-Ausgabe Die Einmaligkeit des Lebens
Roman
„Ihm gelingt die Gratwanderung, zu berühren, ohne kitschig zu werden oder ins Klischeehafte abzudriften. Das hat viel mit seiner Erzählkunst zu tun.“ - Aachener Zeitung
Die Einmaligkeit des Lebens — Inhalt
Vom Füreinanderdasein und Abschiednehmen – eine Geschichte voller Demut und Trost
Sein Bruder war immer da, wenn Simon ihn brauchte. An Ostern 1988 etwa, als Simon den Judas von dem berühmten Schnitzaltar riss. Auch als wenig später seine Liebe zu Martha zu scheitern drohte, wusste Vinzenz, was zu tun war. Über die Jahre blieben die beiden einander eng verbunden. Jetzt, als Vinzenz zurückkehrt, merkt Simon, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er ist fahrig, verliert das Bewusstsein. Nach der Diagnose ist es Vinzenz, der seinen Bruder bittet: Rette mich.
Ein berührender, wahrhaftiger Roman über Nähe und Ohnmacht, über das „Viel zu früh“ und die Schönheit all dessen, was war.
Leseprobe zu „Die Einmaligkeit des Lebens“
Textbeginn
Ende Mai dieses Jahres stand ich an einem Krankenbett. Darin lag mein Bruder Vinzenz, der darauf wartete, am Kopf operiert zu werden. Und wenn ich sage „am Kopf“, dann deshalb, weil ich mich scheue zu sagen, dass sie sein Gehirn öffnen wollten, um etwas zu entfernen, das halb so groß war wie ein Tischtennisball. Etwas, das sich auf den Bildern schwarz vom Gewebe abhob und einen hellen Hof hatte, von dem niemand uns erklärte, was es damit auf sich hatte. Überhaupt erklärten die Ärzte wenig, sagte mein Bruder. Ich verstand ihn schlecht, aber ich [...]
Textbeginn
Ende Mai dieses Jahres stand ich an einem Krankenbett. Darin lag mein Bruder Vinzenz, der darauf wartete, am Kopf operiert zu werden. Und wenn ich sage „am Kopf“, dann deshalb, weil ich mich scheue zu sagen, dass sie sein Gehirn öffnen wollten, um etwas zu entfernen, das halb so groß war wie ein Tischtennisball. Etwas, das sich auf den Bildern schwarz vom Gewebe abhob und einen hellen Hof hatte, von dem niemand uns erklärte, was es damit auf sich hatte. Überhaupt erklärten die Ärzte wenig, sagte mein Bruder. Ich verstand ihn schlecht, aber ich wollte mich nicht zu ihm hinunterbücken, ihm nicht deutlich machen, wie erbärmlich er sprach, dass ihm auch die Worte fehlten, dass alles anders geworden war.
Sein Kopf lag in den Kissen. Er trug T-Shirt und Jogginghose, als hätte er sich fürs Training umgezogen. In unserer Jugend waren wir ziemlich fit, wir hatten gute Beine, und wenn Eick, unser Trainer, nach dem Torschusstraining und den Freistoßvarianten uns noch für ein paar Sprints über den Platz scheuchte, machte uns das wenig aus. Mal gewann Vinzenz, mal gewann ich. Nichts würde uns auseinanderbringen, davon war ich mein Leben lang überzeugt, auch noch an diesem Tag an Vinzenz’ Bett, und als hätte er meine Gedanken erraten, sagte er: „Lass uns bald wieder …?“ Die letzten Worte verstand ich nicht, doch ich fragte nicht nach und sagte stattdessen: „Ja, wir gehen wieder zusammen laufen“, denn danach wird er gefragt haben.
Ich nahm seine Hand. Hielt sie fest. Ich verkniff mir, ihm über den Arm oder den Kopf zu streichen. Es war schon alles außergewöhnlich genug.
„Ich komm jetzt gleich noch mal in die Röhre“, sagte Vinzenz sehr langsam. Ich nickte, und Vinzenz zeigte auf den kleinen Plastikbecher, in dem noch eine Tablette lag. Dann lächelte er verlegen.
„Wir werden ihm etwas zur Entspannung geben“, hatte die Oberärztin gesagt, nachdem ich ihr tags zuvor erklärt hatte, dass Vinzenz vor nichts Angst habe, auch nicht vor der Enge. Und tatsächlich: Das war nie ein Problem gewesen.
„Jetzt offenbar schon“, hatte sie entgegnet.
Vinzenz sah aus, als wäre er zufällig zur Tür hereingekommen und hätte sich spaßeshalber in dieses Bett gelegt. Er hatte in den vergangenen Wochen Farbe bekommen, das dunkelblonde Haar fiel ihm wie frisch gekämmt in die Stirn. Er war rasiert, seine Fingernägel geschnitten. Auf der Hose und dem T-Shirt war kaum ein Fleck, obwohl er Mühe hatte, die Kaffeetasse zu halten und an den Mund zu führen. Sie stieß ihm ans Kinn oder an die Nase, und er sagte Sachen wie: „Anschauen, in die rechte Hand nehmen, die Lippen finden. Jetzt.“ Sobald er zögerte, sich sammelte, aufrichtete oder seine Hand an der Tasse vorbei in die Luft griff, sah ich die senkrechte Falte auf seiner Stirn, die dort immer auftauchte, wenn die Wut ihn packte. Als die Schwester ins Zimmer kam, um ihn für das MRT abzuholen, und sagte: „Wir müssen, Herr Brougen“, da flüsterte er: „Schwester, ich Arschloch finde die Tasse nicht.“ Seine Aussprache war dabei ganz klar.
Sie schob ihn hinaus, Vinzenz drehte noch einmal den Kopf, und in seinem Blick stand, was wir beide nicht auszusprechen wagten. Er wird es auch in meinen Augen gelesen haben. Die Tür fiel laut ins Schloss. In Krankenhäusern tun die Türen das und lassen uns spüren, dass hinter jeder Türe eine eigene Welt beginnt, die Distanz zu den Fluren verlangt. Ich riss das Fenster auf, ließ Luft und die Stimmen der Menschen unten im Klinikgarten herein. Ein Schwirren, zu weit entfernt, als dass ich was verstand. Nur ein Geräusch, etwas Leben. Dann sank ich zurück auf den Stuhl. Ich wollte nicht weinen.
Der Zeiger der Uhr tickte viel zu laut. Ich nahm sie von der Wand und legte sie in den Schrank. Über dem Flachdach der Notaufnahme stand die Hitze, die Bepflanzung darauf war gelb und mickrig. Jemand hätte sie gießen müssen. Gleich würden sie meinen Bruder zurückbringen. Nichts in meinem Leben hatte ich je so gefürchtet. Ich hörte Schritte auf dem Flur, und sobald sie sich wieder verloren, atmete ich auf. Schließlich das Tacktack an der Tür, die Ärztin betrat das Zimmer. Ihre Stimme war klar, und darin lag eine Härte, die all die Diagnosen, all die Operationen ihr verliehen hatten, weil niemand, der diese Härte nicht hat, ihren Job machen kann. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.
2017
Ein paar Wochen zuvor war ich am frühen Morgen schon draußen auf dem Fluss. Ein Windstoß fuhr durch die Bäume. Ich holte das Paddel ein und ließ mich treiben. In den ersten Sonnenstrahlen tanzten Mückenschwärme. Die letzten Tage waren ungewöhnlich warm gewesen. Ein Reiher hob von einem Ast ab, flog lautlos den Fluss entlang. Nach dem Gewitter der vergangenen Nacht waren die Ufersäume geflutet. Der Geruch der Gagelsträucher hing in der Luft. Etwas weiter machte der Fluss eine Schleife.
Ich ließ das Kajak auf eine Sandbank auflaufen, zog es hinter eine große Fichte, balancierte auf einem Baumstamm, der wie ein langer grüner Arm über das Wasser ragte. Der Stamm wippte ein wenig. Ich sprang kopfüber zwischen den Ästen hindurch und schwamm ein paar Züge, die Strömung war schwach, trug mich kaum aus der Bucht hinaus. Ich dachte an Vinzenz, spürte die Freude im Bauch und tauchte unter. Wir kannten alles hier, jede Stelle, an der man schwimmen konnte, die Strudel, die einen nach unten zogen.
Ich trocknete mich ab und ging in den Wald. Die Kuppel des Feuerwachturms reflektierte das Licht. Unwirklich stand der Turm auf der Lichtung, überragte die Baumkronen um ein paar Meter, der Blick von dort oben reichte über den ganzen Wald, über den stillgelegten Flughafen, das Grau der Landebahn und über das Dorf.
Ich schloss die Tür auf, nahm die schmale Wendeltreppe statt der Eisen, die außen am Turm hinaufführten. Am Himmel war keine Wolke mehr zu sehen. Ich öffnete alle Fenster, ließ meine Haare vom Wind trocknen, aus der Ferne drang das Mahlen der Abraumbagger herüber, um dann rasch wieder im Hintergrund zu verwischen.
Ich suchte das Dorf mit dem Fernglas, die Straße war so leer wie der Himmel. Die Rollläden an Vinzenz’ Schlafzimmer waren heruntergelassen. Sein Wagen stand wieder auf dem Hof – nach so langer Zeit. So war es immer. Vinzenz verschwand, kehrte irgendwann zurück und wir nahmen unser gemeinsames Leben wieder auf – für ein paar Monate, bis irgendwo der nächste Auftrag auf ihn wartete. Ich folgte der Landstraße, ich sah die Seen und den Fluss und am Horizont die Silhouetten einiger Höfe und die Felder, die bis an die Kante des Tagebaus reichten. Spargel, Weizen, Roggen, Kappes, das blaue Meer der Zwiebeln.
Ich hielt flüchtig Ausschau nach einer Rauchfahne. Noch bevor der Rauch aufstieg, könne man ihn riechen, hatte Thomas mir erklärt, den Schwelbrand am Boden oder das Kiefernharz. Thomas engagierte sich bei der Feuerwehr. Wenn ich schon so oft hier oben war, sollte ich zumindest ein Gefühl dafür entwickeln: Auf Verwirbelungen in der Luft achten, auf das Knacken, das den Wald erfasst, bevor er richtig brennt.
In der Entfernung sah ich eine Lastwagenkolonne, die lange Rohre zum Tagebau transportierte. Ich setzte mich in den windschiefen Sessel, spürte dem feinen Schwingen des Turms nach. Ich schloss die Augen, lauschte dem Wind.
Gegen acht stieg ich die Treppe wieder hinunter. Ich zog das Kajak ins Wasser. Von der Biegung des Flusses näherte sich ein Kahn. Die Ruder hingen in den Dollen, ließen ihn in der Strömung Pirouetten drehen. Er machte einen Schlenker und rauschte ins Schilf. Ich stieß das Kajak zurück ans Ufer. Mit ein paar Zügen durchschwamm ich den Fluss. Ich hatte keine Mühe, das Boot zu finden, und sah darin einen Mann auf dem Bauch liegen, wie eingeklemmt. Blassgelbes Hemd, dunkelblondes Haar. Seine Hände waren verdreckt. Die Jeans in der Kniekehle aufgerissen. Ich trat näher, und jetzt erst hörte ich ein Röcheln, das fast übertönt wurde vom Fließgeräusch des Flusses. Ich hievte den Mann an den Schultern hoch, fasste an sein Kinn und sah ihm ins Gesicht: Vinzenz.
„Vinzenz, um Himmels willen, was ist passiert?“
„Keine Ahnung.“
„Was machst du hier draußen?“
„Nichts.“
Ich schaute mir seine Hand an. Die Wunde war nicht tief.
„Vielleicht war ich kurz ohnmächtig. Muss mich irgendwo angehauen haben.“
Ich suchte an seinem Kopf nach einer Beule oder einer Wunde, Vinzenz erbrach einen Schwall Wasser.
Ich holte das Kajak. Er nahm hinter mir Platz. Ich paddelte flussaufwärts.
„Bringst du mich nach Hause?“, fragte Vinzenz. Er räusperte sich mehrmals, als hätte er sich verschluckt.
„Ja“, antwortete ich.
„Ich glaub, ich muss mich mal ausruhen.“
Gegen die Strömung zu paddeln, war immer anstrengend, aber an diesem Morgen war es anstrengender als sonst.
Als wir am Hof eintrafen, vertäuten wir das Kajak am Steg und gingen über die Wiese zum Haus. Auf dem Küchentisch standen noch die Butter, der Käse und das Brot. Vinzenz musste alles stehen und liegen gelassen haben. Das war eigentlich nicht seine Art. Ich kochte frischen Kaffee, reinigte und verband seine Hand.
„Ich verschwinde dann mal“, sagte er, und kurz darauf hörte ich ihn drüben im Atelier husten.
Er hätte weniger rauchen sollen. Bis in die Küche roch ich die Farbe, das Terpentin, das Holz, an dem er wohl arbeitete. Alles nur Einbildung, dachte ich.
1988
Bei Vinzenz und mir war bisher alles in ruhigen Bahnen verlaufen, wenn man davon absah, dass Vinzenz sitzen geblieben war und wir nun in eine Klasse gingen. Ausgerechnet am Wandertag in der Zwölften nahm unser Leben Fahrt auf. Meine Erinnerung daran ist ungetrübt, wie auch an die Karwoche, die zumindest mich auf eine unheilvolle Art durchschüttelte – in einem Alter, in dem ich bereits hätte verstanden haben müssen, dass nicht alles nur Spiel ist.
Wir besuchten vor den Osterferien eine Kapelle, in einem Weiler ganz in der Nähe von Kirschrath, unserem Dorf. Vinzenz und ich hatten dort häufig als Ministranten gedient. Wir wussten, dass der Schnitzaltar weit über die Region hinaus bekannt war. Oft war mein Blick auf seinen Flügeln hängen geblieben. Keine Szene hat mich damals mehr fasziniert als die Nacht im Ölgarten, der betende, blutschwitzende Jesus, von Angst überwältigt. Er sah sein Martyrium voraus. Der Bildschnitzer zeigte ihn am Boden, flehend zu Gott: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Er bat seine Freunde Petrus, Jakobus und Johannes, bei ihm zu bleiben, diese Stunden mit ihm
durchzustehen, und fand sie schlafend vor.
Am Morgen waren wir bereits den Fluss entlang zu einer Flachsgrube und einer Wassermühle gewandert. Die Bedeutung des Flachsanbaus und Leinengewerbes für die damalige Zeit sei gar nicht zu überschätzen, hatte unser Klassenlehrer erklärt. Später erzählte Herr Kroll uns auf einer Lichtung auch noch etwas von einer germanischen Versammlungs- und Gerichtsstätte, einem Thingplatz. Aber mehr als dürres Gras und einen niedrigen kreisförmigen Wall hatte ich nicht erkennen können. Als ein paar von uns ihre Butterbrote auspackten, scheuchte Kroll sie auf: „Eine Pause gibt’s, wenn wir die Kapelle besucht haben.“
Den ganzen Tag über schaute ich nach Martha. Ein paar Tage zuvor hatte ich sie zum Reiterhof begleitet und bildete mir etwas darauf ein. Keiner aus unserer Klasse hatte sie bisher reiten sehen. Ihr blondes Haar wippte auf ihrem Hemdkragen, sie saß kerzengerade. Aus einer Laune heraus hatte ich sie gefragt, ob ich mitkommen könne, Pferde interessierten mich schon lange, was glatt gelogen war. Martha hatte das wahrscheinlich geahnt. Aber manchmal war ich auf diese Art mutig. Vinzenz hatte ich nichts davon erzählt.
Gegen Mittag stolperten wir aus dem Wald, überquerten die Straße, lehnten uns an die Ziegelmauer der Kapelle und warteten auf Marthas Vater. Er schloss auf und ging mit unserem Lehrer voraus in den Kirchenraum, die abgestandene Luft verstärkte die allgemeine Müdigkeit nur noch. Herr Wallon war eigentlich Bestatter, hatte aber hier zusätzlich noch einen Hausmeisterjob, und er verbot sofort, dass wir uns in die wertvollen Rokokobänke setzten. Martha stand zwischen Vinzenz und mir, ich konnte den Duft ihres Haares riechen, mir wurde flau im Magen. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Martha tat ein paar Schritte nach vorne, um einen besseren Blick auf das Gemälde des Brüsseler Malers Oliveris Pirotte zu haben, das Herr Kroll uns nahezubringen versuchte. Ihr Vater beobachtete uns und gab Anweisungen.
„Keine Fotos. Das Blitzlicht schadet den Farben. Abstand halten. Berührt bloß nichts.“
„Alles in bester Ordnung, Herr Wallon“, sagte unser Lehrer. „Dafür trage ich Sorge.“
Martha schüttelte immer wieder entnervt den Kopf. Ihr Haar lockte sich im Nacken ein wenig, wenn sie geschwitzt hatte. Aus irgendeinem Grund mochte ich das, ich wollte es berühren, einen Augenblick nur.
Herr Kroll schilderte uns die Begegnung Jesu mit der Ordensstifterin Teresa von Ávila. Er hatte eine Fachkenntnis, die bei uns ins eine Ohr rein- und durchs andere wieder hinausspazierte, außer bei Vinzenz, der wirklich zuhörte. Ich sah, dass Martha nicht wusste, wohin mit ihren Händen, sie rieb und knetete sie, trat von einem Bein aufs andere. Ihr Vater stand mit verschränkten Armen da, nickte immer wieder, und machte einen auf Kenner.
Nach quälenden fünfzehn Minuten traten wir vor den Schnitzaltar, hungrig, durstig, gelangweilt. Kroll erklärte uns die drei großen Altarfelder, der Leidensweg, die Kreuzigung und die Beweinung Christi, er ging auf Details ein, kommentierte Winzigkeiten. Sekunden wurden zu Minuten. All die Zitate, die Namen der Experten. Die dürren Glocken im Türmchen schlugen zwei. Martha drängte nach vorne, ganz nah an den Altar heran. Ich folgte ihr. Wir standen zwischen Herrn Kroll und den Altarfiguren, und nahmen selbst in Augenschein, wovon er sprach: die Himmelfahrt Jesu. Niemand beachtete uns, alle waren längst blind vor Erschöpfung. Martha neigte sich vor, hielt ihre Hände auf dem Rücken verschränkt, spazierte langsam zu dem Flügel mit dem Pfingstbild, blieb stehen, ihre Finger lösten sich, folgten Krolls Worten, strichen über die Pfingstzungen im Himmel. Herr Kroll war bei der Gefangennahme im Ölgarten angelangt. Ich erinnere mich genau. Jetzt waren es meine Finger, die über den Altar glitten, als würde man erst dadurch wirklich erkennen. Dabei tat ich nur, was Martha tat. Natürlich war es strengstens verboten, den Altar anzufassen, darauf hatte Marthas Vater ja mehrfach hingewiesen, doch er konzentrierte sich nur noch auf Kroll. Vielleicht wollte ich mich vor Martha unbeeindruckt zeigen. Vielleicht war ich einfach zu verliebt. Ich hörte, wie Kroll den Judas fast zärtlich „Jesu verirrten Bruder“ nannte. Viele würden ihn verachten. Aber ohne Judas hätten sich die Geschehnisse um Christus und seinen Tod gar nicht abspielen können, ohne ihn wäre es auch nicht zur Auferstehung und zur Himmelfahrt gekommen. „Einer musste der Verräter sein“, hörte ich Kroll sagen. „Darin steckt die ganze Tragik.“
Ich fuhr mit dem Zeigefinger über Judas’ Nase, Stirn, Ohren, fuhr darüber hinweg wie über Blindenschrift, vielleicht war das zu viel, meine Berührung zu stark, plötzlich jedenfalls hörte ich ein leises Knacksen. Martha sprang zur Seite, zu ihren Füßen rollte ein Kopf über die Fliesen, kullerte bis zur vordersten Kirchenbank und blieb liegen. Das Gesicht schimmerte golden, die Bruchstelle im Altarbild trug ein stumpfes Braun. Ich hatte den Judas geköpft. Die ausfasernde Leere am Halsstumpf schrie zum Himmel. Aber niemand schien es zu bemerken. Martha bewegte sich zum Ausgang. Herr Kroll ließ sie gewähren, bis zur Pforte, um sie dann zurückzurufen. „Stopp!“ Alle drehten sich zu ihr um. Und das war der Moment, in dem Vinzenz nach vorne sprang, den Kopf aufhob und unter seinem Pullover verschwinden ließ.
„Habe ich etwas von Pause gesagt?“, fragte Kroll.
Martha schüttelte den Kopf.
„Nein? Dann aber jetzt. Alle nach draußen in die verdiente Pause.“ Herr Kroll klatschte in die Hände und scheuchte uns hinaus. „Und lasst bitte keinen Müll zurück“, rief er uns noch hinterher.
Mein Herz raste. Der Altar hatte den Einmarsch von Napoleons Truppen ins Rheinland überstanden und die Nutzung der Kapelle als Pferdestall. Sogar den Zweiten Weltkrieg. Nicht aber meine Finger. Wir wandten uns zur Tür. Wallon folgte uns und schloss die Kapelle ab.
„Und was machen wir jetzt?“, flüsterte ich Vinzenz zu. „Wir können den doch nicht einfach mitnehmen.“
„Das müssen wir. Kein Wort zu Kroll, erst recht nicht zu Marthas Vater. Verstanden?“
„Und wenn in den nächsten Tagen eine Führung stattfindet, was dann?“
„Wie sollen die denn auf uns kommen?“
„Tu doch nicht so blöd, Kroll wird zu seinem Ausflug befragt werden, und irgendeiner wird mich ins Spiel bringen. Martha und ich standen als Einzige so weit vorne. Du weißt, wie so was läuft. Martha wird er davonkommen lassen, allein schon wegen ihrem Vater. Er gehört hier quasi zum Inventar. Mit dem will Kroll keinen Streit. Und je härter Kroll mich anpackt, umso geringer ist seine Schuld.“
„Welche Schuld?“
„Lehrer sind immer dran, wenn was passiert.“
Wir setzten uns ins Gras zu Martha. Ich reichte ihr meine Cola, und sie leerte die Flasche fast in einem Zug.
Vinzenz holte den Kopf aus der Hosentasche.
„Du hast den mitgenommen?“, stöhnte Martha auf. „Was willst du denn damit? Wirf ihn weg.“
„Ankleben, reparieren, ich krieg das schon hin.“
Vinzenz war geschickt, zu Hause reparierte er fast alles. Rollladenbänder, Fensterrahmen, Türblätter. Vater hatte keine Zeit dazu, er war draußen auf den Obstwiesen, bei seinen Bäumen, bei der Ernte, bei der Auslieferung zu den Märkten, den Hotels, bei den Nachkäufen jenseits der Grenze in den Niederlanden, wo immer noch was zu holen war, wenn bei uns der letzte Apfel, die letzte Birne längst verkauft waren.
„Und wie willst du das machen?“
„Mit Leim, ganz einfach. Zwei kleine Schraubzwingen und dann passt es wieder.“
„Keine Sorge, Martha“, sagte ich. „Vinzenz kriegt das schon hin.“
Die Worte sollten vor allem mich selbst beruhigen. Ohne meinen Bruder wäre ich verloren.
„Hast du den Schlüssel für die Kapelle?“, fragte ich.
„Lass das mal meine Sorge sein.“
Zwei Tage später, zu Beginn der Karwoche, wurde es noch mal kalt. Ein zäher Hochnebel lag über dem Land, und die Amsel in der Tanne neben dem Weiher klang, als wäre ihr das Wetter auf die Stimme geschlagen. Wir fuhren mit dem Rad zu Helmut. Er war Oberministrant und besaß einen Schlüssel zur Kapelle. Vinzenz’ Plan war wacklig. Wir wollten Helmut an seiner Schwachstelle packen. Er war ein Wichtigtuer, versessen darauf, bei allem dabei zu sein. Vor allem aber war Helmut auf seinen Vorteil bedacht.
Wir schellten. Die Mommers bewohnten einen Bungalow aus weißem Ziegelstein. Der Rasen vor dem Haus war kurz gehalten, eine Zwergkiefer der einzige Baum im Vorgarten. Eine große aufgeräumte Ödnis ging von dem Grundstück aus, und als Helmut uns die Tür öffnete, verstärkten die hellen Fliesen im Windfang den Eindruck nur noch.
„Ihr? Wie komme ich zu der Ehre?“
„Wir wollen dich um einen Gefallen bitten“, sagte ich, und wir schoben uns an ihm vorbei in die Diele, die von einem ausgestopften Eberkopf dominiert wurde, der neben einem goldgerahmten Spiegel an der Wand hing.
Helmut folgte uns, führte uns in die Küche mit ihren polierten Chromleisten und gewienerten Arbeitsflächen. Vier Stühle standen an dem großen Glastisch, als wären sie Ausstellungsstücke.
„Also, worum geht’s?“ Helmuts hagere Gestalt spiegelte sich in den bodentiefen Fenstern. Die Küchenuhr tickte.
„Wir wollten fragen, ob wir in der Karwoche die Kapelle putzen können.“
„Ihr? Ihr wollt putzen?“
„Eher entstauben, die Wände, die Ecken, unter den Bänken mal mit dem Feudel wischen. Auch in der Sakristei. Wir haben den Aushang im Pfarrbüro gesehen. Die suchen jemanden.“ Ich konnte immer schon gut lügen.
„Aber doch nicht euch. Eure Eltern verdienen doch.“
„Wir brauchen dringend ein paar Extramark. Unsere Eltern müssen davon nichts wissen.“
„Ihr sitzt in der Scheiße!“
„Kann man so sagen.“ Vinzenz trat nun dicht an Helmut heran. „Es ist was passiert.“
„Geht’s auch genauer?“
„Wir wollen dich da nicht mit reinziehen“, sagte ich.
„Ich werd aber gern mit reingezogen.“
Wir hatten ihn an der Angel.
„Ich habe einen Bock geschossen. Drüben bei Marau, auf dem Reiterhof … habe ich … also einen Sattel versaut, mit irgendeiner Flüssigkeit, aus Versehen. Der Sattel ist hin.“
„Wie viel?“
„Nur wenn’s auffällt, aber es wird ganz sicher auffallen. Meint zumindest Martha, und die jobbt da. Und dann sind’s leicht ein paar hundert Mark.“
Helmut trat einen Schritt zurück. Wir konnten sehen, wie es in ihm arbeitete.
„Du bekommst natürlich deinen Teil, wenn wir den Job kriegen, Helmut“, sagte Vinzenz.
Das musste ihm bekannt vorkommen. Es hieß, sein Vater bekäme satte Bonuszahlungen von der Versicherung. Bei Schadensfällen fand er windige Gründe, Klauseln, die er an den Haaren herbeizog, um Auszahlungen zu verhindern.
„Eine Provision?“
„Du setzt dich im Pfarrbüro für uns ein, schließt uns die Kapelle auf und so weiter, ist eben schon Arbeit für dich.“
„An was denkt ihr da? Ich will euch ja nicht ausnutzen.“
„Ein paar Mark nur. Zehn Prozent sind für dich“, sagte ich.
Wir hatten beschlossen, niedrig anzufangen, um ihn zu ködern, und wollten ihn dann dazu verlocken, mehr zu fordern. Nicht dass er das Geld nötig hatte, aber das Gefühl von Macht schon.
„Zehn Prozent also?“
„Das ist zu wenig, Simon. Helmut soll ja nicht fast leer ausgehen. Ich schlage fünfundzwanzig Prozent vor. Gerecht ist gerecht.“
„Schon“, sagte Helmut. „Aber damit muss es dann auch gut sein. Wie gesagt, ich hätte das nie von euch verlangt.“
„Ist schon in Ordnung. Ruf am besten schnell im Büro an. Wir nehmen den Schlüssel gleich mit“, sagte Vinzenz.
Helmut zögerte. Draußen fuhr ein Wagen vor.
„Helmut, bitte. Tempo.“
„Na gut, weil ihr es seid.“
Er ging in die Diele zum Telefon. Als sich der Schlüssel im Schloss drehte, hatten wir den Job.
„Aha, Besuch“, sagte Helmuts Vater und kam zur Tür herein. Er hängte seinen beigen Trenchcoat an der Garderobe auf, trat an den Spiegel, strich sich übers Haar. „Die beiden Brougen. Lange nicht gesehen. Wie geht’s den Eltern?“
„Gut“, sagte Vinzenz.
„Das hört man gern.“ Er verabschiedete sich in Richtung Küche, sein Aftershave stand in der Luft.
„Den Schlüssel bitte“, flüsterte ich.
Wieder zögerte Helmut. „Ich komme besser mit.“
„Musst du nicht. Stehst nur rum in der Kälte. Da ist nicht geheizt.“
„In drei, vier Stunden bringen wir den Schlüssel zurück“, sagte Vinzenz, „und dann bekommst du dein Geld. Strecken wir vor.“
Helmut trat an ein eichenes Schlüsselbrettchen und fischte den Schlüssel vom Haken.
„Ihr wisst, in welchem Schrank das Putzzeug steht, oder?“
„Klar. Wir sind ja nicht zum ersten Mal dort.“
In der Kapelle stand ein diffuses Nachmittagslicht. Gegenüber im Saal des Gasthauses spielte ein Klavier, ein Chor sang: etwas Schwebendes, Zartes. Ich verschloss die Sakristei von innen und schob zusätzlich den Riegel vor. Vinzenz hatte bereits sein Werkzeug ausgelegt. Er feilte die Bruchstelle an, betupfte sie mit Ponal und setzte den Kopf auf. Er drückte ihn ein, zwei Minuten an, dann setzte er die Schraubzwingen. Es klopfte an der Tür. Vielleicht Martha? Sie hatte am Tag zuvor noch darauf bestanden, mit dazuzukommen. Sie war wegen der ganzen Aktion ziemlich aufgewühlt. Vinzenz war dagegen gewesen, ich aber hatte zugestimmt. Jede Nähe zu ihr war mir recht.
„Wenn mein Vater mitbekommt, dass ich dabei war, rastet er aus, auch wenn nicht ich …“
„Er wird schon nicht schlimmer sein als andere.“
„Du hast ja keine Ahnung“, hatte sie gesagt. „Seit meine Mutter gestorben ist, würde er mich am liebsten gar nicht mehr rauslassen. Und bei allem, was die Kapelle betrifft, führt er sich sowieso auf. Jeden Abend macht er seine Runde. Bei einem Einbruch in die Kapelle würde bei uns zu Hause die Alarmanlage losgehen. Darauf ist er auch noch stolz.“
Wieder klopfte es, lauter diesmal und dringlicher.
„Macht auf, Jungs!“ Es war Helmut.
„Programmänderung.“ Das war eindeutig Herr Kroll.
Wir fuhren zusammen, packten das Werkzeug ein.
„Einen Moment“, rief ich.
Wir mussten Zeit gewinnen, wenigstens ein paar Minuten. Wir durften die Zwingen noch nicht lösen.
„Wir finden den Schlüssel nicht.“
„Dann beeilt euch mal“, rief Helmut.
Wir ließen ein paar Minuten verstreichen, dann ging Vinzenz zur Tür, steckte umständlich den Schlüssel ins Schloss, zog ihn wieder heraus.
„Verdammt, der klemmt.“
Er versuchte es ein zweites und drittes Mal.
„Seid ihr blind, oder was?“
Als das Schloss aufschnappte, nahm ich die erste Zwinge fort.
Vinzenz schob den Türriegel zurück und schnell wieder vor.
„Ziehen, du Hornochse!“
„Nur die Ruhe, Helmut“, hörte ich Herrn Kroll sagen.
Vinzenz ließ den Riegel zurückfahren, und im selben Moment flog die Tür auf. Ich nahm die zweite Zwinge ab, die verdeckt hatte, was nun nicht mehr zu übersehen war, nämlich, dass an der Bruchstelle Farbe fehlte und Judas eine Halskrause aus stumpfem, angetrocknetem Leim trug. Der Schreck fuhr mir in die Glieder.
„Entschuldige. Ich habe Helmut zu Hause überfallen. Ich muss mir für einen Vortrag noch ein paar Details anschauen“, sagte Herr Kroll.
Ich stürzte in die Sakristei.
„Kommen Sie!“, sagte Helmut und ließ Vinzenz und mich stehen, was vielleicht ganz gut war, denn nun konnten wir die Staubwedel und den Feudel aus dem Schrank holen, was wir bislang völlig vergessen hatten. Wir wischten über das hölzerne Podest, befreiten den Altarfuß von Staubflusen. Herr Kroll redete und redete. Helmut nickte nur. Unsere Blicke gingen zum Judas, und jetzt sah auch Vinzenz das Malheur. Der hervorquellende Leim fiel auf – viel mehr als der fehlende Kopf aufgefallen wäre. Ich hatte gewusst, dass wir nicht so einfach davonkommen würden. Jetzt konnten wir es nur noch hinauszögern.
Helmut und Kroll zwängten sich zwischen den Bänken auf uns zu. Wir hörten die Tür zur Sakristei ein zweites Mal, und plötzlich stand auch Marthas Vater in der Kapelle. Er schüttelte Kroll die Hand und stieg auf die Orgelempore, wo er die Fahne der Schützenbruderschaft von der Wand nahm.
„Das Teil hat Motten“, rief er herunter.
Wir hantierten weiter am Podest, es sollte sehr emsig aussehen, jede Sekunde, die verging, brachte uns der Katastrophe näher. Wieder schoss es mir durch den Kopf: Der Altar war noch nie zerstört worden. Niemand hatte den Heiligen je auch nur einen Kratzer zugefügt. Es würde von allen Seiten Hiebe geben. Vor allem von Marthas Vater. Im ganzen Dorf würde mein Name damit in Verbindung gebracht werden. Ich spürte Krolls Atem im Nacken, Helmuts fleischige Nase näherte sich meinem Ohr. Er war ein Frettchen, er roch meine Angst. Er schob sich zwischen uns. Ich hörte auf zu wischen, wartete, dass er es sah, sein Blick lag auf dem Altar, aber nichts geschah, der Moment dauerte zu lang, und etwas glomm in seinem Blick auf. Vinzenz gab mir einen Stoß. Ich arbeitete weiter.
Herr Wallon stieg von der Empore runter. Er trug die Fahne über der Schulter. Wir bewegten uns nicht vom Fleck. Vinzenz verdeckte den Judas mit dem Staubwedel. Helmut und Kroll zogen weiter zum Chor, zu den Votivtafeln und Holzkrücken, die dort als Dank für überstandenes Unheil aufgehängt worden waren, und Marthas Vater faselte etwas von der Volksfrömmigkeit vergangener Tage und ging nach draußen.
Irgendwann, wir hatten gerade mit den Fensterbänken neben dem Altar begonnen, verließen auch Helmut und Kroll die Kapelle.
„Der kommt wieder“, sagte Vinzenz.
Wir legten die Staubwedel zur Seite. Ich setzte mich erschöpft vor Anspannung in eine Bank.
Lange mussten wir nicht warten.
„Ihr habt mich verarscht“, sagte Helmut ruhig.
Etwas Trauriges lag in seinem Blick und in seiner Stimme, er war wirklich gekränkt, und einen Moment lang tat er mir leid. Er gehörte nicht zu uns und auch zu niemand anderem. Er war in seinem weißen Bungalow allein.
Wieder klopfte es an der Tür. Leise und zaghaft. Diesmal konnte es nur Martha sein. Ich wünschte, sie wäre nicht gekommen. Helmut rannte in die Sakristei und riss die Tür auf.
„Martha?“ Er klang sofort milder.
„Ich wollte nur mal schauen.“
„Soso, schauen? Nach dem Judas?“
„Es war ein Versehen. Simon wollte doch nur …“
„Martha“, schrie ich, aber Helmut hatte genug gehört.
„Du warst das also“, sagte er verblüfft. „Ich hätte es mir denken können.“
Vinzenz schien das alles kaltzulassen. Er hatte stärkere Nerven als ich, immer schon. Er lächelte entspannt, setzte die Schraubzwingen wieder an und sagte über seine Schulter: „Stell dich nicht so an, Helmut. Es kommt wieder alles in Ordnung.“
„Und jetzt wollt ihr einfach so davonkommen, und ich soll einen auf Komplizen machen, oder was? Nicht mit mir, das schwöre ich euch“, brach es aus ihm hervor.
„Tut uns leid, Helmut. Einen Moment haben wir daran gedacht, es dir zu sagen, aber wir wollten dir das alles nicht zumuten.“
Doch womöglich war es genau das, was Helmut sich insgeheim wünschte.
Entsprechend bitter sagte er: „Hinter meinem Rücken. Und ich Idiot muss jetzt nur noch den Mund halten. Aber denkste.“
„Komm schon, Helmut. Lass gut sein“, hätte ich sagen sollen, aber aus irgendeinem Grund sagte ich: „Willst du mehr Provision? Ist es das? Wie dein Alter?“
Helmut drehte sich auf dem Absatz um. Ich rannte ihm hinterher, packte ihn am Kragen. „Sag, was du vorhast?“
„Wirste schon sehen“, sagte er und verschwand.
Diplomatie war nicht mein Geschäft. Vinzenz blickte auf den Judas, dann auf mich und fing an, unsere Sachen einzupacken.
Martha war aus irgendeinem Grund mit der Knopfleiste ihres Hemds beschäftigt, als würde sich dort eine Lösung für unser Problem auftun.
„Ihm gelingt die Gratwanderung, zu berühren, ohne kitschig zu werden oder ins Klischeehafte abzudriften. Das hat viel mit seiner Erzählkunst zu tun.“
„Man darf keine Angst vor Tränen haben, wenn man es liest. Totzdem ist es auch eine wunderbar tröstliche und lebensfrohe Lektüre.“
„Die fein durchkomponierte und unaufgeregt erzählte Geschichte lebt von der präzisen Beobachtung des Autors, wunderbaren Landschaftsbeschreibungen und der Aufrichtigkeit seiner Protagonisten.“
„Achtens Prosa zeichnet sich durch eine poetische Qualität aus, die den Leser in ihren Bann zieht.“
„Ein starkes Stück Prosa, erschütternd und ermutigend zugleich, dem man sich schwerlich entziehen kann.“
„Dieser Roman lebt von einer wunderbaren Sprache voller Schönheit, Präzision und überbordender Fülle eindrucksvoller Bilder.“
„Mit seinem Roman hat Achten nicht nur ein Stück Autobiografie zu Literatur werden lassen, er hat auch den Dörfern des Reviers, die dem Tagebau geopfert wurden, ein Denkmal gesetzt.“
„Brillant leicht geschrieben, und das trotz aller Schwere.“
„›Die Einmaligkeit des Lebens‹ ist ein Buch über den Tod, das vom Leben erzählt – und das auf eine Weise, die anrührt, ohne rührselig zu werden.“







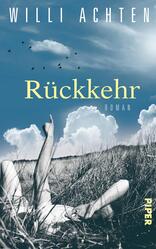










DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.