

Die Eule von Askir. Die komplette Fassung (Das Geheimnis von Askir 6) Die Eule von Askir. Die komplette Fassung (Das Geheimnis von Askir 6) - eBook-Ausgabe
Das Geheimnis von Askir 6
Die Eule von Askir. Die komplette Fassung (Das Geheimnis von Askir 6) — Inhalt
Endlich liegt die Saga um „Die Eule von Askir“ in der ursprünglichen Fassung vor, wie der Autor sie erdacht hatte. In der umfassenden und ungekürzten Form können alle Richard-Schwartz-Fans das Abenteuer ganz neu erleben: Am Hafen der altehrwürdigen Stadt Askir wird ein bestialisch zugerichteter Toter gefunden. Es ist der Botschaftsdiener Jenks, der in diesem zwielichtigen Viertel eigentlich nichts zu suchen hatte. Stabsleutnant Santer wird mit den Ermittlungen betraut, unterstützt durch die faszinierende Magierin Desina. Diese hat die Gabe, die Vergangenheit vor ihren Augen neu erstehen zu lassen. Doch was Desina in der Nacht des Mordes erblickt, bedeutet für ganz Askir eine unberechenbare Bedrohung. Denn der Feind beherrscht schwarze Magie, gegen die alle Mittel Desinas machtlos sind.
Leseprobe zu „Die Eule von Askir. Die komplette Fassung (Das Geheimnis von Askir 6)“
Es ist Nacht in Askir, der Stadt des Ewigen Herrschers. Der ewigen Stadt. Eine dunkle Nacht, mit schweren Wolken verhangen, die beiden Monde verdeckt, als ob selbst die Götter nicht hinsehen wollen.
Es ist ein ungleicher und aussichtsloser Kampf dort unten am Hafen der alten Stadt. Ein Mann, eher dürr denn kräftig, ringt um sein Leben und sein Gegner ist er selbst.
Er ist nicht alleine an diesem Ort. Wird es Nacht, finden sich in den dunklen Löchern die Ratten des Hafens, solche, die das Licht scheuen und dem Schneider dienen, der im Dunklen den Hafen für [...]
Es ist Nacht in Askir, der Stadt des Ewigen Herrschers. Der ewigen Stadt. Eine dunkle Nacht, mit schweren Wolken verhangen, die beiden Monde verdeckt, als ob selbst die Götter nicht hinsehen wollen.
Es ist ein ungleicher und aussichtsloser Kampf dort unten am Hafen der alten Stadt. Ein Mann, eher dürr denn kräftig, ringt um sein Leben und sein Gegner ist er selbst.
Er ist nicht alleine an diesem Ort. Wird es Nacht, finden sich in den dunklen Löchern die Ratten des Hafens, solche, die das Licht scheuen und dem Schneider dienen, der im Dunklen den Hafen für sich fordert. Zwei dieser düsteren Gesellen betrachten staunend den bizarren Kampf des Dieners.
Einen schweren Dolch mit scharfer Klinge hält er fest in seinen klammen Händen, die mit sich selber ringen, es ist ein Dolch wie ihn ein Krieger trägt und nicht ein Diener. Keuchend sinkt der Mann zu Boden. Der dunkle Stoff seiner kostbar bestickten Hose saugt das Wasser der Pfütze auf, in die er fiel.
Die Lippen des Mannes bewegen sich, er hält den Dolch mit beiden Händen, zitternd, aber unerbittlich bewegt sich die Spitze weiter noch voran, sie sucht seinen Hals. Flucht er? Oder ist es ein Gebet? Die Ratten in ihren Löchern sind zu weit entfernt, um es zu hören, sie können nur staunen, als der Dolch sich seinen Weg zum Hals des Mannes bahnt, als die Spitze eindringt und das Blut fließt. Und jetzt, mit einem langen Schnitt von Ohr zu Ohr, löst die Klinge einen Schwall von Blut, der sich über teuren Stoff ergießt. Das Röcheln hört man kaum, nur kurz sieht man die blutigen Blasen, der Dolch fällt. Die zwei Hände umgreifen nun den Hals des Mannes, als ob sie jetzt bewahren wollten, was sie eben noch zerstörten. Langsam fällt er auf den kalten Stein, schlägt hart auf und bleibt liegen, sein Blut nicht minder salzig als das Wasser, mit dem es sich mischt. Einmal zuckt er noch, dann liegt er still.
Wie Aasgetier lauern sie in ihrem dunklen Loch, warten mit verschlagenem Blick darauf, ob der Körper erneut zucken wird. Schon fragt sich der Leichenfledderer, ob ihm die Schuhe dieses Dieners wohl auch passen würden, als der Tote sich erneut bewegt, um mit beiden Händen an seinen Kopf zu greifen und ihn langsam nach hinten zu drehen. Ein schreckliches Knirschen und Knacken ist zu hören, dann erst liegt der Tote wieder still.
Hartgesotten und gebrüht, hat jeder dieser beiden Mordgesellen schon viel gesehen, mehr als andere Augen sehen wollen, doch dieser Anblick schreckt auch sie … So warten sie den Moment noch ab und den nächsten, aber dann, als der eine endlich seinen Mut zu finden scheint, hört er von Norden her schon den Schritt von vielen Sohlen, auch gibt ein Schein von Fackeln den Ratten eine Warnung, zu lange haben sie gezögert, diese Beute ist verloren.
Mit einem Fluch drückt sich der eine in den Schatten, der andere folgt ihm, nur flucht er nicht, er betet.
1. Der Tote im Hafen
Schwertkorporal Fefre empfand den Hafen in dieser Nacht als besonders unheimlich. Die Masten der Schiffe, die hier vertäut waren, bewegten sich leicht in der Dunkelheit, wie ein Wald, durch den ein Wind fährt, dazu kam noch das unheilvolle Knarren von Holz und Seil auf Stein und Metall, das leise Gurgeln des schwarzen Hafenwassers, das nur wenige Schritt von ihm entfernt gegen die steinerne Mole schlug … Ein kalter Wind wehte vom Seetor her und wirbelte den Nebel auf dem Wasser auf und trieb ihn auf die Hafenmauer zu, ließ den Korporal seinen Umhang fester um sich ziehen.
In der Ferne sah Fefre die beiden großen Leuchtfeuer auf den mächtigen Türmen zu beiden Seiten der Hafeneinfahrt, die den Schiffen auch in der dunkelsten Nacht den Weg in den sicheren Hafen wiesen.
Nur, dass es kaum eine Nacht dunkler als diese geben konnte, mit tiefen Wolken, die den Himmel und die beiden Monde verbargen, als ob selbst die Götter nicht sehen wollten, was hier zu seinen Füßen auf den kalten Steinen der Hafenmole lag.
Wie alle Seeschlangen trug auch Fefre ein festes Hemd aus lindgrünem Leinen, dazu ein paar Hosen aus dem gleichen Material, die in weichen, halbhohen, mit Bändern festgeschnürten Lederstiefeln endeten. Anders als die legendären Bullen der Reichsstadt trugen die Seeschlangen, die Marinesoldaten des Alten Reichs, nur eine leichte Panzerung, ein geprägter Brustpanzer aus gehärtetem Leder, mit sechs Wurfdolchen daran, die über dem Herzen mit ihren Klingen einen zusätzlichen Schutz boten. Nur gegen den kalten Wind half es nicht viel. Ein leichtes Rapier auf der linken Seite, ein mit Leder umwickelter schwerer Knüppel auf der rechten, dazu an beiden Armen ein mit Stahl verstärkter Armschutz aus Leder. Ein langer Umhang gehörte noch dazu, wofür Korporal Fefre durchaus dankbar war, denn ohne diesen Umhang hätte er jetzt noch jämmerlicher gefroren, als er es ohnehin schon tat.
Abgesehen von dem Gurgeln des Wassers und dem Knarren der unzähligen Schiffe, war es still hier im Hafen, so still, dass Fefre die Atemzüge seiner Kameraden hören konnte und das Knistern und Zischen der Fackel in seiner Hand laut in seinen Ohren klang.
„Halte die Fackel höher, Fefre“, riss die tiefe Stimme des Stabsleutnants den Korporal aus seinen Gedanken. „Und achte darauf, wohin sie tropft.“ Der Mann, der neben dem Leichnam auf dem kalten Stein der Hafenstraße kniete, war groß und bullig, fast zu groß für die geprägte Lederrüstung einer Seeschlange, deren Schnallen sich kaum um den massiven Brustkorb schließen lassen wollten, mit einem kantigen Gesicht, das wie aus Granit gemeißelt schien, und hellgrauen Augen, die nur selten ihre Ruhe verloren.
Stabsleutnant Sterin Santer war ein Mann, von dem die abenteuerlichsten Geschichten erzählt wurden. Manche von ihnen entsprachen sogar der Wahrheit. Wie die, dass er sich einmal vor Jahren, als er noch ein junger Rekrut war und es nicht besser wusste, mit einer ganzen Hafenbande angelegt hatte, und er zum Schluss als Einziger noch stand. Eine wahre Legende, das konnte Fefre selbst bestätigen, bis auf das Ende. Denn Santer stand nicht, sondern saß an eine Hauswand gelehnt, die Hand auf einem blutigen Einstich, als Fefre ihn fand.
Legenden gab es viele im Hafen dieser alten Stadt, so auch die von den Seeschlangen, den Meeresungeheuern, die den kaiserlichen Marineinfanteristen ihren Namen liehen, Ungeheuer, die man bei ruhiger See und Vollmond des Nachts tief im Hafenbecken kreisen sah, ein ferner Schimmer tief im Wasser, als ob die Kreaturen Laternen bei sich tragen würden. Im Hafen galt das Wort, dass man sich besser nicht mit Stabsleutnant Santer anlegen solle, ebenso gut könne man auch gleich mit den Seeschlangen um die Wette schwimmen.
Der Mann, der hier zu ihren Füßen lag, war niemand, der sich des Nachts hier hätte aufhalten sollen. Im Leben war er groß und schlank gewesen, fast schon dürr, und er trug die reich bestickte Livree eines vornehmen Dieners, jetzt, im Tod, war sein Gesicht eine Fratze, die Fefre nur ungern in seinen Träumen wiedersehen wollte.
„Na, Fefre, bist du noch immer sicher, dass es eine gute Idee war, den beiden Bullen Seife ins Bier zu werfen?“, fragte Santer, während er mit spitzen Fingern dem Toten eine blutige silberne Kette aus dem Kragen nestelte.
„Nun“, antwortete Fefre drollig. „So dreckig, wie deren Mundwerk war, konnte ich einfach nicht anders!“ Ein paar der anderen Seeschlangen lachten, auch sie hatten von dem Streich gehört, den Fefre den Bullen gespielt hatte.
Santer lächelte in der Dunkelheit, als er einen der anderen Soldaten Fefre fragen hörte, was denn genau gestern Nacht in der Dunklen Laterne geschehen war. Die Antwort des Korporals ließ neues Gelächter folgen. Fefre und er waren vor elf langen Jahren zusammen zu den Seeschlangen gegangen. Von Anfang an waren die Bullen, die schwere Infanterie der Reichsstadt, Ziel von Fefres Schabernack und Späßen gewesen, was sicherlich dazu beigetragen hatte, dass Fefre immer noch nur ein Schwertkorporal war.
Jetzt war Santer das Gelächter, das der Korporal mit seiner drolligen Art herbeiführte, nur allzu recht, denn es war nicht gut für einen Soldaten, in einer schwarzen Nacht wortlos auf einen Toten zu starren und dunklen Gedanken nachzuhängen.
Endlich gelang es Santer, den Verschluss der Kette zu lösen. Das Lächeln erstarb ihm auf den Lippen, als er erkannte, was er hier in den Händen hielt.
Er fluchte leise und sah zu dem Korporal hoch. „Götter!“, sagte er. „Das wird eine lange Nacht, Fefre. Dafür bist du mir was schuldig.“
„Warum?“, fragte Fefre neugierig. Wortlos hielt Santer ihm den Anhänger hin, den er bei dem Toten gefunden hatte.
Fefre pfiff durch die Zähne, als er das Symbol erkannte.
„Vielleicht schicken sie uns die Eule“, sagte er und grinste breit. „Das wäre doch mal etwas! Das dürfte sie wohl interessieren!“
„Eine Eule? Es gibt wieder eine Eule?“, fragte Santer überrascht. Er musste sich wohl verhört haben. Seit fast siebenhundert Jahren hatte es keine Eulen mehr in Askir gegeben! „Wir haben wieder einen ausgebildeten Maestro? Jemand, der den Eid geschworen hat und in den Künsten der Magie ausgebildet ist? So jemanden?“
„Genau“, grinste Fefre. „Auch wenn ich nicht einmal weiß, von welchem Eid du sprichst!“
„Es ist ein ganz besonderer Eid“, antwortete Santer abwesend, während sich seine Gedanken überschlugen. „Ein Eid, der magisch bindet, ein Eid, der verlangt, dass man sein ganzes Leben dem Reich und seinen Bürgern widmen wird. Ein Eid, der nicht gebrochen werden kann. Er ist ewig, und es heißt, er bindet sogar über den Tod hinaus. Ich dachte immer, es muss ein besonders mutiger und entschlossener Mann sein, der diesen Eid schwört …“ Er schüttelte den Kopf. „Woher kommt dieser Maestro? Wieso habe ich noch nie von ihm gehört?“
Fefre lachte. „Es ist kein Mann. Es ist eine junge Frau, gerade mal zwei Dutzend Jahre alt. Dass kaum jemand
von ihr weiß, ist kein Wunder. Sie hat die letzten Jahre im Turm der Eulen verbracht, eingeschlossen in diesen weißen Mauern, wo sie nichts anderes tat, als die alten Bücher zu studieren, die dort verwahrt werden. Über zehn Jahre hat sie dort verbracht.“
„Und woher willst du das alles wissen?“, fragte Santer ungläubig.
„Da gibt es diese Schenkmagd, die in der Silbernen Schlange arbeitet. Sie sagte mir, sie habe sie schon selbst gesehen!“ Fefre sah ihn mit strahlenden Augen an. „Ich wette, sie schicken
uns die Eule!“
Santer schüttelte lächelnd den Kopf.
„Ich denke, du willst mich auf den Arm nehmen. Gut. Ich wette zwei Silber, dass sie uns keine Eule schicken.“
„Die Wette gilt, ich kann das Silber gut gebrauchen, wenn du es schon zu verschenken gedenkst.“
„Wenn sie uns die Eule schicken!“, sagte Santer erheitert. „Und jetzt, Korporal Fefre, wirst du das Signal zur Hafenwacht durchgeben.“ Er wies auf einen nahen Holzstapel. „Dort oben wird man die Fackeln von der Wacht aus gut sehen.“
Fefre warf einen skeptischen Blick auf den Stapel, der feucht und rutschig aussah und sich hochtürmte.
„Warum ich?“, fragte er.
„Warum nicht?“, grinste Santer. „Und jetzt hinauf mit dir, Korporal!“
2. Stabsobrist Orikes
Es war gut eine Kerze nach der letzten Glocke, als ein Lanzensergeant der Federn die breite Treppe vom Dach der Zitadelle heruntereilte, wo sich die Signalmasten befanden.
Er hoffte nur, dass der Schwertobrist noch nicht zu Bett gegangen war. Am nächsten Treppenabsatz standen vor einer schweren, reich verzierten Tür zwei Soldaten der fünften Bulle, deren Aufgabe es war, die Zitadelle zu schützen.
„Was gibt es, Sergeant?“, fragte der eine, während der andere schon die schwere Tür aufzog, ohne auf die Antwort zu warten. Er kannte den Mann, und es konnte nur einen Grund geben, weshalb dieser die Treppe heruntereilte.
„Nachricht für Stabsobrist Orikes, Ser“, antwortete der Sergeant hastig und eilte weiter, noch bevor sich die schwere Tür ganz geöffnet hatte.
Es war die sechste Tür auf der rechten Seite, eines der besseren Quartiere, zum Innenhof der Zitadelle hin gelegen, aber schließlich war Stabsobrist Orikes der Obrist der Federn, nur dem Lord Kommandanten selbst unterstellt und der höchste Vorgesetzte des Sergeanten, der nun tief Luft holte und klopfte. Zumindest, stellte der Mann erleichtert fest, gab es einen Lichtschein unter der Tür.
Fast war es, als ob der Obrist ihn erwartet hätte, so schnell öffnete sich die Tür.
„Was gibt es, Lanzensergeant“, fragte der Obrist freundlich. Er sah kaum aus, als ob er bereit wäre, zu Bett zu gehen. Mit seiner dunklen Tunika und der grauen Hose, den blank polierten Stiefeln und dem grauen Gürtel mit der Tasche, die das Wahrzeichen der Federn war, sah er aus, als ob er sofort eine Parade abnehmen könnte.
Orikes mochte vielleicht Mitte fünfzig sein, aber er war noch immer außerordentlich gut in Form, kein Wunder, dachte der Lanzensergeant. Schließlich trugen auch die Federn schwere Plattenrüstungen, und der Obrist hatte die seine über drei Dutzend Jahre lang getragen.
Stabsobrist Orikes war knapp über fünf Fuß groß, besaß kurze graue Haare und auffallend buschige graue Augenbrauen, unter denen ein paar blassgraue Augen den Lanzensergeant neugierig musterten. Es war ein freundliches Gesicht, ein Gesicht, das eher zu einem Priester gehörte, als zu einem Soldaten, auch wenn er eine Feder war.
„Signal von der Hafenwacht, Ser“, antwortete der Sergeant und salutierte, bevor er dem Obristen ein kleines Schreibbrett aushändigte, das mit einer eingehakten Lederklappe vor Wetter und allzu neugierigen Blicken geschützt war.
Der Obrist klappte das Deckleder zurück, las die Nachricht und runzelte die Stirn.
„Wartet hier“, sagte er zu dem Lanzensergeanten, der nicht im Traum daran gedacht hätte, einfach so zu gehen, und trat zur Seite an ein Schreibpult und tauchte seine Feder in das stets bereitstehende Tintenfass. Schnell schrieb er ein paar Zeilen und reichte dann das abgedeckte Schreibbrett an den Lanzensergeanten zurück. „Lasst dies zum Ständetor durchgeben. Sie sollen einen Läufer zur aldanischen Botschaft schicken. Danke, Sergeant.“
„Aye, Ser!“, antwortete dieser, salutierte erneut und eilte davon. Orikes sah ihm nach und schmunzelte. Er konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie er sich gefühlt hatte, als er zum ersten Male seinem obersten Vorgesetzten gegenübergestanden hatte … dafür hatte sich dieser Mann bewundernswert gehalten. Ihm war damals vor Nervosität das Schreibbrett aus der Hand gefallen!
Langsam schloss er die Tür, lehnte sich von innen gegen das Türblatt und das Schmunzeln verging. Nach Jahrhunderten gab es endlich wieder eine Eule in Askir … und obwohl er selbst wusste, wie viel harte Arbeit es gebraucht hatte, und obwohl sie ihn selbst darum gebeten hatte, zögerte er.
Er konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie er Desina das erste Mal gesehen hatte, ein kleines Mädchen mit
feuerroten kurzen Haaren, Sommersprossen, und einem trotzigen Gesichtsausdruck. „Der da“, sagte sie und deutete mit dem Daumen auf den Lanzenleutnant der Bullen, dessen gepanzerte Hand schwer auf ihrer zierlichen Schulter lag. „Soll mich loslassen! Ich hab nichts getan!“ Und mit diesen Worten hatte sie sich unter der Hand des Bullen weggewunden und ihm vors Schienbein getreten. Unter dem schweren Panzer hatte der Mann wahrscheinlich nicht einmal etwas davon gemerkt, aber auch damals war es ihr wohl schon um das Prinzip gegangen.
Von harten gepanzerten Händen in das große Arbeitszimmer eines Obristen geführt zu werden, und das auch noch in der Zitadelle, dem Herzen Askirs, hatte schon gestandenen Männern die Beine zittern lassen, sie jedoch hatte wenig beeindruckt gewirkt, als sie sich die Schulter rieb und neugierig umsah. Orikes hatte dem Mann ein Zeichen gegeben, dieser war daraufhin zurückgetreten, hatte salutiert, den Raum verlassen und leise die Tür geschlossen.
„Weißt du, wer ich bin?“, hatte Orikes gefragt.
„Ihr müsst eine Feder sein“, meinte sie. „Ihr habt viele Bücher. Wo bekommt man nur so viele Bücher her?“
„Weißt du, was eine Eule ist?“, fragte er sie schmunzelnd.
Sie sah ihn verwundert an. „Natürlich weiß ich das. Ihr meint ja nicht den Vogel. Aber ich habe nichts gestohlen. Die Würste lagen da so herum. Ehrlich“, sagte sie und sah ihn mit großen grünen Augen ganz unschuldig an.
„Du weißt auch von dem Eulentaler?“, fragte Orikes und nahm eine silberne Münze aus einer Schatulle. Er hielt sie hoch, sodass sie die Prägung der Eule sehen konnte.
„Ja“, sagte sie und sah ihn misstrauisch an. „Deshalb ging ich ja in den Turm hinein. Aber da war keine Tür!“
„Genau deshalb hat man dich hergebracht“, lächelte
Orikes und kniete sich vor ihr hin. „Hast du Lust, eine Eule zu sein?“
„Nein!“, rief sie, und griff schneller nach dem Taler, als der Obrist ihn hatte wegziehen können. „Der Taler reicht mir!“
Der Blick in ihren grünen Augen war eine deutliche Warnung davor gewesen, auch nur den Versuch zu wagen, ihr den Taler wieder wegzunehmen.
Es waren Katzenaugen, hatte der Obrist damals gedacht, und das hatte sich auch heute nicht geändert … und auch dieser funkelnde Blick war manchmal noch in ihnen zu sehen. Vor allem, wenn sie ihn daran erinnerte, dass sie kein kleines Mädchen mehr war.
Also, gut. Es war ein wichtiger Fall … und vielleicht genau das Richtige für sie. Er zog an einem Klingelzug an der Wand, und nur wenige Augenblicke später stand ein Läufer der
Federn vor seiner Tür und salutierte.
„Eine Nachricht für die Maestra vom Turm …“, begann Orikes.
3. Desina, Maestra vom Turm und Prima der Eulen
Eulen jagen in der Nacht. Auch Desina, Maestra vom Turm und die Prima der Eulen, war auf der Jagd, nur jagte sie keine Mäuse. Sie war weit Wertvollerem als Nagetieren auf der Fährte. Wissen. Wissen, das seit Jahrhunderten verloren war.
Gut ein halbes Dutzend schwerer Folianten lagen aufgeschlagen auf den großen Lesetischen im Lesesaal im ersten Stock des Turms, und diesmal war sie sich fast sicher, dass sie sich auf der richtigen Spur befand. Das alte Buch, das vor ihr lag, enthielt die Pläne der großen Schmiede am Arsenalplatz, wenn es überhaupt möglich war, nach all den langen Jahren das zu finden, was Gildemeister Oldin von ihr wissen wollte, dann in diesen alten Texten.
Geistesabwesend schob sie mit einer Fingerspitze ein kleines Licht zur Seite, das schräg hinter ihr über ihrem Kopf schwebte. Die verblasste Schrift war anstrengend zu lesen, und so fiel nicht ihr eigener Schatten auf das vergilbte Papier.
Dunkel war es nicht in diesem Saal. Über vier eisernen Schalen, die in silbernen Ketten von der hohen, hell getäfelten Decke hingen, schwebten kopfgroße Kugeln, die den großen Raum in ein gleichmäßiges, milchig weißes Licht tauchten.
Überall in der Stadt, vor allem entlang der großen Ausfallstraßen, die die Zitadelle mit den Außenbezirken der riesigen Stadt verbanden, gab es noch immer die steinernen Obelisken, die an ihren Spitzen schmiedeeiserne Körbe trugen. Einst, so hieß es, schwebten über diesen Körben gläserne Kugeln von gut einem Schritt Durchmesser, die in der Nacht von diesen Körben aufstiegen und Licht spendeten. Die meisten dieser gläsernen Kugeln waren schon lange verschwunden, heruntergefallen und zersplittert, nur hier und da gab es noch eine, die ruhig und still in ihrem eisernen Korb lag. Doch geleuchtet hatten sie schon lange nicht mehr.
Nur hier im Turm der Maestros, im Eulenturm, wie man ihn landläufig nannte, wirkte noch die alte Magie … und Desina war dankbar dafür. Ohne diese magisch leuchtenden Globen hätte sie schon Hunderte von Kerzen verbraucht. Das Licht aber, das sie eben so gedankenverloren zur Seite geschoben hatte, war ihr eigenes. Und noch vor wenigen Wochen wäre es ihr nicht möglich gewesen, es zu erzeugen.
Einst floss der Weltenstrom durch diese Stadt, ein mächtiger Strom der Magie, doch dann, plötzlich, vor über sieben Jahrhunderten, war der mächtige Strom versiegt. Jetzt war nur mehr ein Rinnsal von dem übrig, was einst die mächtigen Werke Askannons, des Ewigen Herrschers, und seiner Baumeister angetrieben hatte.
Manche der alten Magien, einst gewirkt und in Stein und Stahl, Glas und Gold verankert, hatten die Zeiten überdauert, andere verbrauchten sich, wie diese gläsernen Globen, die nach und nach herabsanken, bis sie ausgebrannt und leer in ihren eisernen Körben lagen oder herabstürzten und zersplitterten.
Doch vor fünf Wochen war überraschend der Weltenstrom zur Reichsstadt zurückgekehrt, und jetzt regten sich hier und da die alten Magien wieder. Was geschehen war und wie, das vermochte sich auch Desina nicht zu erklären, und doch es war so … und so war es ihr auch endlich möglich gewesen, die dritte Prüfung des Wissens zu bestehen, an der sie so lange verzweifelt war, eben jene Prüfung, die ihr das Recht gab, die blaue Robe einer Maestra des Turms zu tragen.
In der alten Schmiede drüben am Arsenalplatz gab es ein großes Rad, das einst mächtige Walzstraßen und Hämmerwerke angetrieben hatte.
Sie hatte es selbst ausgiebig studiert, ein riesiges Rad, hoch wie ein Haus, kunstvoll aus Stahl, Kupfer und Gold geschmiedet, gut fünfunddreißig Schritt im Durchmesser und gute sechs Schritt breit, so schwer, dass es kaum vorstellbar war, wie es einst errichtet wurde, oder wie es gar möglich war, es mit seinen Lagerzapfen in den gewaltigen Rahmen aus Stahl einzuhängen, der es heute noch trug. Mit einem komplizierten Werk von breiten Lederriemen und Rädern und Stangen, die noch immer überall unter der Decke der alten Schmiede hingen, hatte dieses Rad einst die mächtigen Blasebälge, Hämmerwerke und Walzstraßen bedient.
Doch seit Jahrhunderten hatte es sich nicht mehr bewegt. Jetzt waren es Ochsen, die tagein, tagaus auf riesigen Tretmühlen die Bänder antrieben … und doch nur einen Teil der alten Werke bedienen konnten.
Jahrhundertelang hatte man sich damit abgefunden, doch jetzt, wo die Magie wieder floss, hier und da vereinzelt sogar die Globen auf den Obelisken emporstiegen, um die Straßen mit ihrem sanften Licht zu füllen, hatte Oldin, Gildemeister der Schmiede, Desina gebeten, herauszufinden, ob es nicht doch möglich wäre, dieses alte Rad wieder in Bewegung zu setzen.
Sie las weiter, las von den Fundamenten, einem mächtigen Kristall, der in den Tiefen der Schmiede eingesetzt worden war. Ein Gedanke kam ihr, eine Idee … Sie hatte von diesen Kristallen schon in alten Texten gelesen … wo nur hatte es gestanden? Sie spürte, dass sie nahe daran war, das Rätsel zu lüften …
Die Glocke läutete neben ihrem Ohr und ließ sie zusammenzucken!
Seit zwölf Jahren schon studierte sie die Magie der Eulen,
manches verstand sie mittlerweile, das meiste blieb ihr noch immer verborgen, darunter eine besondere Eigenart des Turms. Zog man unten, neben dem Eingang, an der Glockenstange, läutete die Glocke dort, wo sie sich gerade in diesem Moment befand.
Sechsunddreißig Zimmer hatte sie zur Auswahl, unzählige Räume und Gänge, aber egal wo sie sich befand, und war es auch in den tiefsten Katakomben des Turms … immer läutete diese Glocke einen Schritt von ihrem Ohr entfernt!
Vor knapp drei Jahren hatte sie ihr jetziges Zimmer für sich auserkoren, es war das Größte von allen und besaß sogar ein eigenes, sich magisch erhitzendes Bad. Es hatte dem letzten Primus der Eulen gehört und insgeheim hatte sie sich erhofft, dass wenigstens diese Räume vor der Glocke Schonung fanden, aber nein, sie läutete auch dort. Es war dieser Klang, der sie jetzt aus ihren Gedanken riss, ein hell tönender Glockenschlag, einen Schritt von ihrem Ohr entfernt, ein Läuten, das ihre Gedanken mit einem hellen Ton zerfaserte und zugleich das kleine Licht verlöschen ließ. Schwer ließ sie ihren Kopf auf das dicke Buch vor ihr fallen und seufzte. So nahe war sie der Lösung noch nie gewesen! Und wieder, wie schon so oft zuvor, nahm sie sich vor, als Nächstes herauszufinden, wie diese Glocke wirkte und, vor allem, wie sie diese endlich zum Schweigen bringen konnte!
Schon wieder läutete die Glocke! War sie bei der Arbeit, verlor sie oft jedes Gefühl für die Zeit, doch ein Blick aus dem Fenster zeigte ihr nur finsterste Nacht und eine ferne Laterne irgendwo auf den Zinnen der Zitadelle, es war wohl schon spät. Also folgerte sie, dass es wichtig sein musste, denn jeder wusste, dass man die Maestra nicht leichtfertig stören sollte.
Mittlerweile erhielt sie nicht mehr oft Besuch, die meisten ihrer Lehrmeister wussten, dass sie ihr nicht mehr helfen konnten, sie hatte alles gelernt, was diese sie zu lehren in der Lage gewesen waren, den Rest des Weges musste sie alleine gehen.
Es war Stabsobrist Orikes, den sie am häufigsten sah, mindesten einmal jede Woche erstattete sie ihm persönlich Bericht. Wenn sie etwas herausfand, war es mittlerweile sie selbst, die ein Treffen mit den Handwerksmeistern einberief, um ihnen zu erklären, was sie gefunden hatte.
Also hatte sie meist ihre Ruhe.
Aber jetzt war sie eine Eule, konnte die Robe tragen und trug damit auch die Verpflichtung des Eids. Desina hoffte, dass sie trotzdem nur selten aus ihren Studien gerissen wurde.
Sie eilte nach unten. Für sie existierte diese massive Tür nicht, die ihr von anderen beschrieben wurde. So konnte sie einen Blick auf ihren Besucher werfen, herausfinden, wer der Störenfried war, ohne dass dieser sie wahrnahm.
Es war ein Läufer der Federn, der ein Schreibbrett in den Händen hielt. Sie zog sich die Kapuze ihrer blauen Robe tief ins Gesicht, bis nur noch Mund und Kinn zu sehen war, und trat hinaus.
„Nachricht vom Obristen der Federn“, teilte ihr der Läufer mit und salutierte. Sie nahm das Brett entgegen und löste das Leder. Sie brauchte nicht lange, um zu lesen, was dort stand. Ein erfreutes Lächeln spielte um ihre Lippen, als sie verstand, was diese Nachricht bedeutete. Eine arme Seele hatte dort unten am Hafen ihr Schicksal ereilt, aber für sie bedeutete es, dass Stabsobrist Orikes sie endlich beim Wort nahm.
Jetzt erst war sie wahrlich eine Maestra des Turms!
„Danke, Korporal“, sagte sie und eilte nach oben, um ihr Schwert zu holen, das sie neben ihrem Bett vergessen hatte.







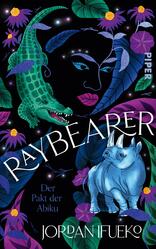













DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.