
Die geilste Lücke im Lebenslauf
6 Jahre Weltreisen
— Der erfolgreiche Reisebericht erstmals im Taschenbuch„Spannend, abenteuerlustig, ehrlich und so mitreißend! Ein Buch, bei dem man am liebsten direkt im Anschluss seine sieben Sachen packen und die Welt erkunden möchte.“ - lisa_zeilenzauber
Die geilste Lücke im Lebenslauf — Inhalt
Runter vom Hamsterrad – raus in die Welt
Der Reisebestseller erstmals im Taschenbuch
In seinem Bürojob läuft Nick Martin das Leben davon. Nach einem Winterurlaub in Neuseeland beschließt er, seinen Job, die Freunde, Sicherheiten und den Alltag in Deutschland zurückzulassen und auf Weltreise zu gehen. Unterwegs in über 70 Ländern lernt Nick mehr fürs Leben als in jeder noch so steilen Karriere: Er wird verhaftet, angeschossen und ausgeraubt, er durchsegelt einen Hurrikan, versucht sich als Schmuggler und verdient ein paar Dollar als Stripper in Las Vegas. Aus einem Jahr werden sechs, aus einer Lücke im Lebenslauf wird ein neuer Lebensinhalt und aus dem jungen Mann aus der fränkischen Provinz ein ganz anderer Mensch.
„Nick Martin ist leidenschaftlicher Abenteurer und Geschichtenerzähler.“ WaveupBlog
Leseprobe zu „Die geilste Lücke im Lebenslauf“
Prolog
El Salvador, 2016
Zwei Schüsse zerreißen den Lärm der Nacht. Ich sitze sofort kerzengerade im Bett, um mich herum Dunkelheit. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und hämmert in meinen Schläfen.
Bleib ruhig: Wo bist du?
Meine Augen suchen in der Dunkelheit umher. Ich sitze auf einem kleinen Bett, in einem winzigen fensterlosen Raum. Direkt vor mir steht eine Kommode, darauf liegt mein Backpack.
O Gott, waren das Schüsse?
Konzentrier dich. Schließ die Augen: Wo genau bist du?
Du bist in El Salvador, bei Borkman, in seinem Zimmer. Hinter dem Vorhang liegt [...]
Prolog
El Salvador, 2016
Zwei Schüsse zerreißen den Lärm der Nacht. Ich sitze sofort kerzengerade im Bett, um mich herum Dunkelheit. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und hämmert in meinen Schläfen.
Bleib ruhig: Wo bist du?
Meine Augen suchen in der Dunkelheit umher. Ich sitze auf einem kleinen Bett, in einem winzigen fensterlosen Raum. Direkt vor mir steht eine Kommode, darauf liegt mein Backpack.
O Gott, waren das Schüsse?
Konzentrier dich. Schließ die Augen: Wo genau bist du?
Du bist in El Salvador, bei Borkman, in seinem Zimmer. Hinter dem Vorhang liegt der Rest der Wohnung. Dort schlafen Borkman, seine Mutter und sein Bruder. Sei leise, weck sie nicht, beruhige dich erst mal. Atme langsam ein und aus.
Waren das wirklich Schüsse?
Oder waren es vielleicht einfach Feuerwerkskörper?
Das ist es bestimmt.
Doch ich merke selbst, dass ich nur versuche, mir die Sache schönzureden. Warum sollte gerade jetzt jemand Böller zünden – und dann auch nur zwei? Aber es könnten ja vielleicht doch …? Nein – ich weiß, dass mein Kopf versucht, eine einfache, ungefährliche Erklärung zu finden. Eine, die mir weismacht, dass hier alles in Ordnung ist und dass ich nicht bis zum Hals in einer Gefahrensituation stecke.
Ich sitze auf der Kante des kleinen Bettes, Schweiß steht auf meiner Stirn, läuft langsam meine Schläfen herunter. Mein T-Shirt klebt an meinem Rücken. Ich habe Angst. Ich bewege mich nicht und höre in die Stille des Raums. In den Lärm draußen.
Es ist der Lärm von Soyapango, District 13, San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador. Ich bin hier, mitten im Getto, weil ich die Welt bereisen wollte, Abenteuer erleben, Menschen und Kulturen kennenlernen. Jetzt, in meiner dritten Nacht, sind draußen Schüsse gefallen. Mein Puls rast noch immer. Ich stütze meine Ellenbogen auf die Knie, lege die Stirn in meine Handflächen. Ich habe wochenlang darauf hingefiebert hierherzukommen.
Aber das? Will ich das?
Ich lausche, ob noch mehr Schüsse fallen. Ob Menschen sich nähern, durch unsere Straße rennen oder sogar in das Haus eindringen, in dem ich bin.
Die Hitze steht unterm Dach. Es ist stickig.
Hey, es wird nichts weiter passieren. Ich bin bei Borkman, er ist Zahnarzt. Wer hat es schon auf einen Zahnarzt abgesehen, der gerade mal 300 Dollar im Monat verdient? Borkman lebt hier schon sein ganzes Leben – und noch viel wichtiger: Er lebt noch!
Um mich herum surrt es. Moskitos überall. Dieses Sirren geht mir auf den Sack. Aber langsam denke ich klarer. Mehr als eine halbe Stunde ist jetzt vergangen, und es gab keine weiteren Schüsse. Ich lege mich langsam auf den Rücken, starre ins Dunkel, atme aus.
Am Morgen erfahre ich, dass es ein 17-jähriger Junge war, der in der Nacht durch zwei Kugeln sein Leben verlor.
Auf meinen Reisen habe ich vieles erlebt – Furchtbares wie in El Salvador, Schönes, Trauriges und Aufregendes. Dinge, die ich irgendwann mit 80 Jahren meinen Enkeln am Kamin erzählen werde. Sie werden sagen: „Opa, erzähl von damals.“ Und ich werde mehr Geschichten haben, als ich ihnen je erzählen könnte. Sie werden trotzdem immer dieselben hören wollen.
„Erzähl noch mal die, als du zum ersten Mal bei Borkman in El Salvador warst.“
Ich werde sagen: „Die bei Borkman? Schon wieder? Na gut, setzt euch hin.“
Dann werde ich ihnen erzählen, wie das alles anfing mit meinen Reisen. Dass ich die ganze Welt entdecken wollte – Berge, Seen, Ozeane. Dass ich den Wind spüren und frei sein wollte. Fremde Gewürze schmecken und andere Kulturen erleben. Wie mich das Fernweh und diese Lust auf das Leben bis nach Mittelamerika führten, in einen fensterlosen Raum, mitten in ein gefährliches Getto, in dem Morde nahezu alltäglich waren. Wie ich dort einen Freund fürs Leben fand, einen Zahnarzt. Wie seine Familie mich mit einer Herzlichkeit aufnahm, die wärmte wie ein Sonnenstrahl. Wie mich das Wissen darum in dieser Nacht beruhigte und mich zurück in einen traumlosen Schlaf fallen ließ.
Ich werde ihnen erzählen, dass die Welt nicht nur schön ist, Reisen nicht nur angenehm, Angst ein bedrohliches, schreckliches Gefühl. Und ich werde ihnen erzählen, dass ich auch genau deswegen gereist bin – selbst wenn ich mich mehr als einmal nach Hause gewünscht habe. Dass es sich trotzdem gelohnt hat. Dass es sich immer lohnt, seinen Horizont zu erweitern und Vertrauen zu haben. Dass man auch in einem fremden Land, in tiefer Nacht und mit einer Furcht, die man nie zuvor gespürt hat, tief in seinem Innern wissen kann: Ich tue echt genau das Richtige.
Und dass einen dieses Wissen den Weg weiterführt.
Die Nacht in El Salvador ist mittlerweile mehr als drei Jahre her. Dennoch erinnere ich mich an fast jede einzelne Sekunde. Extremsituationen wie diese brennen sich einfach in dein Hirn ein wie Brandzeichen. Diese Erfahrung habe ich oft gemacht – in den Jahren vorher, aber auch in den Jahren, die auf dieses Erlebnis folgten. Wenn man so lange die Welt bereist wie ich, hat man unglaublich viele Abenteuer erlebt – gute und schlechte, große und kleine – und genau davon möchte ich euch erzählen. Deshalb beginnen wir doch einfach von vorne …
Kapitel 1
Neuseeland
Zurück auf Anfang
Ich war nach meiner Ausbildung zum Informations- und Telekommunikationskaufmann in eine Festanstellung übernommen worden. Mein Chef hatte irgendwann erkannt, dass ich mehr im Vertrieb als im Kundensupport zu Hause war. Da war ich nun also, ich trug Anzug, fuhr einen schicken Dienstwagen und besuchte Kunden vor Ort: unsere Computersoftware vorzeigen, Demoversionen installieren, Verkäufe abschließen und Provisionen kassieren.
Montag bis Freitag stand ich früh auf, machte mir Kaffee, fuhr mit dem Auto zur Arbeit, rauchte eine Zigarette, arbeitete von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr – und dann fuhr ich wieder nach Hause. Am Wochenende ging ich mit Freunden weg, ins Kino, auf Partys, im Sommer auf Festivals. Sonntagabend machte ich es mir pünktlich um 20:15 Uhr auf meinem schönen roten Sofa vor dem Röhrenfernseher bequem. Am Montag dann alles von vorne. So ging es tagein, tagaus, insgesamt viereinhalb Jahre, unterbrochen von ein- bis zweiwöchigen Urlauben.
Und dann kam Neuseeland.
Genauer: Es kam der März 2009 – und mit ihm die Idee, nach Neuseeland zu reisen. Ich schätze, ich muss niemandem erklären, was März in Deutschland bedeutet: Es dämmert, wenn du aufstehst, und es dämmert, wenn du wieder heimkommst. Zwischendrin leuchtet dich künstliches Bürolicht an, und in den Zigarettenpausen frierst du dir auf dem Balkon den Hintern ab. Was sich gegen Ende des Herbsts andeutet und über den Jahreswechsel richtig schön anstaut, erreicht Anfang März seinen ultimativen Höhepunkt: die Winterdepression. Wir sind alle chronisch untersommert, blass, haben Vitamin-D-Mangel und laufen herum wie Zombies. Hey, ich hatte die Möglichkeit, diesem tristen, grauen, trüben, kalten, extrem ekligen Deutschlandwetter für drei Wochen komplett zu entfliehen. Ich sag’s, wie es ist: Lange überlegen musste ich nicht.
Auf nach Neuseeland
So spazierte ich einige Tage später mit rund 30 Kilo auf dem Rücken aus dem Flughafen in Auckland und knallte mit Karacho in eine Wand aus brennender Sonne. Komplett pale, also ausgeblichen weiß, wie ich war, fühlten sich die 25 Grad Außentemperatur an wie eine Sauna nach drei Aufgüssen: BÄMM!
Ich riss mir sofort meine Klamotten vom Leib, stand am Ende nur noch im T-Shirt da und freute mich wie ein kleines Kind: „Wohoo! Drei Wochen keine Arbeit! Endlich Urlaub! Endlich weg aus diesem Job! Einfach mal herumreisen!“
Mit diesem abgefahren euphorischen Gefühl im Bauch stolperte ich, von der Sonne geblendet, meinem Campervan entgegen – einem alten, komplett bunten Exemplar, das mit jeder Beule „YEEEHAAA!“ in die Welt zu brüllen schien. Ich schmiss meinen Backpack hinten rein, drehte das Radio auf und fuhr los. Ich wollte einfach nur raus aus Auckland, in die Wildnis, in die Natur – Ahnung von Neuseeland hatte ich keine. Ich wusste nur: Es soll verdammt schön sein. Und: Hier wurde Der Herr der Ringe gedreht. Läuft.
Todmüde, aber vollgepumpt mit Endorphinen, fuhr ich Richtung Osten. Mein Ziel sollte eine Halbinsel 55 Kilometer östlich von Auckland sein. Die Coromandel Peninsula ist eigentlich ein lang gezogenes Stückchen Festland, das sich jedoch anfühlt wie eine Insel. Dort sollte ein berühmter Strand sein, der Hot Water Beach. Bei Ebbe laufen die Menschen hier raus und buddeln sich kleine Löcher in den Sand, aus denen plötzlich warmes Thermalwasser nach oben steigt und die selbst gebauten Badewannen füllt – kleine natürliche heiße Quellen.
Das war der Plan. Mit meiner Landkarte auf dem Lenkrad und Oldschool-Hip-Hop aus den Lautsprechern fuhr ich also direkt auf dieses Ziel zu – und dran vorbei. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war, aber ein dampfender Strand kam einfach nirgends in Sicht. Ich hatte keine Lust, weiter Kreise zu drehen, und landete schließlich gut gelaunt an einem anderen Strand. Kurzerhand beschloss ich: Ja, hier will ich übernachten. Ich zuckelte mit dem Van den Kies hinunter, sprang aus dem Auto und sog tief die Luft ein: Meer!
Ein paar Stunden später hatte ich mich in meinem Van eingerichtet und saß mit Klapptisch, Klappstühlen und einer Flasche Rotwein vor der geöffneten Seitentür. Während eines Strandspaziergangs hatte ich nach und nach trockenes Schwemmholz aufgesammelt, das jetzt auf einem Haufen zu meinen Füßen nur darauf wartete, ein knisterndes Lagerfeuer zu werden. Gesagt, getan – und wenn man in Neuseeland mit dem Camper unterwegs ist und anfängt, einen Feuerplatz zu bauen, bleibt man nicht lange alleine. Nach und nach gesellten sich andere Backpacker zu mir. Da waren Leute aus Deutschland, aus Frankreich, aus England, aus Irland. Am Ende reihten wir unsere Vans einfach aneinander und setzten uns alle zusammen um das Lagerfeuer. Ich war im Paradies.
Trotz meiner Müdigkeit war an Schlaf überhaupt nicht zu denken. Ich war so gespannt auf alles, was kommen würde. Gleichzeitig saß ich mit tellergroßen Augen vor den anderen Backpackern und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das waren „echte“ Backpacker, die Dinge sagten wie „Ich bin schon seit drei Monaten unterwegs“ oder „Die letzten sechs Monate bin ich in Asien herumgereist“.
Für mich war es damals total surreal, dass man für so lange Zeit reisen konnte. Ich war, ehrlich gesagt, schon von meinen drei Wochen absolut begeistert. So saßen wir zusammen, und ich lauschte spannenden Geschichten über Kambodscha, den Amazonas in Peru, andere Kulturen, Abenteuer, die ich sonst nur aus Indiana Jones-Filmen kannte, oder über wilde Partys am Strand. Ein französisches Pärchen hatte sogar schon eine komplette Weltreise hinter sich. Während das Lagerfeuer immer weiter schrumpfte, wurde mein Herz immer größer. Vor einem Tag hatte mich noch der graue Himmel in Deutschland angegammelt, jetzt saß ich hier in kurzer Hose und Hoodie neben diesen krassen Menschen am anderen Ende der Welt. Ich hörte das Feuer knistern, die Wellen rauschen, und eine warme Brise wehte mir um die Nase – es war wie ein wahnsinniger Traum.
Das war mein erster Abend in Neuseeland.
Als sich nach und nach alle in ihre Betten verkrochen, saß ich noch eine Weile draußen. Ich trank den Rest des Rotweins und fühlte mich vollgefressen mit Marshmallows und Keksen. Irgendwann legte ich mich dann auch in meinen Van und ließ die Schiebetür einen ganz kleinen Spalt auf. Es war dunkel, hinten durch das Fenster konnte ich den klaren Sternenhimmel sehen, das Meer spielte den Sound der Nacht, und ich war einfach nur glücklich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so völlig ausgeglichen im Moment gelebt hatte. Ich dachte nicht an Arbeit, an Kunden, an Projekte oder ob meine Urlaubsvertretung ihren Job hinbekäme. Das alles war einfach ausgeblendet. Vor mir lagen Abenteuer und unendliche Tage in Neuseeland. Als ich da so lag, hinten im Van, fing ich an, richtig breit zu grinsen.
Und das hörte die nächsten drei Wochen auch nicht mehr auf.
Das französische Pärchen vom Abend zuvor schlenderte am nächsten Morgen in brüllender Hitze an meinem Bus vorbei, begrüßte mich fröhlich und lud mich direkt zum Frühstück ein. Kurze Zeit später saß ich mit einem Kaffee in der Hand am Campingtisch, vor mir einen Crêpe, und fragte typisch deutsch: „Was habt ihr so vor? Was ist euer Plan? Wohin geht’s bei euch als Nächstes?“
„Keine Ahnung“, kam es zurück.
Ich nahm einen Schluck Kaffee und drehte den Kopf in Richtung Meer. „Krass“, dachte ich, „ich hab eigentlich auch keine Ahnung.“
Rückblickend kann ich heute sagen: Ich hatte wirklich so was von überhaupt keine Ahnung.
What is it good for?
Heissluftballon
In dem Moment, am Frühstückstisch, beschloss ich, diese zwei kleinen Wörter der Franzosen zu verinnerlichen, aufzusaugen: „keine Ahnung“. Ich saß dort am Strand auf dem kleinen Campingstuhl, trank meinen Kaffee, schaute auf das Meer – und ließ los. Kein „Ich muss fort, ich muss einpacken, ich muss da und dahin“. Ich lebte in den Tag hinein, genoss das Fehlen von Zeitdruck. Das war der Wahnsinn.
Als ich Lust hatte, fuhr ich die ganze Coromandel Peninsula hinauf, bog dann nach Süden ab und betrachtete die sich im Fünfminutentakt ändernde, fast unwirklich anmutende Landschaft, die aus Meeresbuchten, Wiesen, Bergen und türkisen Bächen bestand. Irgendwann erreichte ich den Lake Taupo, der so ziemlich genau in der Mitte von Neuseelands Nordinsel liegt. Ich stieg in einem Hostel ab und lernte sofort wieder eine Menge Leute kennen – Weltreisende, Work and Traveller, Abenteurer.
Einer von denen schlug vor: „Wie sieht’s aus – Fallschirmspringen?“
Ich dachte: „Alles klar, lass uns Fallschirmspringen!“
Wenig später lief ich in einem roten Sprunganzug über das Rollfeld auf ein kleines Flugzeug zu. Mein Skydiving-Buddy Chris erklärte mir, auf was ich achten müsse. Ich war meganervös, und Chris bemerkte natürlich die unter einer hauchdünnen Schicht Coolness pochende Aufregung.
„Relax einfach, ich mach alles, du genießt nur den Flug!“
Ich dachte nur: „Ja, krass, du steigst jetzt gleich in ein kleines Flugzeug, und es fliegt ganz, ganz hoch, und du springst dann da raus. Bist du eigentlich bescheuert?“
Chris sah meinen Blick, lachte und fing an, diesen 70er-Jahre-Song von Edwin Starr zu singen: „What is it good for? Absolutely nothing!“
Dann hob die Kiste ab. 12 000 Fuß. Hinten im Flugzeuginnenraum drängten sich insgesamt zwölf Leute aneinander. Sechs davon, wir Backpacker, zugegebenermaßen reichlich bleich im Gesicht, die anderen sechs, die Sprungbuddys, hätten entspannter kaum sein können. Und dann blinkte die rote Leuchte im Flugzeug: drei Minuten bis zum Sprung. Ganz ehrlich, ich habe eigentlich keine Höhenangst. Aber dann packte mich Chris, und es hieß: Auf zur Tür! Keine Ahnung, wo mein Magen da mittlerweile war, jedenfalls nicht dort, wo er eigentlich hingehörte. Als ich dann am Flugzeugrand saß – wie ein kleines Känguru an Chris’ Bauch gebunden –, sah ich runter auf die schöne Landschaft, und es war alles einfach nur irre. In der Höhe setzt dein Gefühl für Distanz aus, genau genommen realisierst du gar nicht, wie hoch das alles eigentlich ist. Es sieht aus wie eine Postkarte.
Chris streckte meine Arme aus, verschränkte sie vor meiner Brust, legte seine Hand an meine Stirn und schob meinen Kopf zurück auf seine Schulter.
„What is it good for?“, brüllte er durch den Wind in mein Ohr.
„Ab…abso…absolutely nothing?“, krächzte ich fragend zurück – und dann stürzten wir auch schon dem Abgrund entgegen.
Mein Adrenalinspiegel wiederum schnellte hoch wie dieses Metallding beim „Hau den Lukas“ auf dem Jahrmarkt. PÄNG!
Ich lebte für diese knappe Minute freien Fall. Sollte irgendjemand jemals Probleme haben, ins Hier und Jetzt zu kommen: Echt, spring Fallschirm! Ein bisschen Sorge hatte ich noch vor dem Moment, an dem Chris die Leine ziehen würde. Doch anstatt eines wirbelsäulenzerschmetternden Rucks glitten wir einfach so in einen sanften Abflug. Mein Körper fühlte sich an wie unter Starkstrom, gleichzeitig war mein Kopf völlig frei. Grinsend segelte ich mit Blick auf diesen wahnsinnig blauen See dem Boden entgegen. Kaum unten angekommen, platzte es auch schon aus mir heraus: „Noch mal!“
Die Südinsel
Unbedingt sehen wollte ich den berühmten Franz Josef Glacier, einen ungefähr zehn Kilometer langen Gletscher im Westland-Nationalpark. Ich wollte eine Gletschertour machen, vielleicht auch einen Helikopterrundflug buchen. Ziemlich schnell fand ich jedoch heraus, dass ich nicht als Einziger auf diese Idee gekommen war. Auf den Parkplätzen vor dem Gletscher stapelten sich die Campervans. Auf Touristengruppen und Massenwanderungen hatte ich absolut keine Lust, also schoss ich ein paar Bilder und setzte mich wieder in den Van.
Ungefähr 25 Kilometer weiter südlich wurde ich für meine Entscheidung mit dem Fox Glacier belohnt. Hier fand ich ein traumhaft schönes Hostel samt Whirlpool und setzte mein Franz-Josef-Vorhaben trotzdem um – nur eben am Fox-Gletscher. Am nächsten Tag stand ich um acht Uhr morgens bereit und bekam zunächst Spikes an die Wanderschuhe gebunden. Dann ging die Gletschertour los. Unser Guide schlug mit einem Eispickel kleine Treppenstufen ins gefrorene Wasser, und ich bestaunte die kristallklaren, fast türkisen Eiswände. An einer ungefähr zwei bis drei Meter hohen Gletscherwand probierten wir uns im Freeclimbing. Ich kam höchstens eineinhalb Meter hoch – dann hatte ich Angst, trotz Spikes abzurutschen und mir alle Knochen zu brechen. Wie in Cliffhanger kam ich mir trotzdem vor. Den ganzen Tag wanderten wir, während unser Guide uns eine Menge spannender Dinge über den Gletscher erzählte. Einen Tag später setzte ich auch noch die Idee mit dem Helikopterflug um und klebte mit der Nase an der Scheibe, während der Pilot auf verschiedene Drehorte von Der Herr der Ringe zeigte.
Ich könnte stundenlang von den unendlichen drei Wochen in Neuseeland erzählen – von der Landschaft, den Menschen, meinen Abenteuern und Gedanken. Zusammengefasst waren diese drei Wochen am anderen Ende der Welt ein absoluter Traum. Aus dem es aber langsam aufzuwachen hieß.
Honey-Mustard-Nudeln und Aal
Ich starrte auf den Topf, in dem mein Nudelwasser langsam zu blubbern anfing, und dachte an all die Eindrücke der letzten Wochen. Ich dachte an die schöne Zeit, die ich im Hier und Jetzt verbracht hatte und in der mein Arbeitsalltag zu Hause nicht vorgekommen war. In mir wallte das Gefühl hoch, dass ich nicht zurück-, sondern in Neuseeland bleiben wollte. Ich fühlte mich elend. Elend war übrigens auch mein Essen: Nudeln mit einer fertigen Honig-Senf-Soße aus dem Glas. Gar nicht mal so lecker.
Neben mir bereitete derweil ein Japaner einen selbst gefangenen Aal zu. Er filetierte ihn und rührte parallel in einer Weißweinsoße – das machte mein Abendessen nicht gerade besser. Er bemerkte meinen angeekelten Blick auf die Nudeln. Dann geschah das, was mir in Neuseeland bereits so oft passiert war: Er lud mich ein, den Aal mit ihm gemeinsam zu essen.
Es war jedes Mal unglaublich schön, wenn wildfremde Menschen mir anboten zu teilen. Nicht, weil sie es mussten oder sich verpflichtet fühlten, sondern einfach, weil sie es wollten. Man kannte sich nicht, aber man fühlte sich verbunden. Dieses Miteinander statt Gegeneinander war etwas, das auch ich mir für immer bewahren wollte, ganz egal, wo mich die Zukunft noch hinführen sollte.
An meinem letzten Abend, an dem mein Herz schon so schwer geworden war, erfuhr ich also erneut, wie anders die Reisenden waren. Alles ist einfach, leicht, open-minded. Ich war das einfach nicht gewohnt aus Deutschland und genoss jede Sekunde. Zu Hause hatte jeder sein eigenes Essen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meins ist meins. Hier war das anders. Egal, aus welcher Ecke der Welt die Menschen kamen, die ich kennenlernte – alle waren offen und hatten eine komplett andere Sicht auf die Welt, eine ganz andere Mentalität. Das hat mir gutgetan. Neuseeland besuchen war, als ob mir jemand die Seele geöffnet und einfach mit einer Taschenlampe mitten hineingeleuchtet hätte. Und dieses Licht, das habe ich so was von aufgesogen und in mir behalten.
Kapitel 2
Auf in die Welt
Alles anders
Es war April, es war kalt – und im Büro herrschte nach wie vor Stress. Keiner von meinen Kollegen hatte Urlaub gehabt, hier hatte sich nichts geändert – in mir drin jedoch alles. Drei Wochen lang hatte man mich aus meinem kleinen Aquarium herausgerissen, ins Meer gesetzt, nur um mich dann wieder einzufangen und zu sagen: „Bitte schön. Weitermachen.“
Meine anfänglich noch vorhaltende Euphorie und diese Motivation, die jeder nach einem Urlaub verspürt, verzogen sich nach und nach. Ich landete wieder in der Alltagsroutine, auf dem roten Sofa vor meinem Röhrenfernseher, spielte FIFA und ging abends ins Bett, nur um am nächsten Tag wieder ins Büro zu fahren. Anzug, Kaffee, Kippe, Auto, Kunden, Verkäufe, Provision. Das Backpacking-Gefühl in mir wurde immer dünner. Doch zu meinem Glück ließ es mich nie ganz los. Neuseeland hatte definitiv etwas in mir verändert, nur wusste ich zunächst nicht, was das war. Ich begann zu grübeln, saß oft einfach da und dachte nach. Mitte Juni führte mein innerer Kampf dann zu einer Erkenntnis: „Nein, Nick, so geht es nicht weiter.“
Ich wollte nicht mehr in diesem Arbeitnehmerleben funktionieren. Ich wollte etwas erleben, reisen, raus, selber jemand sein, der sagen konnte: „Was ich mache? Ich bin gerade auf Weltreise. Wohin als Nächstes? Keine Ahnung.“
Ich schaute auf mein Dasein als IT-Systemkaufmann, damals 22 Jahre alt, mit einem Nettoeinkommen von etwas über 1150 Euro plus Firmenwagen. Mein Karriereplan lag fertig abgesteckt vor mir: nur noch Vertrieb, teure Anzüge, größere Autos, mehr Geld, irgendwann ein eigenes Vertriebsteam, irgendwann Niederlassungsleiter. Vor Neuseeland war meine Vision: Karriere machen und Kohle verdienen. Nach Neuseeland schmeckte das alles irgendwie schal.
„Herr Martin, wo sehen Sie sich im Alter von 45 Jahren?“, fragte ich mich.
„Mmh … alles erreicht, viel Geld, materielle Dinge, ein sozialer Status, bei dem Freunde und Bekannte bewundernd zu mir aufblicken. Ich bin wer und kann mir Dinge leisten.“
Absolut nicht.
Bewunderung von anderen, viel Geld, Dingen hinterherjagen – wozu?
Zuerst sprach ich meine Gedanken gegenüber meinem Kollegen und Ausbilder Antonio aus: „Antonio, ich glaube, ich muss die Welt sehen, ein Sabbatjahr machen.“ Antonio schaute mich lange an. Auf der einen Seite war er total enttäuscht, da er sehr viel Energie in meine Ausbildung gesteckt hatte. Auf der anderen Seite konnte er mich verstehen und bestärkte mich schließlich in meinem Vorhaben. So kam es, dass ich zu Hause an meinem Schreibtisch saß und für meinen Chef ein Schriftstück ausarbeitete: Nick und das Sabbatjahr. Zwei Jahre lang für zwei Drittel des Gehalts arbeiten, das dritte Jahr eine Auszeit nehmen und das zuvor eingesparte Geld ausgezahlt bekommen. Ich hatte unwahrscheinliche Angst, meinem Chef diesen Vorschlag zu unterbreiten – trotzdem saß ich wenige Tage später in unserem tristen Besprechungsraum. Draußen regnete es, drinnen war es kalt, und ich war nervös.
Mein Chef saß mir gegenüber und las mein Papier durch. Ab und zu nickte er, sagte aber lange nichts. Schließlich hob er den Kopf und räusperte sich: „Hör zu, Nick. Wir sind eine kleine Firma, wir haben dich betriebsbedingt ausgebildet, und wir brauchen dich. So, wie du das hier vorschlägst, funktioniert das nicht.“
Mein Herz rutschte mir in die Hose, und ich bekam sofort einen Kloß im Hals.
In meiner Show 6 Jahre Weltreisen – die geilste Lücke im Lebenslauf erzähle ich an dieser Stelle zum Scherz gerne, wie ich auf diese Ansage hin sofort von meinem Stuhl aufsprang, einmal kräftig auf den Boden spuckte und „ICH KÜNDIGE!“ rief.
Die Wirklichkeit sah anders aus: Ich fing umstandslos an zu heulen. Ich, Nick, der gerade noch mit einem coolen Van durch Neuseeland gecruist war, saß meinem Chef gegenüber und flennte. Ich sah meinen Traum davontreiben, das Leben mit 45 vor mir und tat schließlich das Einzige, was ich in dem Moment tun konnte: Ich kündigte tatsächlich.
Jedoch sagte ich das längst nicht so cool, wie ich es gerne gesagt hätte. Mehr so wie ein Häufchen Elend. Denn in mir drin hatte ich ziemlichen Schiss vor meiner eigenen Courage. Ich war immerhin gerade dabei, mein eigenes Sicherheitsnetz zu zerschneiden. Schon in der nächsten Sekunde spielte sich in meinem Kopf ein grausamer Film ab, der in etwa zeigte, wie ich mein Leben in die Tonne trat. Ich hatte Angst, dass ich die falsche Entscheidung traf, es nicht würde rückgängig machen können, und ich fürchtete auch das negative Feedback meines sozialen Umfelds.
„Nick, ich will dir zwei Dinge sagen“, erwiderte mein Chef. „Einmal als Freund und einmal als Arbeitgeber. Als Freund sage ich dir, dass ich es verdammt mutig finde, dass du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Ich wünsche dir dafür alles Gute, und ich hoffe, dass du nicht irgendwann als Obdachloser in der Gosse Chicagos endest.“
Er lächelte mich an. Er meinte es aufrichtig und freundlich.
„Als Chef allerdings muss ich jetzt die Notbremse ziehen. Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir ab sofort kein Geld mehr in dich investieren. Als Chef muss ich hier an die Firma und meine Mitarbeiter denken.“
Zack, saß ich wieder im Kundensupport. Keine Workshops, keine Seminare, kein Auto mehr. Dem kleinen Bruder meines besten Kumpels kaufte ich einen alten Roller ab, und bis Ende des Jahres fuhr ich mit dieser Kiste zur Arbeit. Im Winter fror ich mir dabei ordentlich den Hintern ab. Hatte ich vorher schon wenig Motivation gehabt, nun hatte ich wirklich gar keinen Bock mehr. Aber im Endeffekt war diese letzte Zeit in der Firma gut. Denn sie half mir dabei, meinen Entschluss zu festigen. Der Abschied fiel mir leichter.
Im Dezember lag ein langer, nasser, kalter Herbst hinter mir. Vor mir aber lag eine leuchtende Zukunft. Weltreise. Ja, Mann.
One-Way-Ticket nach Mexiko
Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Ich wusste nur, was ich zurücklassen würde. Das war nicht weniger als mein bisheriges Leben. Dass mir der Abschied schwererfallen würde als gedacht, kam mir noch nicht in den Sinn, als die Silvesterraketen in den Himmel starteten. Auch nicht, als sich alle meine Freunde am 7. Februar im Café Klug in Würzburg versammelten und mich gebührend verabschiedeten. Reichlich angetrunken und mit einem T-Shirt in der Hand, das mein bester Freund mir zum Abschied geschenkt hatte, krabbelte ich im Anschluss zu Hause in mein Bett. Auf dem T-Shirt stand in großer Schrift „Nick goes round the world“. Genau das hatte ich jetzt vor: in 365 Tagen um die Welt. Bevor ich einschlief, meldete sich mundwinkelzuckend mein Neuseeland-Grinsen zurück. Es konnte losgehen.
Am 11. Februar brachte mich meine ganze Familie zum Flughafen. Meine Mutter hatte schon auf der Autofahrt reichlich Tränen vergossen – und auch in meinem Hals bildete sich ein dicker Kloß. Ich bin an sich kein Freund von riesengroßen Abschiedsszenen, aber was soll man machen? Da stand ich dann und kämpfte mal wieder mit den Tränen. Dafür, dass ich bisher Wert darauf gelegt hatte, als echt cooler Typ rüberzukommen, hatte ich neuerdings ganz schön viel Pipi in den Augen. Als dann mein Bruder in seine Tasche griff und mir ein graviertes Zippo-Feuerzeug in die Hand drückte, brachen schließlich alle Dämme. „Lebe deinen Traum“ stand darauf. Ich fiel ihm in die Arme und ließ ihn ewig nicht los. Mein Vater klatschte irgendwann ab, als wäre ich eine besonders begehrte Dame auf einem Ball, bei der die Typen Schlange stehen. Es war einfach nur rührend. Die Hände auf meine Schultern gelegt, schaute mein Vater mir in die Augen und sagte: „Nick, es war schön, dich als den Menschen, der du bist, kennengelernt zu haben. Wenn wir uns wiedersehen, wirst du ein anderer sein.“ Dann reichte er mir die Hand und zog mich für eine innige Umarmung an sich. Zu diesem Zeitpunkt sollte ich noch nicht begreifen, was er damit meinte. Mir standen die Tränen allerdings eh bis unter die Augenbrauen, und mein Kopf war so aufnahmefähig wie ein vollgesogener Schwamm. Was mir von diesem Abschied in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall dieser Gedanke: Wie sehr ich meine Familie doch liebe! Im Alltag übersieht man das Glück oft. Aber was ist es für ein Glück, eine solche Familie zu haben. Ein so festes Band. Auch wenn ich diese drei Menschen jetzt ein ganzes Jahr nicht sehen sollte, niemand war näher an meinem Herzen.
Mit einem Blick zurück machte ich mich auf den Weg zum Security-Check. Meine Familie wollte hinter der Glaswand stehen bleiben, bis ich außer Sichtweite war. Gedankenverloren legte ich meinen Rucksack auf das Band, leerte meine Taschen aus, schnallte den Gürtel ab und wartete, bis mich der gelangweilt dreinblickende Security-Mann durch den Körperscanner winkte. Irgendwie erwartete ich fast, dass das Ding gleich aufgeregt lospiepsen würde – denn konnte es wirklich wahr sein? Ging es jetzt endlich los?
Natürlich nicht.
Der Security-Mann blickte ernst zu mir hoch, forderte einen weiteren Kollegen an, und beide schauten stirnrunzelnd auf ein massives Sicherheitsproblem: mein Zippo-Feuerzeug. „Lebe deinen Traum“ entpuppte sich als „Du kommst hier nicht rein“.
„Das bleibt hier“, meinte Security-Mann A streng und deutete auf ein großes Schild mit Gegenständen, die im Passagierraum verboten waren – wie zum Beispiel mit Benzin gefüllte Feuerzeuge.
Security-Mann B verschränkte die Arme und nickte bestätigend.
„Aber …“, begann ich leise. Meine Tränen, die gerade erst getrocknet waren, machten sich bereit für Runde zwei. Egal, was ich auch vorbrachte von wegen „Abschiedsgeschenk“ und „lange Weltreise“ und „Erinnerung an meinen Bruder“, es war vergebens. Ich machte eine Riesenszene mit sehr viel Weinen. Doch die Gesichter der beiden Security-Männer kannten nur einen Ausdruck: keine Chance.
„Aber das ist doch nur ein Feuerzeug, nichts Gefährliches“, heulte ich weiter.
„Das funktioniert so nicht“, kam es von meinen neuen Feinden.
„Und wenn ich die Schale abnehme – und meinem Bruder den Rest wiedergebe, damit er es aufhebt?“ Mit einer Handbewegung zeigte ich auf meine Familie, welche die ganze Situation hinter der Scheibe sehr bewegt mitverfolgte: Mein Bruder weinte mittlerweile auch wieder. Wir mussten ein Anblick für die Götter sein.
Schließlich ließ sich einer der Security-Männer erweichen, winkte seinem Kollegen zu und öffnete eine Spezialtür. Mein Bruder und ich rannten gleichzeitig los, auf halber Strecke fielen wir uns nahezu verzweifelt in die Arme.
„Ich kann’s nicht mitnehmen!“, schluchzte ich in seine Schulter.
„Ist okay, ist okay, ich bewahre es auf“, heulte er zurück.
Nach einem vernehmlichen Räuspern seitens Security-Mann B lösten wir uns wieder voneinander. Ich musste zurück. Den Rest des Security-Checks brachte ich schniefend hinter mich. Was die Sicherheitsleute dachten, war mir herzlich egal. Schließlich drehte ich mich ein letztes Mal um und winkte meinen drei Menschen zu, wie Jim Carrey in Die Truman Show, als er seine bisherige Welt verlässt: „Guten Tag, guten Abend und gute Nacht!“ Dann war ich weg.
Der Wurm
Mein erstes Ziel in Mexiko war Playa del Carmen, wo ich Spanisch lernen wollte. Mal abgesehen von dem VHS-Kurs, den ich zu Hause belegt hatte, war mir die Sprache noch sehr fern. Aus diesem Grund sah mein Plan vor, für ein paar Wochen an einem Kurs teilzunehmen. Die Schule hatte eine Art Kooperation mit Anwohnern, die Sprachschüler bei sich aufnehmen konnten. Ich landete bei Juanita, meiner mexikanischen Gastmama, die mit ihrem völlig unerzogenen Hundewelpen Rocky in einem großen Haus samt Gästehausanbau wohnte. In Letzterem kam ich unter.
In der Sprachschule traf ich dann auf meine Lehrerin, eine quirlige Mexikanerin namens Issaura. Neben mir bestand meine Klasse aus der Italienerin Martina, Andrea aus Tschechien und einer Schweizerin. Insgesamt gab es in der Sprachschule vier oder fünf Klassen, in denen jeweils unterschiedliche Level Spanisch unterrichtet wurden. Die Sprachschüler kamen zu großen Teilen aus Deutschland und der Schweiz, was mich anfangs ziemlich nervte. In jeder Pause stand man zusammen und redete deutsch. So würde das nichts werden, dachte ich und hängte mich mehr und mehr an Martina. Sie hatte nämlich einen entscheidenden Vorteil, mal abgesehen davon, dass sie supernett und lustig war: Sie sprach kein Wort Englisch. Da ich kein Italienisch beherrschte, blieb uns nichts anderes übrig, als Spanisch zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass sie Spanisch schon viel besser konnte als ich, deshalb lernte ich von ihr eine Menge. Doch gerade anfangs, als ich nur sehr bruchstückhaft und wahllos spanische Wortfetzen aneinanderreihte, hatten wir Schwierigkeiten zu kommunizieren. Dennoch verstanden wir uns prima.
Nahezu jeder Tag der vier Wochen Playa del Carmen verlief nach demselben Schema: verkatert aufstehen, mit Rocky spielen, frühstücken – und fast immer pünktlich um 9 Uhr in der Sprachschule antanzen. Der Unterricht ging bis ungefähr 14 Uhr, unterbrochen von einer halbstündigen Mittagspause gegen 11 Uhr. War man motiviert, buchte man im Anschluss an den Schultag noch eine Einzelstunde. Ich war motiviert. Das bedeutete: Erst gegen 15 Uhr machte ich mich auf den Rückweg zu Juanita, die jeden Tag mit selbst gekochtem mexikanischem Essen auf mich wartete. Danach kümmerte ich mich meist um die Hausaufgaben, die uns Issaura aufs Auge drückte. Manchmal verbrachten wir Sprachschüler die Nachmittage auch am Strand, hörten Musik und genossen einfach das Leben. In jedem Fall trafen wir uns abends zum gemeinsamen Essen. Von dort aus ging es dann in diverse Bars und Clubs.
Playa del Carmen, muss man wissen, ist nämlich eine Partystadt. Für mich, gerade mal 23 Jahre alt, kam das wie gerufen. Was hatte ich Spaß auf der Quinta, der örtlichen Partymeile. Hier bestellte man sich nicht einfach eine Flasche Bier, hier gab es immer nur sehr große Cocktails für sehr wenig Geld. Cuba Libre, Gin Tonic, Whisky Cola, Mojito – für je zwei bis drei Euro pro halben Liter machten wir die Nacht zum Tag und nahmen die Billigfusel-Kopfschmerzen am nächsten Morgen gern in Kauf.
An einem dieser Abende in Playa del Carmen probierte ich zum ersten Mal Mezcal, das Lieblingsgetränk der Mexikaner. Dort ist Mezcal so beliebt, dass es eigens Mezcal-Bars gibt, in denen man auch wirklich nur Mezcal trinkt. Selbst wenn kein Etikett auf einer Mezcal-Flasche klebt, ist sie schnell zu erkennen, denn traditionell schwimmt oft ein Wurm drin. Der Wurm ist eigentlich kein richtiger Wurm, sondern entweder eine Schmetterlingsraupe oder eine Mottenlarve. Beide Insekten sind Parasiten, die sich von der Agavenpflanze ernähren, aus der Mezcal gewonnen wird.
Ich hatte nach und nach auch mexikanische Freunde gefunden, die abends mit uns in „unserer“ Mezcal-Bar saßen. Von ihnen lernte ich die folgende Regel: Wer den letzten Shot aus einer Flasche Mezcal trinkt, muss auch den Wurm essen. Natürlich passierte mir das dann über kurz oder lang auch mal. Das Gute an dieser kleinen Tradition: Am Grund der Flasche angekommen, bist du für gewöhnlich schon so jenseits von Gut und Böse, dass du kein Problem mehr damit hast, Würmer zu essen. Ich kann mich erinnern, dass ich so ein Ding mal gegessen habe – aber wie es schmeckte? Keine Ahnung.
Mexikanisches Streetfood
Als ich endlich den letzten Bissen runtergeschluckt hatte, fragte ich den Mann, was genau ich eigentlich gegessen hätte. Er deutete wieder auf das Schild, offenbar verstand er nicht, dass ich nichts damit anzufangen wusste. Schließlich erklärte er es mir mit Händen und Füßen. Ich muss sagen, dass ich damals sehr froh war, erst nach dem Essen gefragt zu haben. Denn auf meinen Tacos waren zerhäckselte, angebratene und mit Salsasoße gewürzte Augen, Sehnerven und Gehirne von Kühen. „Aha, okay“, sagte ich – und dachte: „Uääääh!!!“ Nie, nie wieder würde ich das essen, so viel stand fest. Auch wenn ich mich seit diesem Moment klüger fühle und möglicherweise besser sehen kann.
An diesem Tag nahm ich mir vor, ab sofort öfter mal nachzufragen, wenn ich etwas nicht weiß. Fragen schadet ja bekanntlich nie. Wer nicht lesen, lernen oder hören will, der muss halt fühlen – beziehungsweise in diesem Fall: schmecken.
Bei Juanita passierte mir so etwas nie. Zwar habe ich bei ihren feurig scharfen Gerichten schon mal meinen halben Wasserhaushalt aus meinem Körper geschwitzt, aber ihr Essen war ausnahmslos großartig. Und das, obwohl wir essenstechnisch gar keinen so guten Start hatten. Ich war gerade erst ein paar Tage in der Sprachschule gewesen, da saß ich zu Hause bei Juanita am Tisch und genoss einmal mehr, was sie mir vorgesetzt hatte. Weil ich ihr zeigen wollte, wie gut ich mit meinem Spanisch vorankam, beschloss ich, ihr in ihrer Muttersprache zu sagen, wie glücklich mich ihr Essen machte. Ich erzählte ihr also, dass ich zu Hause selbst viel kochte und bereits besser sei als meine Mutter. Ich hatte dies eigentlich als Kompliment gemeint, denn als offensichtlich begabter Gourmet hatte meine Freude an ihrem Essen so richtig Gewicht. Doch irgendwas war gewaltig schiefgelaufen. Juanita starrte mich an, schüttelte den Kopf, stand auf und ging in die Küche. Dort schlug sie mit einem gewaltigen Krachen das ganze Essen in die Spüle. Es folgte ein Türenknallen – und für den Rest des Tages bekam ich meine Gastmutter nicht mehr zu Gesicht.
Am nächsten Tag erzählte ich Issaura, was passiert war. Sie hörte sich erst alles in Ruhe an, fing mittendrin an zu grinsen und kippte am Ende vor Lachen vom Stuhl. Ich war immer noch ratlos.
„Nick“, erklärte Issaura mir, „du hast ihr nicht gesagt, dass du besser kochen würdest als deine Mutter.“
„Nicht?“, fragte ich lahm.
„Nein.“ Issaura kicherte weiter. „Genau genommen hast du Juanita ziemlich bestimmt mitgeteilt, dass du sehr viel besser kochst als IHRE Mutter.“
Oha! Das war tatsächlich nicht gerade ein Kompliment – und mir wurde klar, dass man Juanita besser nicht mit Deine-Mutter-Witzen kam. Glücklicherweise konnte ich das Missverständnis wenig später aufklären und mich entschuldigen. Juanita war wieder besänftigt.
Bob Marley
Gestern war mein Abschied in Playa del Carmen gewesen, und ich hatte einen ganz schönen Schädel. Alle waren gekommen: meine Lehrer, die anderen Sprachschüler, Freunde aus dem Ort. Zur Feier des Tages hatte ich für alle gekocht. Es war traurig schön, eine Mischung aus Abschiedsschmerz und Vorfreude. Diese Zwischenstufe nach zu Hause und vor dem Weiterreisen war für mich genau die richtige Entscheidung gewesen. Es gibt ein Sprichwort, das ursprünglich von einem Indianer stammt, der sich nach seiner ersten Eisenbahnfahrt auf den Bahnsteig setzte und seinen verwunderten Begleitern auf ihre fragenden Blicke hin sagte: „Wenn du an einen neuen Ort gelangst, warte. Es braucht Zeit, bis die Seele nachkommt.“ Irgendwie war Playa del Carmen für mich dieser Bahnsteig. Es war eine tolle Zeit – und einige der Menschen, die ich damals kennengelernt habe, sind bis heute meine Freunde.
Das Bremsen des Colectivo riss mich aus meinen Gedanken. Ich öffnete die Augen und linste in die blendende Sonne nach draußen: Wir waren in Tulum angekommen. Der Fahrer gab mir mit einem Zeichen zu verstehen, dass ich hier aussteigen könne. Als sich der Staub des weiterfahrenden Autos legte, sah ich mich um: Ich stand mitten auf einer Straße, die noch etwa drei Kilometer vom Strand entfernt lag. Ich schulterte also meinen Backpack und machte mich auf den Weg. Schon nach kurzer Zeit lief mir der Schweiß aus allen Poren. Die Sonne brannte, der Rucksack wog unglaublich viel, und meine schweren Wanderboots fühlten sich an wie Zementklötze. Wasser hatte ich natürlich auch keines mehr – und obwohl die Strecke nicht allzu lang war, kam mir der Fußmarsch vor wie eine Ewigkeit. Als ich endlich den Strand erreichte und dann den kleinen Zeltplatz, auf dem ich mein Lager aufschlagen wollte, lag meine Zunge wie ein Fremdkörper in meinem Mund.
Der Zeltplatz bestand aus einem kleinen, leer stehenden gemauerten Häuschen sowie einigen Palmen. Nach ungefähr 50 Metern begann ein blendend weißer Pudersandstrand. Auf halbem Weg reckte sich aus einer Düne eine kleine Strandbar hervor, in der den ganzen Tag Bob-Marley-Musik lief. Hier wurde Bier getrunken und Gras geraucht. Gäste gab es an der Bar und auf dem Zeltplatz so gut wie keine, alles war ziemlich verlassen. Ein großer, muskulöser Typ mit einer komplett kaputten – und wie er mir später erzählen sollte: zur Heilung mit Metallschrauben fixierten – Schulter stellte sich mir als Terminator vor. Eigentlich war sein Name Jared, und er kam aus Kanada.
Eine Woche hingen wir zusammen auf diesem verlassenen Fleckchen Erde herum, kletterten auf Palmen, erkundeten Ruinen, aßen fast ausschließlich Kokosnüsse und Papayas, weil wir keinen Bock hatten, zum nächsten Supermarkt zu wandern, und chillten zur Stimme von Bob Marley am Strand.
Die einzige Unterbrechung dieser Zeit bestand darin, dass ich zufällig Andrea aus meiner Sprachschule am Strand wiedertraf. Ihr Mann besaß in Tulum ein Hotel, und zusammen mit ihren Kindern verbrachte sie dort die Woche nach der Sprachschule. Sie lud mich ein, sie zu besuchen – und als ich schließlich den Weg dort hinmarschiert war, stand ich nicht vor irgendeinem kleinen Bed & Breakfast, sondern vor einem Nobelhotel der Extraklasse, in dem eine Nacht mal locker 800 Dollar kostete. Wir verbrachten einen schönen Tag zusammen mit ihrem Mann und ihren Kindern, doch was mir hauptsächlich in Erinnerung blieb, war der Rückweg zum Bob-Marley-Strand.
Ich war gerade losgelaufen, und obwohl es schon Abend wurde, brannte die Sonne noch immer. Wasser hatte ich natürlich wieder nicht dabei, und meine Lust, den ganzen Weg zu Fuß zurückzulegen, hielt sich sehr in Grenzen. Ich war noch nie getrampt, hatte, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Angst davor, dennoch streckte ich meinen Daumen raus. Nur Sekunden später hielt auch schon ein weißer Pick-up. Das hatte ich mir schwerer vorgestellt.
Ich stieg zu einem jung gebliebenen Unternehmer Anfang 40 ins Auto. Dass der nicht gerade am Hungertuch nagte, erfasste ich mit einem Blick auf die Innenausstattung. Schon nach kurzer Zeit hatten wir den üblichen belanglosen Small Talk hinter uns gelassen und befanden uns mitten in einem intensiven Gespräch. Er erzählte mir, dass er im Leben vieles erreicht habe und es ihm wirklich gut gehe.
„Klar, du kannst sagen: Glück gehabt. Ich weiß aber, es ist eine Frage der Einstellung. Du kannst alles negativ betrachten, aber auch in jeder Scheiße positive Seiten sehen. Es kommt immer darauf an, was du willst und was du aus deinem Leben machst“, sagte er.
Ich erzählte ihm, dass ich gekündigt und mich aufgemacht hatte, die Welt zu entdecken – und dass ich verstand, was er mir sagen wollte. Die Fahrt war nicht lang, das Gespräch machte dennoch Eindruck auf mich. Am Zeltplatz angekommen, verabschiedete ich mich deshalb herzlich von ihm und wollte gerade die Autotür zuschlagen, da rief er mich zurück: „Warte mal!“
Ich hielt inne. Er lehnte sich nach vorne, kramte in seinem Handschuhfach, zog seinen Geldbeutel hervor und drückte mir ein paar mexikanische Pesos in die Hand.
„Nick, ich finde es wirklich toll, was du machst. Trink davon ein paar Bier, geht auf meine Rechnung!“
Überrascht bedankte ich mich und blickte ihm noch lange nach, als er die Straße wieder zurückfuhr. Dieses erste Mal Trampen war nur eines von vielen weiteren Erlebnissen, die noch kommen sollten und die mir zeigten, wie weltoffen und freundlich Menschen auf der ganzen Welt sind. Gepolt von negativen Nachrichten und Horrorstorys, war die generelle Freundlichkeit, die mir immer und immer wieder begegnete, komplett neu für mich. Es war, als würde das Reisen mein in Schieflage geratenes Bild von der Menschheit geraderücken. Die Gefahr, die in anderen Ländern lauert, böse Menschen, gefährliche Machenschaften – klar, das war und ist real –, aber in welchem Verhältnis steht das alles zur Wirklichkeit? Obwohl Mexiko zu den gefährlicheren Ländern gehört, erlebte ich hier so viel Herzlichkeit und Freundlichkeit wie selten zuvor in meinem Leben. Das brachte mich zum Nachdenken – und es machte mich gleichzeitig unwahrscheinlich glücklich, zu erfahren, wie freundlich diese Welt eigentlich ist. Das Erlebnis knipste wieder eines dieser Lichter in meiner Seele an, die mein Leben heute so bereichern.
Horrorbusfahrt
Ich wusste nicht, ob es in mir drin unaufhörlich schwankte oder ob es nur an diesem völlig selbstmordgefährdeten Busfahrer lag, der mit so vielen Sachen über den Highway bretterte, dass ich mir regelmäßig das Steißbein oder den Kopf an einer der Spanplattenwände stieß. Mehr als fünf Stunden befand ich mich mittlerweile in diesem verkackten Bus – noch nicht ein einziges Mal hatte er angehalten. Ich sehnte den Stopp herbei, nicht nur, damit ich endlich ein wenig frische Luft schnappen könnte, sondern auch, weil ich erbärmlich fror. In Mexiko gibt es generell nur zwei Temperaturen: wahnsinnig heiß und arschkalt. Draußen – also für mich gerade meilenweit entfernt – war es so warm, dass man locker ein Spiegelei auf einem Stein hätte braten können. Hier drinnen im Bus wunderte es mich, dass mein Atem nicht kondensierte. Oder besser gleich direkt als Eisblock auf den Boden krachte. Mit der Klimaanlage nahm es der Idiot jedenfalls ganz genau. Aber das taten sie hier irgendwie alle.
Als ich sicher war, dass mein Magen-Darm-Trakt einige Minuten Ruhe geben würde, schleppte ich mich zurück auf meinen Platz. Wobei auch das nicht wirklich ein Wort ist, was auf diese Hölle von einem Bus passte, denn Platz gab es hier wirklich so gut wie keinen. Zugegeben, ich bin nicht gerade klein, aber gegen diese Sardinendose auf Rädern konnte die Beinfreiheit in Billig-Airlines als „königlich“ bezeichnet werden. Meine Knie konnte ich nur mit Gewalt zwischen die Sitze pressen – das rechte war mittlerweile verdreht und tat fürchterlich weh.
Mexiko ist ziemlich gut vernetzt mit Bussen. Du kannst im Prinzip jede erdenkliche Strecke, egal, wie lang diese ist, mit einem Linienbus zurücklegen. Das Problem ist nur: Du musst es tatsächlich auch, denn ohne Busse geht hier fast gar nichts. Ich hatte mir also an diesem Nachmittag in San Cristóbal ein Ticket gekauft mit dem Ziel, innerhalb von ungefähr 14 Stunden einmal quer durchs Landesinnere an die Westküste nach Puerto Escondido zu fahren. Weil ich noch etwas Zeit hatte, bevor der Bus losfahren sollte, machte ich einen Abstecher auf den Marktplatz, um etwas zu essen. Im Nachhinein kann man sagen, dass dies mein größter Fehler war. Ich kaufte mir eine Guacamole – und ich weiß noch, dass ich mich ein wenig über den Geschmack wunderte. Es schmeckte irgendwie … anders. Nicht so, wie ich es gewohnt war. Dennoch stopfte ich die komplette Portion in mich rein und machte mich anschließend auf den Weg zur Bushaltestelle.
Nicht lange nachdem der Busfahrer seinen ersten Schnellstart mit quietschenden Reifen hingelegt hatte, fing es also an, in meinem Magen so ein bisschen zu rumoren. Eine Weile konnte ich das noch ignorieren, aber irgendwann ging es nicht mehr. Dann begann meine Odyssee auf diesem winzigen Busklo. Ohne ins Detail zu gehen: Es kam aus allen Öffnungen heraus, und ich fühlte mich wie durch die Mangel gedreht. Im doppelten Sinn, wenn man bedenkt, dass ich bei jeder Kurve durch die Kabine geschleudert wurde. Absolut grün hinter den Ohren, was mexikanische Tiefkühl-Busfahrten anging, trug ich nur T-Shirt, Shorts und Flipflops, fror mir also zusätzlich noch den Hintern ab. Ich wechselte immer wieder zwischen dem engen Sitzplatz und dem winzigen Klo. Innerhalb des Klos wechselte ich vom Sitzen zum Drüberhängen.
Alle meine Klamotten – und von denen hatte ich auf meiner ersten Weltreise ja wirklich genug dabei – lagen derweil gut verstaut im Gepäckraum des Busses. Als der Busfahrer nach sechs Stunden den ersten Stopp einlegte, hatte ich nicht eine Sekunde geschlafen, war geschwächt, mit den Nerven am Ende und fragte zähneklappernd, ob ich kurz an mein Gepäck dürfte. Mit meiner Thermounterwäsche, meinem Hoodie, dicken Socken und richtigen Schuhen ging es mir danach nicht wirklich besser, zumindest aber konnte ich die gefühlten minus 20 Grad aushalten. Mich für eine Busfahrt – so kurz sie auch sein mochte – von meinem kompletten Gepäck zu trennen, das passierte mir in der Folge nie wieder. Doch auch wenn es nicht meine einzige Lebensmittelvergiftung bleiben sollte: Diese blieb für immer die schlimmste, schrecklichste Horrorbusfahrt meines Lebens.
Was hat dich dazu bewogen, dein ganzes Leben umzukrempeln?
Mit einem Urlaub in Neuseeland 2009 hat alles angefangen. Damals hatte ich einen normalen Nine-to-five-Job, normales Gehalt und normalen Tagesablauf. Als ich in meinem Jahresurlaub für drei Wochen Menschen kennengelernt habe, die für mich gefühlt aus diesem Hamsterrad ausgebrochen sind, habe ich angefangen bestimmte Dinge zu hinterfragen. Wirklich "Klick" hat es gemacht, als ich mein damaliges Leben mal vorgespult habe und mich mit fünfzig Jahren noch immer im gleichen Job gesehen habe. Materielle Dinge, Geld und Status schienen mir mehr Angst zu machen, als irgendwann auf mein Leben zurückzuschauen und die Reue zu verspüren, nie meine Träume gelebt zu haben.
Was bedeutet Reisen für dich?
Mein Leben nach meinen eigenen Regeln zu spielen. Meine Neugierde auszuleben, das innere Kind auf dieser riesengroßen Spielwiese austoben zu lassen und dabei meinen eigenen Horizont zu erweitern. Jeden Tag etwas Neues lernen, mich selber immer wieder vor Herausforderungen zu stellen und "im Moment" zu leben. Meine Zeit wirklich für mich sinnvoll zu nutzen. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Dankbarkeit kommen dann automatisch dazu.
Was war deine eindrücklichste Erfahrung während der sechs Jahre auf Reisen?
Da gibt es wirklich viele Erfahrungen. Speziell auf meiner ersten Reise habe ich viele Dinge sehr eindrücklich erlebt – da ich vieles zum ersten Mal erlebte. Ob eine Konversation auf Spanisch, eine Nacht unter freiem Himmel in kanadischer Wildnis, das erste Mal Todesangst zu verspüren, als ich mit einem Katamaran durch einen Hurrikan gesegelt bin, oder der Moment auf der Dachterrasse in Brooklyn mit Blick auf den Sonnenuntergang auf die Skyline in New York. Gefühlt habe ich jeden Tag eindrucksvolle Erfahrungen gesammelt – wahrscheinlich ist das der Grund, warum meine geplante Ein-Jahres-Reise dann doch sechs Jahre andauerte.
Was hast du unterwegs immer dabei?
Eine Packung Zimt :-) Hilft bei Magen-Darm-Verstimmungen. Ansonsten habe ich in den letzten zehn Jahren gelernt, sehr minimalistisch zu reisen, und bin aktuell meist nur mit Handgepäck unterwegs.
Wie hast du deine Weltreise finanziert?
Meine erste Reise habe ich teils mit angesparten Mitteln finanziert und teils mit klassischem Work&Travel und einfachen Arbeiten vor Ort. Wie zum Beispiel Bootsbau, Gärtner, Stripper, Klamottenschmuggel, Gastronomie oder Fließbandarbeit.
Wie sieht dein Leben heute aus?
Seit 2016 habe ich durch meine Reiseerfahrung meine Leidenschaft zur Berufung gemacht und habe es zu meiner Mission gemacht, andere dabei zu unterstützen, ihr Leben als persönliches Abenteuer zu gestalten. Große Teile meiner unternehmerischen Tätigkeiten kann ich remote durchführen und so einen meiner größten Werte, meine Freiheit, weiterhin in großem Stil ausleben, ich entdecke normalerweise zwei Drittel des Jahres selber noch mit Backpack die Welt.
Was möchtest du deinen Leser*innen mit auf den Weg geben?
Hör auf, dein Leben so zu leben, wie andere es von dir erwarten. Du bist zu hundert Prozent selber verantwortlich dafür, wie dein Leben verläuft. Das "Risiko", seine Träume zu leben, ist es allemal wert, und achtzig Prozent deiner Worst-Case-Szenarien sind nur Hirngespinste. Mal etwas beispielhafter ausgedrückt: Eine gute Party hat noch nie mit einem grünen Salat am Esstisch angefangen.
Wer sollte dein Buch lesen?
Jede/r, der/die diese innere Stimme hat, dass es da draußen noch mehr gibt als den eigenen Status Quo.
Jede/r, der/die es leid ist, die Träume nur im Kopf zu erleben, und es endlich angehen will, seine/ihre Träume zu verwirklichen.














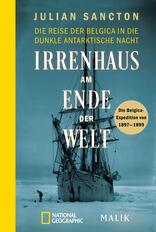

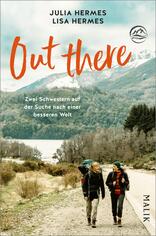























DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.