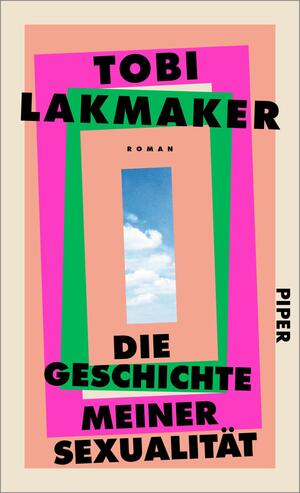
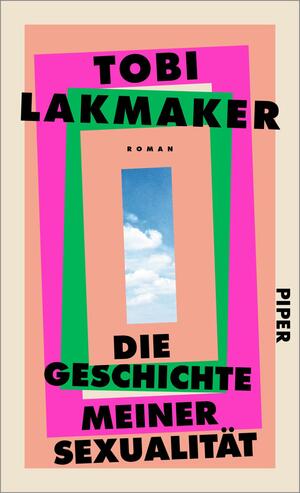
Die Geschichte meiner Sexualität Die Geschichte meiner Sexualität - eBook-Ausgabe
Roman
— Coming-out-Roman„›Die Geschichte meiner Sexualität‹ erzählt furchtlos von dem fließenden Übergang zwischen weiblich und männlich, von den Widersprüchen der eigenen Identität. Die fortdauernde Hin- und Her-Bewegung zwischen den Geschlechteridentitäten der Protagonistin stellt der Autor grandios dar. Eine unbedingte Leseempfehlung für diesen humorvollen und tiefgründigen Roman.“ - Berliner Zeitung
Die Geschichte meiner Sexualität — Inhalt
„Dieser Debütroman hat das Zeug dazu, ein Hit zu werden.“ NRC Handelsblad
„Das neue literarische Talent 2021“ Vogue
Eigentlich lag Sofie immer daneben. Bei den Jungs und bei den Mädchen, bei der richtigen Antwort und noch wichtiger: bei der richtigen Frage. Mit siebzehn plante sie ihre Solide Entjungferung mit Walter, die immerhin keine Enttäuschung war, aber doch irgendwie Wahnsinn. So Wahnsinn wie ein Flugzeugabsturz, überwältigend und nicht so richtig gut. Einige Jahre später hat sie es aufgegeben, die Frau zu werden, die andere in ihr sehen. Sie trägt die Haare raspelkurz, schwärmt für Jennifer, Muriel und Frida.
„Ein Debüt, wie man es selten erlebt. Die Entdeckung einer ganz eigenen Stimme, voller Bravour und Mumm!“ Ruth Joos, VPRO
Wie Sofie fast zum Star der lesbischen Community von Amsterdam wird, unter heftiger Verliebtheit leidet und doch darum ringt, andere nah an sich heranzulassen, davon erzählt Tobi Lakmaker in seinem gefeierten Debütroman. Mit charmant-dreistem Witz und hinreißender Zärtlichkeit schreibt er von den Räumen zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit, von queerer, fluider und Trans-Identität – und davon, dass wahre Intimität dort beginnt, wo wir alle Kategorien vergessen.
„Wenn Sie mich fragen, stößt Lakmaker Sally Rooney vom Thron.“ Jozedien van Beek, De Standaard
„Beißend, witzig und manchmal traurig, mit einem Touch Salinger.“ De Morgen
Leseprobe zu „Die Geschichte meiner Sexualität“
Meine Mutter ist eine Vaterjüdin
Meine Mutter hat immer gesagt: „Unsere Freunde sind nicht reich, sie haben bloß im richtigen Moment ein Haus gekauft.“ Meine Eltern haben in ganz genau dem richtigen Moment gekauft: in der Jacob Obrechtstraat 7 – im Herzen von Oud-Zuid. Jemand hat mir mal erklärt, in Amsterdam Oud-Zuid wohnten zwei Sorten von Menschen: ordinär Reiche und intellektuelle Juden. Ordinär reich waren wir nicht, wenn ich meinen Eltern glauben darf, Juden waren wir auch keine – meine Mutter war nur eine Vaterjüdin –, und als ich meinen Vater mal [...]
Meine Mutter ist eine Vaterjüdin
Meine Mutter hat immer gesagt: „Unsere Freunde sind nicht reich, sie haben bloß im richtigen Moment ein Haus gekauft.“ Meine Eltern haben in ganz genau dem richtigen Moment gekauft: in der Jacob Obrechtstraat 7 – im Herzen von Oud-Zuid. Jemand hat mir mal erklärt, in Amsterdam Oud-Zuid wohnten zwei Sorten von Menschen: ordinär Reiche und intellektuelle Juden. Ordinär reich waren wir nicht, wenn ich meinen Eltern glauben darf, Juden waren wir auch keine – meine Mutter war nur eine Vaterjüdin –, und als ich meinen Vater mal gefragt habe, was ein Intellektueller sei, antwortete er: „Ich kenne nur einen: Wilfred Oranje.“
Mit zwanzig habe ich eine Weile im alten Zimmer von Wilfred Oranje gewohnt, denn der war inzwischen tot, und immer, wenn ich dort wach wurde, sah ich Hunderte von Büchern von Sigmund Freud um mich herum. Lange habe ich es dort nicht ausgehalten. Ich wollte zwar auch eine Intellektuelle werden, aber jedes Mal, wenn ich ein Buch las, fielen mir die Augen zu. Ich kann es nicht ändern: Wenn ich zu lange auf Werke von Männern starre, die aussehen wie Sigmund Freud, fallen mir einfach die Augen zu.
Von meinem achtzehnten bis zweiundzwanzigsten Lebensjahr habe ich versucht, mir alle möglichen Sigmund Freuds einzuverleiben, doch was hatte ich am Ende davon? Nur das deutliche Gefühl, dass ich nicht Sigmund Freud war. Genauer gesagt: dass ich kein Mann war, sondern eine Frau. Damit tat ich mich sehr schwer – mit dem Frausein. Man wollte, dass ich meine Haare lang wachsen lasse. Natürlich sagt dir das nie jemand ins Gesicht, aber wenn Leute wollen, dass du etwas unbedingt schluckst, machen sie ja meist nicht den Mund auf. Sie lassen es dich wissen.
Inzwischen habe ich sehr kurze Haare und gehe in eine Selbsthilfegruppe für Transgender. Willst du mehr darüber wissen? Ruf mich gerne an. Ich bin überhaupt nicht transgender, sondern einfach nur jemand, der gerne Frauen penetriert und es leid ist, dafür ständig Geräte anschaffen zu müssen. Die Teile kosten ein Schweinegeld, und zu oft weiß man nicht, was man mit dem sauteuren Ding anfangen soll, weil es plötzlich schief in die Gegend ragt. Wisst ihr, womit ich echt durch bin? Mit Schieflagen jeglicher Art.
Natürlich hätte ich auch Bücher von Menschen lesen können, die nicht wie Sigmund Freud aussehen – von Frauen zum Beispiel oder schwarzen Männern. Oder noch besser: schwarzen Frauen. Aber Fakt ist doch, dass die nie zum Kanon gehören. Dieser beknackte Kanon. Und ich weiß, jetzt denkt ihr: „Woolf gehört doch auch zum Kanon, Baldwin gehört doch auch zum Kanon.“ Wollt ihr eine ehrliche Antwort? Von Baldwin will ich mir schon lange ein Buch kaufen, und bei Virginia Woolf sind mir genauso die Augen zugefallen. Unmittelbar nachdem sie die Blumen kaufen wollte, fielen mir die Augen zu.
Als ich ungefähr siebzehn war, setzte ich mir in den Kopf, ein Genie zu werden. Das Ärgerliche an Genialität ist nur, dass es sich damit genauso verhält wie mit Homosexualität: Man wird es nicht, man ist es. Heißt es. Wenn ihr mich fragt, waren alle Genies einfach Menschen, die es schafften, nicht ans Telefon zu gehen, wenn die Welt mal wieder was von ihnen wollte, um sich derweil auf etwas zu konzentrieren, worauf die Welt dann rein zufällig gewartet hatte. Na egal, jedenfalls: Ich ging auch oft nicht ans Telefon, so oft, dass meine Freundinnen mir die Freundschaft kündigten. Stattdessen fingen sie an zu lästern. Sie sagten, dass mit mir was nicht stimme, dass ich ja wohl lesbisch sein müsste, so, wie ich Zahra ansehen würde. Recht hatten sie – in allen Punkten.
Weil mich meine Freundinnen fallen gelassen hatten, hing ich immer öfter mit Felix und Chiel ab. An unserem weißen und elitären Gymnasium waren sie am weißesten und elitärsten, und das gefiel mir. In den Pausen sagte Chiel meist nur einen Satz: „War’s das jetzt?“, und dann nickte Felix. Ich nickte ebenfalls, aber eigentlich wusste ich nicht so genau, was er damit sagen wollte. Ich wusste nur, dass er recht hatte, denn das hatten sie, die weißen, elitären Typen. Ich selbst hatte selten recht, und das ging mir mit der Zeit ziemlich auf den Geist.
Eigentlich lag ich immer daneben. Bei den Jungs und bei den Mädchen, bei der richtigen Antwort und noch wichtiger: bei der richtigen Frage. Man kann so viele Antworten haben, wie man will, wenn einem die richtige Frage fehlt, redet man bloß im luftleeren Raum. Das immerhin ist mir inzwischen klar geworden. Mir ist klar geworden, dass Antworten einer Frage vorangehen. Und solange die nicht stimmen, wirst du eins immer behalten: unrecht.
Walter, der Recruitment Consultant
Die Geschichte meiner Sexualität geht so: Seit jeher bin ich auf der Suche gewesen nach jemandem, der die Türen und Fenster schließt und sagt: Jetzt ist alles gut. Konkreter stand ich erst auf Männer und dann auf Frauen, natürlich schon immer auf Frauen, auf Muriel, die rothaarige Nachhilfelehrerin mit den langen Beinen, auf welche Frau stand ich denn bitte nicht, und doch waren meine Augen oder irgendwas anderes Essenzielles verschlossen. Das spielt aber eigentlich keine Rolle.
Ich wurde von Walter, dem Recruitment Consultant, entjungfert, aber damit will ich mich nicht allzu lange aufhalten. Er wählte die Liberalen, und wenn es mir echt nicht gelang, irgendeine Erregung zu spüren, versuchte ich, daran zu denken, wegen dieses schrägen Zusammenhangs zwischen dem Geilen und dem Verhassten.
Ich wurde in der Sarphatistraat entjungfert, in einem Haus am Weesperplein, aus dem ein Fahnenmast ragt. Daran erkenne ich es noch heute, denn der Mast erinnert mich an Walters dicke und aufdringliche Erektion. Walter war sehr lieb. An dem Abend sagte er: „Ich glaube, ich bin nervöser als du.“ Er war tatsächlich nervöser als ich. Mir ging das alles, um ehrlich zu sein, am Arsch vorbei.
Warum ich unbedingt entjungfert werden wollte? Ich wollte meine S. E. hinter mir haben. Meine S. E. – das war meine Solide Entjungferung. Ich schwänzte den Unterricht oft mit Milan in der Coffee Company, und unser Gespräch kreiste immer nur um unsere zukünftige S. E. Vor allem kreiste es um die sorglose und wilde Zeit danach. Die S. E. sollte vor unseren Kindern als Alibi fungieren, denn zweifellos würden die irgendwann mit der Frage kommen: „Mit wem war eigentlich dein erstes Mal?“ Und dann könnten wir darauf eine grundsolide Antwort geben.
Milan wurde letztendlich in der Toilette der Amsterdamer Uniklinik entjungfert – er hatte angefangen, Medizin zu studieren. Und ich wie gesagt von Walter, in der Nacht vom 1. auf den 2. September 2011. Wir trafen uns danach noch ein Weilchen, nicht weil mir an dem Kontakt so viel gelegen hätte, sondern weil die Solidität es erforderte.
Walter und ich hatten uns im Mazzeltof kennengelernt, kurz nachdem ich Matthijs van Nieuwkerk gesimst hatte. Eigentlich wäre ich viel lieber mit Van Nieuwkerk ins Bett gegangen, aber er hat mir nie auf meine SMS geantwortet. Mein Bruder hatte mir seine Nummer gegeben, denn der hatte jede Menge Connections. Danach sehnte ich mich mit siebzehn: Sex und jede Menge Connections.
Um mich auf meine SMS an van Nieuwkerk konzentrieren zu können, hatte ich mich in eine Snackbar um die Ecke verzogen. Als ich ins Mazzeltof zurückkam, sah ich Walter da stehen und küsste ihn direkt auf die Wange. Hinten in der Kneipe saß Betsie. Ich ging zu ihr und sagte: „Der wird’s.“ Seit ich Betsie kannte, war sie immer minimal hübscher gewesen als ich, weshalb es die Hölle war, mit ihr auszugehen. Ich war ständig zweite Wahl. Darum musste ich Männer davon überzeugen, dass es nur eine Option gab: mich, Sofie Lakmaker.
Um Walter von Betsie fernzuhalten, bot ich an, die nächste Runde zu holen. An der Bar versuchte ich, Blickkontakt herzustellen. Walter sah mich furchtbar ängstlich an, und um ihn zu beruhigen, gab ich ihm das Bier, das für Betsie bestimmt gewesen war. Ich sagte: „Wir könnten jetzt rumknutschen.“
„Ich mag keine selbstbewussten Frauen“, antwortete er. Ich nickte, und dann knutschten wir rum.
Eine Woche später verabredeten wir uns im Lempicka. Er erzählte mir, er komme aus Heerlen und sein Opa habe eines Tages entdeckt, dass man altes Frittierfett in Biodiesel umwandeln könne, weshalb seine Eltern jetzt einen Pool im Garten hätten. Ich erzählte ihm, dass ich Philosophie studieren wolle. Woraufhin er mir vorwarf, ich sei links. Ich erwiderte, er sei rechts, und schlug vor, zu ihm zu gehen.
Wir haben dann auf seinem Bett noch ein bisschen weiter rumgeknutscht, und nach einer Viertelstunde sagte ich: „Lass es uns einfach machen.“ Walter litt Höllenqualen, das merkte ich wohl, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Zumindest dachte ich das. Er war sechsundzwanzig und ich wie gesagt siebzehn, und das ist ja das Verrückte: Je mehr Zeit einem bleibt, desto eiliger hat man es. Ich weiß noch, dass er etwas zu knappe Boxershorts trug, die immer knapper wurden durch seinen halb steifen Schwanz. Später stellte sich heraus, dass Walter durchgängig einen Halbsteifen hatte, weswegen er sich ständig einen runterholen musste. Eine Zeit lang wollte er, dass ich das tue, aber ich war offenbar zu grob.
Freundinnen von mir hatten auf ihre Entjungferung schwer enttäuscht reagiert. Alle sagten: „Das soll es gewesen sein?“ Ich dagegen fand es Wahnsinn. Vielleicht nicht im rein positiven Sinn, eher so, wie ein Flugzeugabsturz Wahnsinn ist: überwältigend und so, dass man es womöglich nie in Worte fassen kann. Walters Schwanz war überall. Nach einer Weile sagte er: „Ich hätte gerne, dass du ihm ein Küsschen gibst.“ Ich fand das eigentlich albern, habe es dann aber doch getan. Wenn man nie etwas tut, was man albern findet, geht auch nichts voran.
Nachdem Walter gekommen war, sagte er: „Versprichst du mir, dass wir es nie wieder so machen?“ Damit meinte er, ohne Kondom. Ich erinnere mich nicht mehr, wie es dazu kam – man kann nicht behaupten, dass es dem Zauber des Augenblicks geschuldet gewesen wäre. Das Ganze dauerte Stunden. Ich habe zwar mal erwähnt, ich sei zu „Everywhere“ von Fleetwood Mac entjungfert worden, und das Lied lief tatsächlich irgendwann, aber wenn man’s genau nimmt, bedurfte es der kompletten Geschichte der westlichen Popmusik.
Als ich aufwachte, stand Patrick im Türrahmen. Patrick war Walters Mitbewohner, und wenn ich ehrlich bin, fand ich ihn um einiges attraktiver als Walter. Sein Haar war streng nach hinten gekämmt. Wie Walter kam er aus Limburg, nur dass er das G weniger weich aussprach. Eigentlich sah Patrick aus wie ein Arschloch, aber genau das gefiel mir. Er sah zumindest nach irgendwas aus. Walter sah aus wie jemand, der in der Metro neben einem steht und den man dann fragt, ob man mal vorbeidarf. So einer war Walter.
Patrick war auf der Suche nach seiner Krawatte, und als ich mich umdrehte, um Walter zu fragen, sah ich, dass das Bett ansonsten leer war. Er war schon zur Arbeit gefahren, wo er Leute recruiten musste. Fragt mich nicht, worum es da ging, aber er verdiente eine Menge Geld. Walter war in Utrecht beschäftigt, und ich fand das ziemlich deprimierend. Vielleicht war das sogar meine größte Angst: irgendwann mal irgendwo beschäftigt zu sein. Erst recht in Utrecht.
Patrick arbeitete bei einem Start-up in Amsterdam, und als ihm auffiel, dass Walter nicht da war, hörte er gar nicht mehr auf zu grinsen. Er fragte, ob wir es denn nett gehabt hätten. Ich antwortete, dass wir es furchtbar nett gehabt hätten, doch darüber erschrak er ziemlich. Die Leute mögen es nicht besonders, wenn man das Wort „furchtbar“ zu oft benutzt. Vielleicht, weil das zu selbstbewusst klingt.
Patrick blieb dann noch eine Viertelstunde im Türrahmen stehen, und dadurch verspannte ich mich ein bisschen. Ich hatte nämlich absolut gar nichts an, und ich glaube, das wusste er auch. Sich nackt mit jemandem zu unterhalten, dem nur die Krawatte fehlt, sorgt für ein gewisses Gefälle. Schließlich sagte ich: „Und jetzt lese ich das Quote 500.“ Dieses Ranking der reichsten Niederländer lag neben Walters Bett, zusammen mit ein paar Büchern voller Ratschläge, wie man mit minimalem Aufwand einen Haufen Geld machen kann. Einfach altes Frittierfett in Biodiesel umwandeln, würde ich sagen, aber das ist wohl doch nicht alles.
Kurz nach meiner Entjungferung zogen Patrick und Walter in ein Haus in Zeeburg. Das hatten sie vom frisch gewählten Bürgermeister Van der Laan gekauft, denn der zog natürlich in seine Amtswohnung. Er hinterließ eine ganz ordentliche Hütte. Sie wurde allerdings von Patricks Flamme Lianne eingerichtet, und die hatte einen fürchterlichen Geschmack. Lianne war Zahnarzthelferin, ein Beruf, der sich in der Wahl des Mobiliars niederschlug. Eigentlich hatte man in diesem Haus an der Ertskade ständig das Gefühl, man wäre zum Zähneziehen da.
Und wer glaubt, Liannes Anschlag auf die Einrichtung sei nicht zu toppen, kennt Patrick schlecht. Der verteilte nämlich im ganzen Haus Bücher von Kluun. Ich schwör’s euch: Wohin man guckte, überall lag so ein widerliches Buch. „Super Typ“, sagte Patrick jedes Mal über ihn. Das ging mir wahnsinnig auf die Nerven. Trotzdem war er immer noch ein unterhaltsamerer Gesprächspartner als Walter – mit dem sprach ich damals kaum noch. Der wollte mich die ganze Zeit dazu bringen, Bücher zu lesen, die einem helfen, den eigenen Körper kennenzulernen, aber dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Deshalb hielt ich mich beim Frühstück und in anderen müßigen Momenten einfach an Patrick und Lianne. Bei denen war wenigstens was los, wisst ihr? Lianne war streng gläubig, und um sie zu ärgern, sagte Patrick ständig „Gott verdammt“. Dann sah er mich feixend an, woraufhin wir beide losprusteten. Super Typ, dieser Patrick.
Am 22. November 2011 postete Walter auf Facebook, dass er Single und auf der Suche sei. Wütend rief ich ihn daraufhin an, und obwohl er im Auto saß, ging er direkt dran. Er hatte so eine Freisprechanlage. „Schätzchen“, sagte er, „du bist siebzehn.“ „Aha“, sagte ich. Kurz hörte ich nur das Rauschen der A 2, und dann flüsterte er: „Wenn du dreiundzwanzig wärst, hätte ich dir sofort einen Heiratsantrag gemacht.“ Das war natürlich genauso albern, und es gibt Tage, an denen ich mich frage, was wohl aus uns geworden wäre, wenn wir das einfach durchgezogen hätten. Wahrscheinlich wäre ich jetzt auch irgendwo beschäftigt, und vielleicht wäre das gar nicht mal so schlimm.
Nenn es Liebe
2018 wurde ein sehr schlechtes Buch über mich geschrieben: Liebe. Selbst hätte ich es vielleicht Nenn es Liebe oder so ähnlich betitelt, denn das, was zwischen mir und dem Autor war, hatte mit Liebe nur sehr entfernt zu tun. In dem Buch heiße ich „das Mädchen A.“, aber das ist halt Unsinn. Ich heiße ganz einfach Sofie Lakmaker. Ich habe nur Rezensionen gelesen, nicht das Buch selbst, und die waren vernichtend. Das reicht mir. Manche Leute behaupten, Rezensenten seien auch nur Menschen, aber ich glaube das nicht. Meiner Meinung nach haben sie immer recht und befriedigen damit ein fast seit meiner Geburt bestehendes Bedürfnis: recht zu haben und Menschen nahe zu sein, die dieses Recht für sich in Anspruch nehmen.
Auf dem Cover ist ein sehr hübsches Mädchen drauf, viel hübscher, als ich es bin – oder zu der Zeit war, in der ich mit Lusche D. – so nenne ich ihn jetzt mal – zusammen war. Wahrscheinlich merkte Lusche D. das auch nach einer Weile, konnte es aber nicht mehr korrigieren, denn dank der schlechten Kritiken gab es natürlich keine zweite Auflage.
Meine Mutter sagte, Rache sei ein Gericht, das man am besten kalt serviert, doch ich weiß eigentlich gar nicht so genau, ob ich darauf aus bin. Vielleicht haben die Rezensenten schon für mich Rache genommen, oder vielleicht ist Rache einfach nicht so wichtig. Rache ist etwas für nachtragende Menschen – ich bin vor allem traurig.
Ich lernte Lusche D. kennen, als ich vier war, und das war natürlich nicht der Moment, in dem wir zusammenkamen, denn er war damals zwölf. Er war der beste Freund meines Bruders Daniel und wollte nie bei uns zu Hause spielen, sondern immer bei sich. Meine Eltern misstrauten ihm deshalb sofort, aber ich habe mich mit so was wie Misstrauen eigentlich nie lange aufgehalten. Erst recht nicht mit vier.
Wir sahen uns zum ersten Mal seit langer Zeit auf Daniels Geburtstag wieder. Ich war gerade von Walter, dem Recruitment Consultant, entjungfert worden, und davon erzählte ich ihm in allen Einzelheiten. Während ich redete, sah ich ein glühendes Interesse in seinen Augen, und ich glaube, diesen Blick konnte man wie folgt interpretieren: „Eine Frau, die spricht.“
Später radelten wir zusammen nach Hause, und ich musste ganz dringend. Ich pinkelte auf die Straße, und wieder sah ich diesen Blick: „Eine Frau, die pinkelt.“ Lusche D. hat mir unglaublich viele Erkenntnisse zu verdanken. Ein paar Monate später schickte er mir eine SMS: Ob ich mit der Schule fertig sei. Ich antwortete, dass ich einen Schnitt von 7,8 hätte, und dass der eigentlich bei 8,3 läge, wenn man nur die schriftlichen Prüfungen betrachtete.
Zur Feier des Tages gingen wir im De Wetering was trinken, wo ich ihn fragte, ob er mit seinem Geschlecht zufrieden sei. Er antwortete, dass er bisher niemanden habe klagen hören. Dann fragte er mich natürlich, was ich mit meinem Leben anfangen wolle, denn es gibt wirklich niemanden, der dir diese Frage nicht stellt, wenn du achtzehn bist, und ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich darauf antwortete. Ich meine, ich sagte nichts, und dann, dass meine Mutter Krebs habe. „Das ist ja Scheiße“, sagte er.
Als das De Wetering schloss, zogen wir um ins De Spuyt. Das war echt eine geschmacklose Kneipe, und ein paar Stunden später zogen wir weiter in eine noch geschmacklosere: das Mazzeltof. Es war mir wirklich scheißegal, ob ich Walter da traf. Eigentlich hoffte ich, Lianne und Patrick zu begegnen. Ich wollte ihn fragen, ob er Kluun immer noch für einen super Typen hielt. Aber er war nicht da, und auch Lianne war nirgends zu entdecken.
Das Angenehme an Walter war gewesen, dass ich mit ihm zusammen sein konnte, ohne mich auf ihn konzentrieren zu müssen. Lusche D. dagegen stellte mir ständig Fragen. Schließlich stellte ich ihm eine Frage, nämlich: „Meinst du, Daniel findet das hier schlimm?“ Er sah mich an und schwafelte dann bedächtig was von Mädchen, die eines Tages Frauen werden. Das fand ich ein bisschen ermüdend: all die Erkenntnisse von Lusche D. über Mädchen und Frauen und den Moment, in dem sich die einen in die anderen verwandeln.
Daniel fand es schrecklich, glaube ich. Ein paar Wochen später saß ich mit ihm in einer Kneipe und sagte: „Lass uns über Lusche D. reden.“ „Nö“, antwortete er. Das Verrückte an Daniel ist, dass man das dann auch echt nicht tut. Ich jedenfalls nicht. Er sagte bloß, dass es seiner Meinung nach eine gute Idee wäre, wenn ich für ein Weilchen nach Prag zöge. Und das Verrückte an Daniel ist, dass man das dann auch echt in Betracht zieht.
Jedenfalls sind Lusche D. und ich nach dem Mazzeltof noch eine Weile durch die Straßen gelaufen. Wir wollten einander natürlich küssen, aber trauten uns beide nicht. An der Ecke zur Ruysdaelkade sagte ich: „Come on, son.“ Und dann haben wir uns geküsst. Es war schon wieder hell geworden, und das Leben atmete zahllose Möglichkeiten, wenn ihr mich fragt.
Wenig später zog ich so gut wie bei ihm ein. Er wohnte in der Nieuwe Looiersstraat, gegenüber von dem Pilatesstudio, in das meine Mutter ging. Deshalb guckte ich immer erst aus dem Fenster und hielt Ausschau nach ihrem Fahrrad, bevor ich zur Tür raustrat. Meine Mutter hatte ihr Fahrrad gelb lackiert, weil sie dachte, dass es dann nicht mehr gestohlen würde. Zwei Dinge verlor sie ständig: Fahrräder und Kontaktlinsen.
Meistens aß sie sie, ihre Linsen. Sie nahm sie zum Reinigen in den Mund, vergaß dann aber, dass sie da schon ein Kaugummi drin hatte. Ganze Hypotheken sind für die Kontaktlinsen meiner Mutter draufgegangen. Ihre Fahrräder verlor sie etwas weniger oft, und der Trick mit dem Gelb hat wirklich eine Zeit lang funktioniert. Eines Tages sah ich sie allerdings wieder auf der Straße herumtasten: Sie hatte sowohl ihre Kontaktlinsen als auch ihr Fahrrad verloren. Und so irrte sie durch die Gegend, emsig auf der Suche nach ihrem Fahrrad. Meine Mutter glaubte nämlich, dass Diebe ihr Fahrrad bei genauerer Betrachtung so hässlich fänden, dass sie es an der nächsten Ecke einfach wieder abstellen würden.
Eigentlich kann ich gar nicht sagen, warum ich bei Lusche D. einzog. Genau genommen gibt es viele Dinge, die ich nicht so richtig verstehe, und da rede ich dann gerne ein bisschen drum herum. Ich vermute, dass ich mich bei ihm sicher fühlte, aus dem einfachen Grund, dass seine Welt Ränder hatte. Zwar nicht die stabilsten Ränder; Ränder voller Ängste und Ambitionen. Aber es waren welche, und so was fehlt einem mit achtzehn meistens.
Genau das tat ich bei ihm zu Hause: mich an den Wänden entlanghangeln, die komplett mit Seufzenden Männern vollgehängt waren. An jeder Wand hing einer: Ernest Hemingway, Jack London, Nick Drake. Lusche D.s Haus war eine Art Selbstmordparadies, und an manchen Tagen hatte ich das Gefühl, er wolle sich ihnen so bald wie möglich anschließen. Das wäre sicher auch passiert, wenn seine Lektorin dem nicht einen Riegel vorgeschoben hätte.
Mein Gott, diese Lektorin! Sie rief ihn ungefähr alle halbe Stunde an. Nicht um zu fragen, wo sein Manuskript bleibe, nein, sie fragte nur, ob er genug Obst im Haus habe. Die Frau machte mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn wir einander begegneten, sagte sie so was wie: „Und du bist ein bisschen zu jung für Lusche D.“ Dann schaute ich sie nur glasig an und dachte: Und du bist ein bisschen zu alt. Ich habe noch nie jemanden so verliebt gesehen. Vielleicht wäre alles gut geworden, wenn ich nur einen Bruchteil der Gefühle empfunden hätte, die sie für Lusche D. hegte.
Jedes Mal, wenn sie sichergestellt hatte, dass er genügend Äpfel im Haus hatte, erzählte sie ihm, wie brillant er sei. Mir fielen dann regelmäßig fast die Augen zu. Und alle glaubten ihr, weil sie irgendwann mal mit Harry Mulisch zusammengearbeitet hatte. Na, wenn ihr mich fragt, ist das eigentlich Grund genug, um nicht mehr ans Telefon zu gehen. Es sei denn, man will echt sehr schlechte Bücher schreiben, die neunhundert Seiten zu lang sind. Und genau das tat Lusche D.: sehr schlechte Bücher schreiben, bei denen man wirklich bei jeder Zeile denkt: „Also, das kommt mir jetzt überflüssig vor.“
Aber es war mir total egal, versteht ihr, dass er so schlechte Bücher schrieb. Ich fand es einfach nett mit ihm. Mein Partner braucht echt nicht übermäßig talentiert zu sein. Was ich allerdings ein bisschen störend fand: dass er mich ständig als seine Muse bezeichnete. Ob ihr’s glaubt oder nicht, ich inspirierte ihn. Für so einen Quatsch muss man mich wirklich nicht wecken. Lass mich in Gottes Namen einfach weiterschlafen, wenn ich deine Muse bin. Eine etwas zu junge, schnarchende Muse: Das war ich.
Selbst schrieb ich nicht, oder jedenfalls nicht echt, wie ich es damals nannte – ich arbeitete im Bagels & Beans. Davor hatte ich drei Tage in einem Restaurant in der Roelof Hartstraat gearbeitet, aber da hatte der Chef am zweiten Tag gefragt, wer ihm in der Pause einen blasen wolle. Da wollte ich natürlich direkt wieder aufhören, aber er fand, dass ich ihm diese Gefälligkeit noch schuldig sei.
Bei Bagels & Beans habe ich es nicht viel länger ausgehalten. Oder eher: Sie haben mich nicht viel länger ausgehalten. Nach meinem Probemonat hinterließen sie eine Nachricht auf meiner Mailbox: „Sofie, du bist ein superliebes Mädchen, aber echt zu verträumt für uns.“ Wärt ihr dabei gewesen, hättet ihr das sicher ähnlich gesehen. Ich vergaß alles. Ich gab nicht mal die Bestellungen durch – die Leute bekamen einfach kein Essen.
Aber ich will ehrlich zu euch sein: Eine große Dichterin, das wollte ich werden. In der Woche, nachdem ich bei Bagels & Beans rausgeflogen war, erreichte meine Kreativität ihren Höhepunkt. Da meine Eltern nicht wissen durften, dass ich gefeuert worden war, radelte ich jeden Tag kreuz und quer durch die Stadt. Ich trank an verschiedensten Orten Kaffee und kritzelte da und dort was zusammen. Es war, als würde ich verschwinden, und genau das hatte ich auch vor: weggehen und wiederkommen, wenn ich alle Erwartungen übertroffen hätte. Langfristig geht so was nicht, denn man muss sich immer und überall verantworten, doch diese eine Woche lang klappte es.
An einem meiner letzten verschwundenen Tage saß ich im Eye, wo ein Junge und ein Mädchen neben mir ein Sandwich aßen. Das Mädchen war echt hübsch. Ich war nicht echt hübsch. Ich war manchmal hübsch. Ich schrieb:
Ich bin recht hübsch,
aber bleibe es nicht,
komme nur ab und zu vorbei,
um zu gucken, wie andere mich ansehen.
Damit komme ich zu einem sehr wesentlichen Punkt: mein Äußeres. Am liebsten lief ich den ganzen Tag in meinem Trainingsanzug von Real Madrid rum. Nur kamen dann immer wieder diese Abende, mit Menschen, mit Blicken, mit Bier, und sie riefen: Wir wolln was fürs Auge! Dann gehorchte ich. Ich zog eine Hose an, die am Hintern gut saß, trug Foundation auf, sodass meine Haut perfekt schien, und glättete mein Haar.
Ohne geglättetes Haar war ich, wenn ihr mich fragt, wenig bis nichts wert. Bei Walter tat ich all das auch, aber den sah ich eben nur so flüchtig: Er musste immer wieder zurück nach Utrecht. Mit Lusche D. war ich dagegen so gut wie pausenlos zusammen, da kann man so was nicht durchhalten. Schwer zu erklären, aber es kommt der Moment, an dem man erstickt. Wer lange genug manchmal hübsch ist, erstickt. Das könnt ihr mir glauben.
Eine weitere Frucht der Woche, die auf meinen Rauswurf bei Bagels & Beans folgte, war ein Gedicht über mein Perineum. An mein Perineum, eigentlich. Es war ein Entschuldigungsschreiben, weil mein Perineum ständig mit dem Ergebnis eines so unaufrichtigen Genusses konfrontiert wurde. Der Sex mit Lusche D. war nämlich schrecklich. Wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll – und ob ich anfangen soll. Er lief jedenfalls immer gleich ab: Wir saßen bei ihm auf der Couch, und dann küssten wir uns. Ein bisschen leidenschaftlich, ein bisschen furchtbar gleichgültig. Dann stand er auf – das hasste ich, ich wollte nie, dass er aufsteht –, und wir gingen zusammen ins Schlafzimmer. Dort legten wir uns hin: ich unten und er oben.
Die Frage ist, wie weit ich hier ins Detail gehen sollte. Es läuft darauf hinaus, dass etwas sehr Eintöniges geschah, bei dem ich die ganze Zeit dasselbe Geräusch machte und er die ganze Zeit denselben Gesichtsausdruck hatte. Nachher verließ er das Zimmer und blieb ungefähr zehn Minuten weg. Ich bin nie dahintergekommen, was in jenen zehn Minuten passierte. Wenn er wiederkam, warf er mir ein Handtuch zu. Dann fühlte ich mich immer wie eine Nutte. Aber das Gefühl wurde regelmäßig von der Erleichterung abgelöst, dass diese Prozedur wieder einmal vorbei war.
Inzwischen habe ich Freundinnen, die sagen: „Ach Soof, Heterosex ist einfach so schlecht.“ Aber das glaube ich nicht. Sie müssen da doch auch Spaß dran haben. Ich jedenfalls nicht, so viel steht fest.
Ein paar Monate nach unserem Kuss auf der Ruysdaelkade fuhren Lusche D. und ich für ein verlängertes Wochenende an den Lido. Auf Wikipedia steht: „Dieser Badeort ging in die Weltliteratur ein, weil dort Thomas Manns Roman Der Tod in Venedig spielt.“ Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, ich hätte es auch schreiben können. Irgendwas starb in mir an jenem Wochenende. Was genau, weiß ich nicht, vermutlich jedoch: der Glaube daran, dass es gut ausgeht. Mit mir und Lusche D., und noch viel wichtiger: mit mir und dem Musendasein.
Ach Gott, die Musen. Ich habe an jenem Wochenende eine kennengelernt, und was für eine. Sie war die Frau eines Schrecklich Berühmten Autors, und ich würde sie gerne beim Namen nennen, aber der ist mir gerade entfallen. Vielleicht habe ich ihn auch nie gekannt. Schätzungsweise hat sie sich mir vorgestellt als: die Muse eines Schrecklich Berühmten Autors.
Lusche D. musste ihn für Vrij Nederland interviewen, weil er womöglich den Literaturnobelpreis gewinnen würde. Er genoss nämlich den ruhmreichen Ruf eines angesehenen europäischen Schriftstellers. Die EU stand damals mal wieder unter Druck, und deshalb hielt es jeder für eine gute Idee, den Preis an einen Wahren Europäer zu vergeben. Bei mir genoss dieser Mann allerdings vor allem den Ruf eines Üblen Lüstlings. Er bekam den Nobelpreis in dem Jahr nicht, hat aber noch Chancen: Wenn derzeit eine Gruppe besonders unter Druck steht, dann wohl die der Üblen Lüstlinge.
Am Abend nach dem Interview gingen wir zu viert essen: Lusche D. und ich zusammen mit dem Widerling und seiner Frau. Das Erste, was der Widerling zu mir sagte, war, dass ich mit offenen Haaren sicher noch besser aussähe, und das hatte er gut erkannt. Ich hatte allerdings vergessen, meinen Haarglätter mit nach Venedig zu nehmen, deshalb war das nicht zu ändern. Nach dieser Bemerkung sprach er über die Conditio humana, und dazu hatte ich eigentlich auch was zu sagen, doch wann immer er sprach, wandte er sich ausschließlich an Lusche D.
Deshalb redete ich irgendwann nur noch mit der Frau des Widerlings, und die fand ich ziemlich ermüdend. Wir entdeckten, dass sowohl sie als auch mein Vater für das Rijksmuseum gearbeitet hatten, und ich hoffte, sie würde mir verraten können, was er da getan hatte, denn das verstand niemand. Meine Mutter sagte immer: „Es könnte sein, dass dein Vater eigentlich für den Geheimdienst arbeitet.“ Wer weiß. Mein Vater hat darüber nie ein Wort verloren. Ganz selten erzählte er mal was, stiftete damit aber nur noch mehr Verwirrung. „Das Trampeltier hat heute wieder alles gegeben.“ Solche Dinge sagte er dann.
Das Trampeltier war die Vorgesetzte meines Vaters, und ihre Sicht der Dinge unterschied sich doch sehr von seiner. Ich habe sie nur einmal gesehen, auf der Museumsnacht. Sie gab mir einen Spieß mit Erdbeeren und meinte, dass ich den in den Schokoladenbrunnen halten könne, wenn ich das lecker fände. Mein Vater meinte, dass ich mir die Gemälde ansehen könne, wo wir doch in einem Museum seien. Das habe ich auch kurz getan, bin aber immer wieder zu dem Brunnen zurückgeschlichen. Darin zeigte sich der visionäre Weitblick des Trampeltiers: Menschen mögen Schokolade lieber als Kunst.
Sie hat es im Rijksmuseum länger ausgehalten als mein Vater. Das Trampeltier hat die Große Wende überlebt, mein Vater nicht. Während der Großen Wende wurden alle entlassen, die lieber in einem Museum als in einem Schokoladengeschäft arbeiten wollten. Mein Vater hatte das falsche Mindset, deshalb bekam er einen silbernen Händedruck. Davon sind wir dann ein paarmal in den Urlaub gefahren, und während ich das alles der Frau des Widerlings erzählte, sagte sie unaufhörlich: „Er wird sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern.“ Ich schwör’s euch: Diese Art von Aussage macht mich echt fertig.
Eine Stunde später gingen wir in ein Restaurant, das der Widerling ausgesucht hatte. Um dort hinzukommen, mussten wir ein Boot nehmen, und auf diesem Boot fing er an, mir in die Waden zu kneifen. Ich war bestürzt, und ich glaube, Lusche D. auch, aber auf seinem Gesicht war ein Lächeln eingefroren. Er bekommt womöglich den Literaturnobelpreis, also lass ihn ruhig fummeln, sollte es mir vermutlich sagen.
Ich sah das anders. Ich fragte den Widerling, was er sich in Gottes Namen dabei denke, und da kräuselten sich seine Mundwinkel verschmitzt. „Ich habe gehört, du willst durch Europa radeln“, sagte er. Das stimmte, das hatte ich tatsächlich vor. Am glücklichsten war ich auf dem Fahrrad, also dachte ich: Warum nicht für immer? Ich nickte, woraufhin der Widerling nuschelte: „Wollte nur kontrollieren, ob du schon startklar bist.“
Beim Essen litten alle darunter, dass der Widerling sich ständig an die Bedienung ranschmiss. Ich konnte ihm nicht unrecht geben: Sie war ein wunderschönes Mädchen. Es wurde allerdings noch schlimmer, wenn sie nicht da war – denn dann ignorierte er seine Frau, sprach ausschließlich mit Lusche D. und warf mir hin und wieder zu, ich möge meinen Tintenfisch aufessen.
Aber ich konnte nicht mehr: Als Vorspeise hatte ich eine Pizza bestellt. Ich war so satt, dass ich das Gefühl hatte, mich für den Rest meines Lebens problemlos von nichts als Mandarinen ernähren zu können: so satt. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Frau des Widerlings mit mir mitfühlte. Als er auf dem Klo war, flüsterte sie: „Liebes, es reicht, wenn du mal probierst.“ Danach ging Lusche D. aufs Klo, und der Widerling nutzte die Gelegenheit, um mich zu fragen, worin ich denn gut sei. „In der Schule?“, fragte ich zurück. „Nach was anderem würde ich nie zu fragen wagen“, antwortete er. Wieder erschien dieses Lächeln. Gott, was war der für ein Übler Lüstling, dieser Schrecklich Berühmte Autor.
„Liebes, es reicht, wenn du mal probierst.“ An diesen Satz musste ich nachher noch oft denken. Ich habe das Musendasein probiert und wollte es auskotzen wie meinen Tintenfisch. Irgendwann erzählte ich das Lusche D.: „Mir graut davor, wie die Frau des Widerlings zu enden.“ Er antwortete, das werde er nie zulassen – eine nicht sehr beruhigende Reaktion, wenn ihr mich fragt. Diese Dinge haben zu meinem Entschluss beigetragen, das Ganze dann doch zu beenden. Außerdem fand ich es schlimm, dass ich dem Moment, an dem wir uns ausziehen würden, schon beim Nachtisch mit Schaudern entgegensah. Lusche D. spürte das, denke ich. Er sagte: „Ich möchte gar nicht so sehr mit dir vögeln, ich möchte einfach mit dir sein.“
Im Sein waren wir tatsächlich ganz brauchbar. Ich glaube, niemand hat die Türen und Fenster so perfekt geschlossen wie Lusche D. damals. Er und ich lebten in einer sehr kleinen Welt, voll mit Bob Dylan, dem Lied „Paris 1919“ von John Cale und Gedanken, die sich im Grunde einzig und allein um Anerkennung drehten und die Furcht, sie nie zu erhalten.
Lusche D. hat mir enorm geholfen, diese Angst zu überwinden. Er schrieb mir sogar einen Brief: „Bleib ruhig, folge deiner Intuition und verschwende keine einzige Minute, keinen Gedanken an Die Anderen, an Erwartungen und Ambitionen. Die Anderen gibt es nicht, sie werden sich auflösen, ihre Meinungen sind völlig irrelevant. Lass sie ruhig kribbelig werden. Schäme dich nur für die Dinge, für die du dich schämen solltest. Und was den Rest angeht: Versetze dich nie in deinen Feind.“
Ich verstand nicht so ganz, was er mit dem letzten Satz sagen wollte. Mit dem Satz davor übrigens auch nicht. Aber davon mal abgesehen, waren das sehr nützliche Ratschläge. Misslich war nur, dass ich nicht erkannte, dass er Der Andere war. Im Grunde wollte ich Lusche D. besiegen, ihn und meinen Bruder und vielleicht noch eine Reihe Anderer – genau genommen: Männer. Versteht mich nicht falsch, das ist ein prima Menschenschlag, und es gibt jede Menge Männer, mit denen ich mich gut verstehe, aber: Es geht einfach so oft schief.
Mit schief meine ich, dass Frauen noch oft schwingendes langes Haar haben und Männer viel kürzeres, und dass Frauen alles in allem ein ganzes Stück weniger Raum bleibt, zum Atmen und dazu, Witze zu reißen, über die dann auch wirklich jemand lacht, und nicht pausenlos lächeln zu müssen, ohne dass man sie gleich für eine Hexe hält. Über solche Dinge kann ich mich ziemlich aufregen.
Dieses Bewusstsein war bei mir mit achtzehn noch nicht geweckt. Lusche D. und ich machten ziemlich viele Witze über Minderheiten, vor allem über Lesben. Das seien doch echt eigenartige Menschen, fanden wir. Als es aus war zwischen uns, er sich aber noch nicht gegen mich gewandt hatte und wir uns auf einen Kaffee trafen, meinte er, ich sei jetzt doch noch die Kampflesbe geworden, über die wir früher immer so gelacht hätten. Da blieb mir die Luft weg. Für diejenigen unter euch, die noch nie auf ein kulturelles Stereotyp reduziert worden sind: Es fühlt sich an, als würde man einen Mordsschlag in die Magengrube verpasst bekommen und kurz um Luft ringen. Das Ärgerliche daran ist, dass man wegen des Luftmangels ein Weilchen nicht nachdenken kann und deshalb immer wieder dasselbe tut: lächeln.
Und zu guter Letzt hat er sich gegen mich gewandt. Es ist eine etwas tragische Geschichte – die Frage ist nur, ob wir das Thema vertiefen müssen. Es fing mit der Bemerkung über Kampflesben an und endete mit einem Haufen Bemerkungen ähnlicher Art. Genau genommen endete es da, wo es immer endet: bei der Ausrede, dass das Humor sei und du den aushalten können musst.
Ich habe viel über Humor nachgedacht und mich gefragt, warum ich immer Du sein musste. Und vielleicht liegt es nicht einmal am Humor – vielleicht entsteht das Giftige aus der Tatsache, dass die Ichs und die Dus so ungleich verteilt sind. Ich habe versucht, ihm das klarzumachen, aber er hat es nicht verstanden. So ist das mit Menschen, die zu lange Ich sind: Sie werden nie mehr Du. Er nannte mich eine lesbische Fundamentalistin, und vielleicht bin ich das tatsächlich. Aber auch mit Fundamentalisten kann man Spaß haben. Glaubt mir.
Lieber Tobi, dein Debütroman ist im Februar 2021 in den Niederlanden erschienen, und damals hieß die Autorin noch Sofie Lakmaker. Was ist seither passiert?
Gar nicht so viel! Ich glaube nicht daran, dass sich das eigene Leben von Grund auf ändert, nur weil man sich für einen anderen Namen oder ein anderes Pronomen entscheidet. Meine Freundin hat ihren beiden Töchtern irgendwann gesagt, dass sie mich nicht mehr Sofie, sondern Tobi nennen sollen, weil ich den Eindruck hatte, mich mit diesem Namen wohler zu fühlen.
Wir dachten uns ein Spiel aus: Wer weiterhin Sofie sagt, zahlt 10 Cent. Innerhalb einer Woche nannten mich die drei Tobi, und es fühlte sich richtig an, obwohl es mich gleichzeitig verletzbarer machte. Das gab mir das nötige Selbstvertrauen, um mehr Menschen von meinem neuen Namen zu erzählen.
Der Roman handelt auch, aber nicht nur von Sexualität. Worum geht es noch? Und warum läuft am Ende doch alles bei diesem Thema zusammen?
Ein anderer, vielleicht sogar wahrhaftigerer Titel für mein Buch hätte Die Geschichte meiner Einsamkeit sein können. Der Roman handelt von einer heranwachsenden Frau, die sich zunächst als lesbisch und später als transgender versteht. Hinter oder neben den Genderfragen steht das Motiv des Scheiterns, insbesondere was Intimität betrifft – wobei die Probleme der Protagonistin natürlich damit zu tun haben, dass sie mit diesen Genderfragen ringt. Die Einsamkeit, die daraus resultiert, dürfte aber jeder und jede kennen.
Letztlich geht es in meinem Roman auch um Trauer – und ein klein wenig um Fußball.
Deine Protagonistin Sofie sagt an einer Stelle: „Eigentlich lag ich immer daneben. Neben den Jungs und neben den Mädchen, neben der richtigen Antwort und noch wichtiger: neben der richtigen Frage.“ Gibt es diese richtige Frage?
Ha, gute Frage! Die Geschichte setzt ein, als Sofie ungefähr 17 ist. Damals habe ich mich zu allen möglichen Dingen gezwungen, um eine attraktive Frau zu werden: lange Haare, Eyeliner, jede Menge Foundation. All das schien die einzig richtige Antwort auf eine Frage zu sein, die kein Mensch explizit aussprach und die doch jeder stellte. Im Rückblick hätte ich gern den Mut gehabt, diese Frage zu hinterfragen und zu kritisieren – und nicht mich selbst.
Die richtige Frage wäre offener gewesen, natürlich, weniger binär und vor allem: behutsamer und wohlwollender.
Welche Funktion hat der Humor in deinem Erzählen? Du sparst Schmerz und Scheitern nicht aus, und doch lacht man bei der Lektüre ständig laut auf.
Beim Schreiben habe ich selbst ganz schön viel gelacht. Es stimmt, dass die meisten Ereignisse in meinem Roman nicht unbedingt heiter sind. Aber manchmal lässt sich Schmerz am wirkungsvollsten durch Humor ausdrücken, gerade wenn auch Scham im Spiel ist. Das erlaubt es einem, eine Sache und ihr Gegenteil zu behaupten, wodurch man als Autor zumindest ein wenig geschützt ist, während man die intimsten und schmerzhaftesten Geschichten erzählt. Meine Intention war zudem, Humor in einer Weise mit Queerness zu verbinden, die wir so vielleicht noch nicht kennen – kein Humor, der auf Kosten von Queerness geht, sondern queerer Humor.
„Das beste Buch, das ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe laut gelacht und war zugleich berührt.“
„Beißend, witzig und manchmal traurig, mit einem Touch Salinger.“
„Diese Geschichte respektiert keinerlei Konventionen, stellt mit souveräner und sehr souveräner Ironie alles auf den Kopf, worauf sich die Leute einigen, und lässt einen nach Luft schnappen.“
„Lakmaker ist wie ein guter Freund, mit dem man stundenlang über Sex, Fußball und das Leben reden kann.“
„Eine vielversprechende Nachricht für die Literatur: Hier ist Lakmaker. Gewöhnen Sie sich dran.“
„Wenn Sie mich fragen, stößt Lakmaker Sally Rooney vom Thron.“
„Ein Debüt, wie man es selten erlebt. Die Entdeckung einer ganz eigenen Stimme, voller Bravour und Mumm!“
„Lakmaker debütiert fulminant. Sie hat zu allem eine Meinung, übt ungeschminkt Kritik und hat keine Angst, sich offen und verletzlich zu zeigen.“
„›Die Geschichte meiner Sexualität‹ erzählt furchtlos von dem fließenden Übergang zwischen weiblich und männlich, von den Widersprüchen der eigenen Identität. Die fortdauernde Hin- und Her-Bewegung zwischen den Geschlechteridentitäten der Protagonistin stellt der Autor grandios dar. Eine unbedingte Leseempfehlung für diesen humorvollen und tiefgründigen Roman.“
„Dieser Debütroman hat das Zeug dazu, ein Hit zu werden.“
„Im Kern zart, voller Witz und Tiefe.“
„Wenn man an die Darstellung von Homosexualität in der Literatur denkt, dann schießen einem vielleicht mehr männliche als weibliche Namen ein, aber ganz bestimmt keine vergleichbar unbescheidene, filterlos-freche, lakonisch-unberechenbare Stimme, die alle paar Sätze unliebsame Wahrheiten auftischt á la ›Lesben haben immer Angst davor, Lesben zu sein‹ oder die solch freundlich-stichelndes Verlagsbashing betreibt. Das ist die große Qualität dieses Textes, denn das Recht dazu – und unsere Sympathie – erschreibt sich Tobi Lakmaker mit seiner Verwundbarkeit.“
„Humorvolle Anstöße, witzige Pointen, nachdenkliche Impulse in satten Farben. Ein charmanter Coming-Out-Roman.“
„Das schlagfertige niederländische Debüt von Tobi Lakmaker ›Die Geschichte meiner Sexualität‹ ist ein intimer Roman über die romantischen, sexuellen und intellektuellen Erfahrungen der Protagonistin Sofie Lakmaker.“
„›Die Geschichte meiner Sexualität‹ hat das Zeug zum Literaturereignis.“
„Der Ton des Buches nimmt die Leser*innen doch sehr mit. Also ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine geschätzte Zuhörerin.“
„Charmant-dreist und hinreißend zärtlich.“
„Spannend und jung, modern und reflexiv, divers und asynchron – diese und noch viele weitere Adjektive ließen sich finden, um Lakmakers aufregend-knallbuntes Debüt zu beschreiben.“
„Es gibt Bücher, deren Sound den direkten Weg ins Herz nehmen. ›Die Geschichte meiner Sexualität‹ ist genau so ein Buch. Tobi Lakmaker schreibt lakonisch und bis zur Selbstverletzung ehrlich.“
„Was mich als heterosexuelle cis-Frau an diesem Buch begeistert, ist der Erzählstil. Lakmaker nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht aus, was unseren Eltern - und vielleicht sogar uns - die Schamesröte ins Gesicht treiben würde. Dabei ist der Ton so wundervoll dreist, dass es eine erfrischende Abwechslung zur dagegen fast schon langweiligen Literatur darstellt. Ein Autor, der unglaublich viel Mut beweist! Eine Uni, mit der man niemals auf Exkursion gehen sollte! Ein Verlag, bei dem Beharrlichkeit auf ganz eigentümliche Weise belohnt wird! Und dazwischen immer wieder die Frage: Ab wann ist ein Mann ein Mann? Hervorragende Gratwanderung zwischen Komik und Dramatik!“
„Tobi Lakmaker sprengt mit seiner ganz eigenen, teils irritierenden, aber stets auf irgendeine Art berührende Erzählweise die Grenzen des althergebrachten literarischen Schreibens. Er bringt erzählerische wie thematische Frische hinein, sodass der staubige Begriff Entwicklungsroman hinter lebhafter queerer, fluider und Trans-Identität verblasst, obwohl es im Kern genau ein solcher ist.“
„Sehr junger und lebendiger Schreibstil. Humor und Ernsthaftigkeit gehen Hand in Hand, was für ein ausgeglichenes Lesevergnügen sorgt.“
„Die philosophische und gleichzeitig unmittelbare Sprache ruft die ganze Palette an Emotionen hervor - von schallendem Lachen bis hin zu Verzweiflungstränen.“
„Es sind ernste Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Doch ist es extrem lustig, der schluffigen Ich-Erzählung zu folgen.“
„Ein schönes Buch für jeden, der selbst auf der Suche ist – und für jeden, der mehr über die Facetten der Menschen lernen will.“
„Der Stil ist schnell, frisch, umgangssprachlich und gleichzeitig philosophisch. Es war als würde ich dem Autor beim Denken zuhören.“
„Okay, als ich den Autorennamen gesehen hab und dann, dass es um eine lesbische Frau geht, war ich SEHR skeptisch. Stellt sich aber raus: Das Buch ist autobiografisch, Tobi ist als Mädchen sozialisiert worden. PUH. Das Buch hat einen ganz eigenen Stil find ich, und ist super funny und super traurig, ohne wirklich „gefühlvoll“ zu sein, wenn das Sinn ergibt. Es liest sich super schnell und macht Spaß, nur zwischendurch hat es sich bissi gezogen find ich.“
„Ein verschachtelter Entwicklungsroman in seinem buchstäblichsten Sinn und ein charmantes Plädoyer für einen entspannten Umgang mit dem Erwachsenwerden, sexuellen Zuschreibungen und Rollenerwartungen, für eine diverse Gesellschaft reich an fluktuierenden Identitäten.“
„Die Lesenden sind insofern beständig vor die Frage gestellt, ob die Schilderungen beim Wort genommen werden sollen, was den Text zu einem grandios fadenscheinigen Stück Poesie verwandelt.“
„Flott niedergeschrieben – mitten aus dem Leben gegriffen, witzig, roh und direkt.“
»›Das ist das Leben: Hupen und Klingeln, weil nie klar ist, wer Vorfahrt hat, und alle ständig irgendwo hinmüssen.‹ Es sind Sätze wie dieser, die beim Lesen von „Die Geschichte meiner Sexualität“ innehalten und staunen lassen, dass es Tobi Lakmaker bereits mit Mitte zwanzig gelingt, Essenzielles derart simpel und präzise, ja fast weise, auf den Punkt zu bringen.«
„Sie/er erzählt überwiegend so persönlich, dass man sich dem schwer entziehen kann und zeigt dabei zugleich Perspektiven auf, die dem heterosexuellen Ottonormalbürger oft verborgen bleiben. Tobi Lakmakers ›Geschichte meiner Sexualität‹ ist nicht nur außerordentlich kurzweilig und unterhaltsam. Sie lässt den Leser auch mit einem Kloß im Hals zurück.“
„Als ich die letzte Seite von Tobi Lakmakers "Die Geschichte meiner Sexualität" gelesen habe, habe ich geweint. Eigentlich weine ich immer noch, während ich das hier schreibe. Ich zittere und habe keine Ahnung, wohin mit meinen ganzen Emotionen. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass ich während der Lektüre noch gelacht habe, dass ich die Geschichte umarmen wollte, weil sie mir von der ersten Seite an so viel gegeben hat, dass ich einzelne Sätze oder ganze Passagen ausschneiden wollte, um sie mir irgendwo in die Wohnung zu hängen, um sie jeden Tag zu lesen, weil sie einfach ein Gefühl, das du die ganze Zeit selbst schon hattest, aber nicht benennen konntest, auf den Punkt bringen oder so wunderschön sind, dass wohl der schönste Rahmen der Welt nicht gereicht hätte.“

















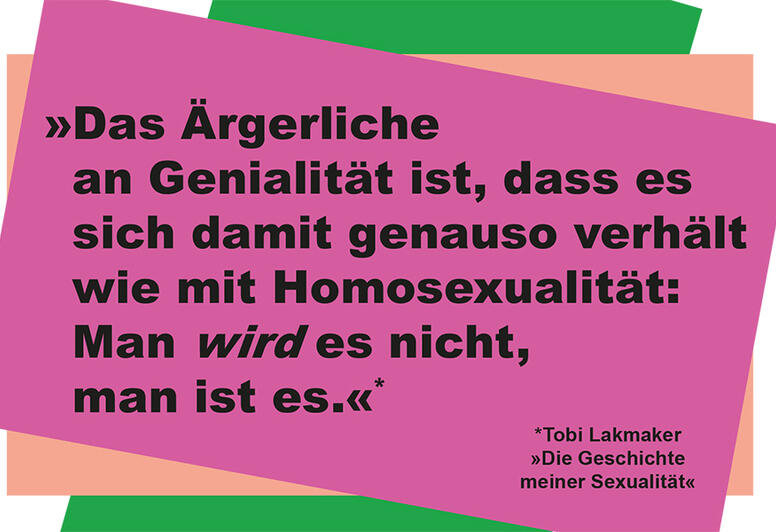

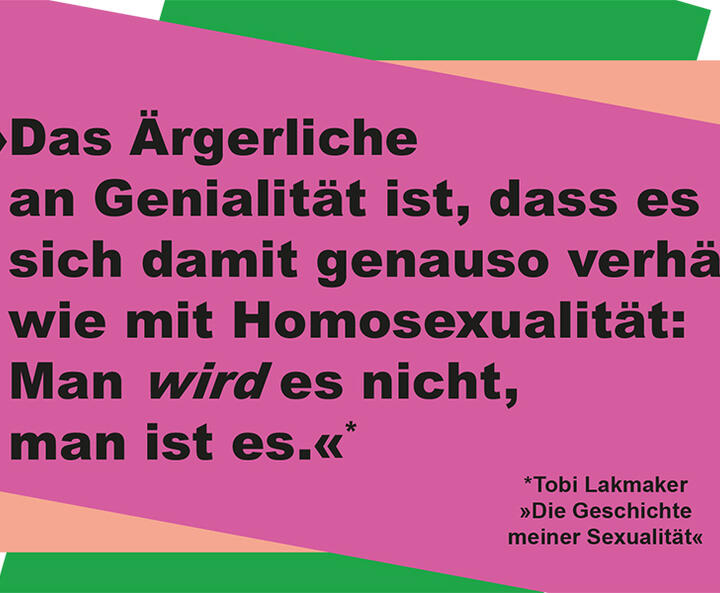




Auf diese Buch freue ich mich schon sehr. Die ersten Seiten die ich lesen konnte, haben mich gepackt. Der Herbst kann kommen.
DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.