

Die Krankenschwester von St. Pauli – Jahre des Aufbruchs (Die St. Pauli-Saga 3) Die Krankenschwester von St. Pauli – Jahre des Aufbruchs (Die St. Pauli-Saga 3) - eBook-Ausgabe
Roman
— Historischer Hamburg-RomanDie Krankenschwester von St. Pauli – Jahre des Aufbruchs (Die St. Pauli-Saga 3) — Inhalt
Das Schicksal einer Krankenschwester im Kultviertel St. Pauli
Svantje Claasen verbindet als Krankenschwester erfolgreich Beruf und Familie. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, meldet sie sich freiwillig an die deutsch-französische Front. Plötzlich findet sie sich auf feindlicher Seite wieder und muss fürchten, ihre Familie nie wiederzusehen.
Der dritte Band der aufwühlenden historischen Saga um Krankenschwester Svantje Claasen für Fans der Serien "Call the Midwife" und "Die Charité".
Rebecca Maly studierte Altskandinavistik und Runenkunde und war mehrere Jahre in Amerika und Deutschland als Drehbuchautorin beim Film tätig. Sie veröffentlichte eine Vielzahl an Romanen und wurde 2017 für "Die Schwestern vom Eisfluss" mit dem Delia-Preis ausgezeichnet.
Leseprobe zu „Die Krankenschwester von St. Pauli – Jahre des Aufbruchs (Die St. Pauli-Saga 3)“
1. Hamburg, Eppendorfer Klinikum 8. August 1914
Svantje war fassungslos.
„Ich bleibe keinen Tag länger im Krankenhaus!“, wiederholte Friedrich energisch und klemmte sich die Krücken in die Armbeugen. Er ging so schnell voraus, dass Svantje ihn nicht mehr vor einem Sturz hätte bewahren können, falls er seine Kraft überschätzte.
Friedrich bleckte die Zähne. Es musste entsetzlich wehtun, doch er unterdrückte jeden Schmerzenslaut. Sie konnte es kaum mit ansehen.
„Du hast drei gebrochene Rippen, du kannst nicht mit Krücken gehen“, protestierte sie, wohl wissend, [...]
1. Hamburg, Eppendorfer Klinikum 8. August 1914
Svantje war fassungslos.
„Ich bleibe keinen Tag länger im Krankenhaus!“, wiederholte Friedrich energisch und klemmte sich die Krücken in die Armbeugen. Er ging so schnell voraus, dass Svantje ihn nicht mehr vor einem Sturz hätte bewahren können, falls er seine Kraft überschätzte.
Friedrich bleckte die Zähne. Es musste entsetzlich wehtun, doch er unterdrückte jeden Schmerzenslaut. Sie konnte es kaum mit ansehen.
„Du hast drei gebrochene Rippen, du kannst nicht mit Krücken gehen“, protestierte sie, wohl wissend, dass sie ihrem Mann kaum etwas austreiben konnte, wenn er es sich erst einmal in den Kopf gesetzt hatte.
Friedrich schwankte, dann tat er einen Schritt und noch einen. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn, er war blass, die grünen Augen glänzten fiebrig. „Es geht“, keuchte er.
Svantje trug seine Tasche und öffnete die Tür.
„Ich kann Vater nicht mit alldem alleinlassen“, verkündete er entschlossen. „Lager und Büros sind völlig verwüstet.“
„Das spielt keine Rolle, Friedrich! Dein Vater hätte beinahe seinen Sohn verloren! Du wärst fast gestorben. Was diese Gauner angerichtet haben, lässt sich wieder reparieren.“
„Womit er zweifellos bereits angefangen hat.“ Er blieb stehen, schwer auf die Krücken gestützt. Svantje stellte die Tasche ab, sah ihrem Mann tief in die Augen und legte eine Hand an seine Wange. „Ich weiß, wie schwer es dir fällt, zum Nichtstun verurteilt zu sein. Aber wir haben Krieg, der Handel ruht. Du hast Zeit, gesund zu werden.“
Friedrich drückte ihre Hand. „Ja, du hast vermutlich recht. Und wenn es stimmt, was die Militärs behaupten, ist der Krieg schon in einigen Wochen vorüber. Gehen wir also nach Hause. Denn wenn du mich auch überzeugt hast, nicht in die Firma zu fahren, so bleibe ich trotzdem nicht im Krankenhaus!“
Seit seiner Einlieferung waren nur sieben Tage ins Land gegangen, doch für Svantje fühlten sie sich an wie eine kleine Ewigkeit. Neben der Angst um ihren Mann und der Sorge um ihre beiden gemeinsamen Kinder war sie regelmäßig zu ihrem Dienst als Krankenschwester im Eppendorfer Klinikum erschienen. Sie klammerte sich an Beruf und Familie gleichermaßen, denn die Welt um sie herum schien den Verstand verloren zu haben.
Krieg. Er war nun allgegenwärtig.
Während sie in einer Mietsdroschke heimfuhren, sahen sie Soldaten auf den Straßen. Junge Männer standen in langen Schlangen an, um sich freiwillig an die Front zu melden. Sie redeten sich die Köpfe heiß, die Begeisterung war ihnen anzusehen.
Am Tag nach dem Überfall auf Friedrichs Lager hatte Deutschland auch Belgien, von dem es zuvor immer hieß, es sei unbeteiligt, ein Ultimatum gestellt. Das Land hielt weder zur Triple Entente Russland, England und Frankreich noch zum Dreierbund aus Deutschem Reich, Österreich-Ungarn und Italien. Luxemburg wurde besetzt, sodass sich Deutschland fast auf ganzer Länge Frankreich gegenübersah. Am 3. August bombardierten die Franzosen Nürnberg, und am 4. marschierten deutsche Soldaten in Belgien ein.
Fast jeden Tag folgte nun eine neue Kriegserklärung. Erst erklärte Großbritannien dem Kaiserreich den Krieg, dann Österreich-Ungarn Russland.
„Heute hat Großbritannien Österreich-Ungarn den Krieg erklärt“, sagte Svantje mit einem lähmenden Gefühl in der Brust.
„Das hatte ja so kommen müssen.“ Friedrich nahm ihre Hand und hielt sie fest. Drückte sie.
„Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr klar denken, Liebster. Deutschland ist von Feinden umzingelt, und wir sind mittendrin. Was soll nur werden?“
„Es geht immer irgendwie weiter“, sagte er, stoisch wie ein Fels in der Brandung. Nicht zuletzt dafür liebte sie ihn. Er gab ihr Halt, wenn sie glaubte, von den Wogen davongerissen zu werden. „Wir haben doch bislang alles durchgestanden, gemeinsam.“
„Aber das waren friedliche Zeiten, nun versinkt alles in Wahnsinn.“ Svantje blickte ihn lange an. „Dennoch … du ahnst gar nicht, wie viel mir deine Worte bedeuten.“
Die Kutsche hielt vor ihrem Haus. Die weiße, trutzige Fassade der kleinen Villa kam ihr wie eine Burg vor, und genau das brauchte sie jetzt. Eine Festung, die ihre kleine Familie beschützte. An einem Fenster erkannte sie zwei vertraute Gesichter. „Schau, du wirst schon sehnlichst erwartet.“
Friedrich sagte nichts, sondern winkte seinen Kindern, bevor er ausstieg. Als er den ersten humpelnden Schritt tat, nachdem er den Kutscher entlohnt hatte, flog die Tür auf, und Clemens stürmte heraus. Mit seinen fünfzehn Jahren war er ein ungestümes Abbild seines Vaters. Der Junge besaß nicht nur dessen edel geschnittenes Gesicht, sondern auch das dunkle Haar und die grünen Augen.
Auf Friedrichs Miene breitete sich väterlicher Stolz aus und überdeckte einen Moment lang die tiefen Furchen, die der Schmerz gegraben hatte. Die Blässe blieb.
„Vorsicht, Clemens, dein Vater hat Schmerzen.“
Der Junge hielt inne und sah fragend zum Vater, der ihn nur noch um einen halben Kopf überragte. Es musste merkwürdig für ihn sein, den Beschützer der Familie plötzlich schwach zu sehen. Clemens nahm Svantje den Koffer ab. „Den kann ich tragen“, sagte er und trug das Gepäckstück mühelos die Stufen hinauf.
In der offenen Tür stand Karoline. Wie schnell sie doch groß werden, dachte Svantje. Ihre Tochter war mit ihren neunzehn Jahren ein richtiges junges Fräulein. Das blonde, dichte Haar fiel ihr bis zur Hüfte und sah aus wie frisch gekämmt. Das war es sicherlich auch. Svantje war überzeugt, dass ihre Tochter die letzte Stunde mit Putz verbracht hatte.
Eitelkeit hieß Svantje nicht gut. In Karolines Alter hatte sie keine Zeit dafür gehabt, längst waren die Tage mit Arbeit angefüllt gewesen. Da die Mutter oft bis zur Abenddämmerung schuftete, wurde von der ältesten Tochter erwartet, dass sie sich neben der Anstellung im Krankenhaus um die kleinen Geschwister kümmerte, den Haushalt besorgte und Essen kochte.
Karoline kannte derlei Sorgen nicht. Im Haus der Falkenbergs gab es zwei Angestellte, die alles erledigten. Sie hatte noch nie gearbeitet, sondern die vergangenen Jahre eine Schule für höhere Töchter besucht. Nun bekam sie privaten Unterricht. Karoline wirkte noch ein wenig unentschlossen, wie ihre Zukunft aussehen sollte. Einerseits war sie eine intelligente junge Frau, die jegliches Wissen in sich aufsog wie ein Schwamm, doch darin lag auch das Problem. Es gab so viele Möglichkeiten. Ihre Freundinnen von der Schule wünschten fast alle, den klassischen Weg zu gehen, träumten von Ehe und Familie. Von ihnen hatte Karoline auch ihre Begeisterung für Kleidung und Putz, denn viele der Mädchen kannten nur dieses Thema.
Dennoch erkannte sich Svantje in der Willenskraft und dem Wissensdurst ihrer Tochter selbst wieder, und sie hoffte, dass Karoline eines Tages einen Weg einschlagen würde, der ihr ein selbstbestimmtes und sinnvolles Leben ermöglichte.
Svantjes eigenes Leben hatte bereits im Alter von zwölf Jahren völlig anders ausgesehen. Damals war sie mit der Mutter und dem sechs Monate alten Bruder Piet nach Hamburg gekommen. Der Vater verdiente als Hilfsarbeiter in einer Werft kaum genug, um seine Familie durchzubringen, und so war Svantje mit einem Handkarren losgezogen, um Wasser zu verkaufen, das sie aus einem Brunnen schöpfte. Erst als die Mutter ebenfalls eine Arbeit fand, war genug Geld vorhanden gewesen, damit Svantje wieder zur Schule gehen konnte.
Sie war froh, dass ihren Kindern dieser Erfahrung erspart blieb, andererseits verstanden die beiden nicht, wie privilegiert sie tatsächlich waren.
Karoline zupfte am Rüschensaum ihres Ärmels. Das veilchenfarbene Kleid war ihr ganzer Stolz. Zögernd umarmte sie den Vater und hielt ihm die Tür auf.
„Mein wunderschönes Mädchen“, sagte der und strich ihr über die Wange. Svantje wurde das Herz leicht. Da war er, der vollkommene Moment, während die Welt drumherum im Chaos des Krieges versank.
Eine Stunde später saßen sie gemeinsam an der Kaffeetafel. Friedrich blätterte mit fiebrigem Blick durch die aktuelle Zeitung. Zwischen ihm und Svantje lag die gefaltete Ausgabe vom 5. August. Clemens reckte sich, um den riesig gedruckten Titel auf den Hamburger Nachrichten zu entziffern. „Was steht da, Mama?“
„Lies doch selbst“, erwiderte sie und reichte ihm das drei Tage alte Blatt.
„Welten…brand“, murmelte er. „Und was bedeutet das?“
„Na, dass die Welt brennt, du Hanswurstgesicht.“
„Karoline! Ich möchte nicht, dass du so mit deinem Bruder sprichst“, tadelte Svantje. Das Wort aus dem Mund ihres Sohnes zu hören hatte sie innerlich zusammenfahren lassen. Weltenbrand. Sie ahnte, dass es nicht nur ein reißerischer Aufmacher war, sondern eine Ankündigung dessen, was sie alle erwartete.
„Aber die Welt brennt doch gar nicht, und unsere Soldaten werden diese Franzosen im Handumdrehen besiegen“, protestierte Clemens, drückte den Finger auf die Seite und las weiter: „Hier steht: ›Kurz nach 7 Uhr erschien der englische Botschafter Goschen auf dem Auswärtigen Amt, um den Krieg zu erklären und seine Pässe zu fordern.‹ Das verstehe ich nicht. Wofür braucht er denn den Pass, um Krieg zu führen?“
Friedrich musterte seinen Sohn mit schwerem Blick. „Zum Ausreisen, Junge. Ein Botschafter ist dazu da, den Frieden zwischen den Ländern zu bewahren. Doch im Krieg wird er nicht mehr gebraucht. Also will er jetzt seinen Pass, um nach Hause zurückkehren zu können.“
„Ach so.“ Clemens runzelte die Stirn und grinste schief. „Dann hätte er wohl besser nicht den Krieg erklärt, wenn er länger bleiben wollte.“
Friedrich musste trotz des ernsten Themas schmunzeln, ging aber auf den Scherz seines Sohnes nicht ein. „Ich denke nicht, dass Herr Goschen eine Wahl gehabt hat.“
Sein Blick traf Svantjes, und sie gaben einander still ein Versprechen: dass sie alles dafür tun würden, um ihre kleine Familie zu beschützen.
***
Es würde ein heißer Tag werden, aber noch stieg stickige Feuchte aus den Fleeten und wehte vom Hafen durch enge Straßenzeilen. Nachtwächter löschten die Gaslaternen, und das Grau der Nacht machte dem gelblichen Schimmer des heraufziehenden Morgens Platz.
Raik hatte sein Haus früh verlassen. Seine Frau lag sicher noch in den Federn, und sein Ziehsohn Jonte redete vielleicht im Traum. Das tat er oft, besonders seitdem er seine Lehrstelle bei einem Möbeltischler begonnen hatte. Früher hatte Raik manchmal Stunden damit verbracht, an Jontes Bett zu sitzen und zuzuschauen. Er war richtig vernarrt in den Jungen, der mit seinen beinahe sechzehn Jahren nun langsam zum Mann heranreifte. Wie so oft hatte Raik auch heute die Zeit gefunden, ihn einige Augenblicke im Schlaf zu beobachten und ihm das dunkle Haar aus der verschwitzten Stirn zu streichen.
Das Familienleben war auch nach zwölf Jahren ein hohes Gut für ihn. Zwar mangelte es ihm nicht an leiblichen Kindern, doch er hatte noch nie mit ihnen zusammengelebt und tat es auch jetzt nicht.
Seit vielen Jahren führte er eine leidenschaftliche Affäre mit Hilde Degen, geborene Harkenfeld, die im Augenblick sein viertes Kind in sich trug. An dieser Liaison hatte auch seine Ehe mit der Witwe Johanna Stade nichts ändern können. Obgleich er Johanna verehrte, blieb die Anziehungskraft, die Hilde auf ihn ausübte, ungebrochen.
Doch seine erste, aber unerwiderte Liebe war Svantje gewesen. Keine hatte jemals an sie heranreichen können, nicht einmal seine Ehefrau.
Er lebte also weder mit seinen leiblichen Kindern zusammen noch mit der Frau, die einst den größten Platz in seinem Herzen besetzte. Und doch hatte er sich bis vor wenigen Tagen einen glücklichen Mann genannt.
Nun lag der Krieg wie ein Schatten über allem, auch wenn Hamburg selbst noch unberührt war. Raik zog die Schultern hoch, schob die Hände in die Hosentaschen und lief schneller. Längst waren die Zeiten vorbei, als er jeden Morgen und Abend auf eine Fähre angewiesen gewesen war, die ihn auf die andere Hafenseite zur Werft in Steinwerder brachte. Der Tunnel unter der Elbe war 1911 eröffnet worden.
Raik erreichte die Landungsbrücken. Morgensonne schimmerte rötlich auf dem Kuppelbau, unter dessen Dach es in die Tiefe ging. Schon bald würden sich die Arbeiter hier dicht an dicht drängen, doch er war so früh unterwegs, dass er nur fünf andere vor sich hatte. Leichtfüßig trabte er die Treppe hinunter und strich beiläufig über die Zierkacheln an den Wänden. Der Aufzug, mit dem Automobile, Fuhrwerke und Handkarren in die Tiefe transportiert wurden, ratterte und quietschte. Die Fahrzeuge hatten ihn vom ersten Tage an fasziniert, doch in den langen Tunnelröhren war vor allem ihr Gestank gegenwärtig. Raik hätte den Mief liebend gerne gegen Pferdeschweiß und Mist getauscht, das roch zwar auch nicht gut, aber es zog einem nicht die Lungen zusammen.
Die hellen Kacheln des Tunnels hatten unter der Decke Ruß angesetzt, der immer seltener entfernt wurde. Der einstige architektonische Stolz der Stadt wurde mit den Jahren zu etwas Gewöhnlichem.
In regelmäßigen Abständen waren in Kopfhöhe große Zierkeramiken angebracht, viele zeigten Fische und erinnerten den Vorbeilaufenden daran, dass sich über ihm gewaltige Wassermassen befanden. Riesige Frachtkähne, Schaufelraddampfer, Jollen, schwerfällige Barken und elegante Segler zogen über ihnen dahin. Der Elbtunnel war eine Meisterleistung der Ingenieurskunst und flößte Raik großen Respekt ein. Für ihn war der Bau eines der Wunderwerke Hamburgs.
Schnellen Schrittes überholte er einige andere Arbeiter und eine ältere Frau mit einer schwer beladenen Kiepe auf dem Rücken. „Moin, Frau Wede“, grüßte er und tippte sich an die Kappe. Sie winkte ihm, und schon war er vorbei. Die Witwe Wede kannte er bereits seit Jahren. Niemand machte bessere Pasteten und Teigtaschen. Sie bereitete sie in der Nacht vor und verkaufte sie dann am Morgen vor den Werken an die Arbeiter. Zwar war nur wenig Fleisch in der Füllung, aber sie waren gut und würzig und machten satt.
Auf der anderen Seite erklomm er zügig die Stufen, nahm immer zwei auf einmal. An der Oberfläche empfing ihn grelle Morgensonne. In der Luft hing der scharfe Geruch von erhitztem Stahl. Hämmer dröhnten. Gewaltige, dampfgetriebene Sägen sorgten für ein monotones, gleichbleibendes Hintergrundgeräusch.
Zwei große Werke und einige kleine lagen zwischen der Harkenfeld-Werft und dem Ausgang des Elbtunnels.
Vor dem Werkstor warteten bereits drei hoch beladene Pferdewagen. Sie lieferten, was bei Harkenfeld nicht selbst hergestellt wurde. Tonnenweise Niete und Bolzen, gegossene Metallteile und Planken.
Raik drückte sich an ihnen vorbei und wandte sich nach rechts. Vorbei an der gewaltigen Halle 1, vorbei an Schiffsskeletten aus Stahl. Sein Reich befand sich in Halle 2, nur ein Sechstel so groß wie die benachbarte. Das Tor stand bereits auf. Holzduft umfing ihn wie eine freundliche Umarmung.
„Ah“, seufzte er und ließ seinen Ranzen von der Schulter gleiten. Der enthielt neben seinem besten Kleinwerkzeug frisches Brot, ein Stück Käse, Speck und zwei Äpfel. Genug, um auch den anstrengendsten Tag zu überstehen.
Raik war einer von drei Meistern, die in Halle 2 Dienst taten. Sie fertigten Kapitänsbrücken, Taljen und Blöcke, überarbeiteten Masten und Bäume, stellten Einzelteile her und statteten Kojen mit hochwertigen Möbeln und Maßanfertigungen aus. Raik liebte diese Arbeit, denn jedes Schiff war ein klein wenig anders. Die Holzarbeiten mussten stets angepasst und individualisiert werden. Seitdem er seinen Meistertitel besaß, konnte er die eintönigeren Aufgaben an Gesellen und Helfer abgeben.
An diesem Morgen war es in der Halle überraschend still. Dabei fingen viele Kollegen früh an, da sich der Bau in der Sommersonne schnell aufheizte.
Raik winkte einen Jungen zu sich, den er vor einigen Monaten von der Straße aufgelesen und als Helfer eingestellt hatte. Die Entscheidung hatte er nicht bereut. Dafür, dass er ein Dach über dem Kopf bekommen hatte, ackerte der zehnjährige Klaas von früh bis spät und versuchte zu helfen, wo er konnte. Raik steckte ihm ein Stück Rührkuchen zu, das vom Vortag übrig war. „Da hest du.“
„Dank ok, Meester“, nuschelte er und biss gierig hinein. Der Junge hatte Augen wie der Julihimmel, Sommersprossen und blonde, dichte Locken, die seinen Kopf aussehen ließen, als wüchsen dort Hobelspäne.
Raik sah zu, wie Klaas Bissen um Bissen herunterschlang und dabei kaum eine Pause machte. Es war, als würde er in einen Spiegel sehen, der ihn viele Jahre zurücktrug. Auch er hatte auf der Straße gelebt, bis ihm das Schicksal in Svantjes Vater einen guten Samariter gesandt hatte. Dem Alten verdankte er alles. Seinetwegen war er kein Gauner geworden, sondern ging ehrlicher Arbeit nach.
„Wo sind alle?“
„Oh.“ Klaas fuchtelte mit einer Hand.
„Schluck erst mal, Jung“, sagte Raik schmunzelnd.
Der wischte sich mit dem dreckigen Ärmelsaum über den Mund. „Weten Se nich Bescheed? Olav geiht nu Russen erschießen und Derk ok.“
„Die haben sich freiwillig gemeldet? Twee Gesellen? Und sind zu feige, mir das ins Gesicht zu sagen?“
„Hebben se wirklich nix vertellt?“ Der Junge runzelte die Stirn und aß das letzte Stückchen Kuchen, dann leckte er sich die Finger. „Vielleicht hatten se Schiss, Meester. Die weten ja, wie Se zum Krieg stehen. Jeder weet hier, dass se mit den Sozialisten bei den Franzosen waren.“
„Um mit unseren Brüdern eine friedliche Lösung zu suchen.“
„Dass Se de Franzlüü Brüder nennen, sollten Se aber keenen hören lassen.“
Raik tat so, als wolle er Klaas eine Kopfnuss verpassen. Der duckte sich und lachte. Er hatte den ehemaligen Straßenjungen noch nie lachen gehört, und so bekam diese Situation trotz ihrer Schwere etwas Heiteres.
Gemeinsam mit anderen Gewerkschaftlern und Vertretern der Sozialistischen Partei war Raik knapp fünf Wochen zuvor nach Paris gereist, um eine friedliche Lösung für den schwärenden Konflikt zwischen den Ländern zu suchen, eine, die von der linken Arbeiterschaft getragen wurde. Doch es war alles umsonst gewesen, die nationalistischen Kräfte hatten gesiegt.
Tage nach dem Attentat von Sarajevo waren die Menschen in allen Großstädten des Kaiserreichs auf die Straße gegangen, um für den Frieden zu demonstrieren. Hunderttausende. Auch Svantje und ihr Friedrich waren dort gewesen. Das war nach Raiks Rückkehr aus Paris. Sie hatten sich nur kurz gesehen, dann trennten sich die Gruppen von Bürgern und Arbeitern wieder. Das war auch gut so gewesen, denn Raik und seine Jungs waren nach Auflösung der Kundgebung noch mit den Nationalisten aneinandergeraten. Als Feiglinge und Vaterlandsverräter waren sie beschimpft worden, hatten es erst eine Weile erduldet und den Bürschchen dann bewiesen, dass die linke Arbeiterschaft ordentlich austeilen konnte.
Was hätte er nur dafür gegeben, wenn die Staatsoberen ihre Großmachtsfantasien statt mit Haubitzen mit Fäusten ausgetragen hätten.
„Un wat nu, Meester?“
Raik zog sich die Kappe vom Kopf und schlug sie gegen den Oberschenkel. „Jetzt schauen wir, wie wir de Arbeid auch ohne diese beiden Dööskoppen gestemmt bekommen.“
Belgien, Provinz Limburg Anfang August 1914
Der Krieg mit Belgien war von der Obrigkeit als eine Nebensache abgetan worden. Nicht mehr als ein Scharmützel, ein Fliegenschiss verglichen mit der erwarteten Konfrontation mit Frankreich. Sie sollten durchmarschieren, kaum auf Widerstand stoßen, die Grenze überwinden und rasch Geländegewinne machen, bevor sie auf die massiv befestigten Städte trafen. Frankreich sollte bezwungen werden, bevor der Krieg mit Russland erst richtig begonnen hatte, damit das Kaiserreich sich nicht in einem Zweifrontenkrieg aufrieb. Wäre es nach dem Schlieffen-Plan gegangen, hätten sie jetzt bereits vor Paris gestanden. Aber dort waren sie nicht. Tatsächlich waren sie noch nicht einmal in Frankreich.
Ohne sein Pferd anzuhalten, nahm Richard eine Röhre aus seiner Satteltasche, zog eine Karte aus gewachstem Papier heraus und rollte sie auf dem Mähnenkamm seines Wallachs auseinander. Sie befanden sich auf einer schnurgeraden Straße irgendwo im kaum besiedelten Nirgendwo Belgiens. Eichen säumten in regelmäßigen Abschnitten beide Straßenseiten. Die Felder waren abgeerntet, das Gras sommertrocken, gelb und kurz, die Begleitgräben sauber und ausgeräumt. In der Luft schwirrten Fliegen, träge taumelten Schmetterlinge umher, Bremsen plagten Männer und Pferde.
Hier konnte vermutlich nicht einmal eine Maus einen Hinterhalt legen.
Sie waren bislang kaum auf Widerstand gestoßen, so weit hatte sich der Plan Schlieffens immerhin als richtig erwiesen.
Richards Dragoner bildeten gemeinsam mit Pionieren die Vorhut. Ständig sandte er Kundschafter aus, und stets kehrten sie ohne beunruhigende Meldungen zurück. Noch. Richard fühlte sich, als bohrten sich Blicke wie Nadelstiche in seinen Rücken. Sein Wallach blieb ruhig, alle anderen Pferde ebenfalls. Das hieß, bis auf die ständig schlagenden Schweife und zitternden Flanken, mit denen sie versuchten, die Stechinsekten abzuwehren. Die Dragoner, anfangs schweigsam, plauderten nun, als befänden sie sich auf einem Ausritt.
„Das ist kein Sonntagsausflug, Männer“, mahnte Richard, rollte seine Karte zusammen und trabte an, bevor er sie ganz im Futteral verstaut hatte.
Die neue, feldgraue Uniform kratzte, wo sich Schweiß im Kragen festgesetzt hatte. Im leichten Sitz rieb er sich den Nacken. Das Pferd passierte Feldgeschütze, die flammend in der Sommersonne glänzten, da sie brandneu waren. Zu glänzend, zu neu, dachte Richard. Am Abend würde er Weisung geben, sie zu tarnen. Spätestens wenn sie nicht mehr gut sichtbar über offene Felder zogen, konnten sie es sich nicht mehr leisten, Spiegelsignale an den Feind zu senden.
Von dem sogenannten Feind hatte er bislang allerdings kaum etwas gesehen. Belgien war neutral gewesen, bis das Deutsche Kaiserreich den Krieg erklärt hatte. Der Durchmarsch war eine Notwendigkeit, um Frankreich so hart wie möglich zu treffen. Die Zivilbevölkerung floh, und soweit es die Meldungen zeigten, gab es auch seitens der Armee keinen nennenswerten Widerstand.
Während viele seiner Dragoner sich bereits in Frankreich sahen, erwartete Richard bald eine Änderung. Solange es von Belgien keine Kapitulation gab, würden sie kämpfen. Und sie mussten es bald tun. Richard ging davon aus, dass sich die belgische Armee nicht kampflos zurückziehen würde, sondern für eine große Gegenoffensive sammelte.
Vier Kundschafter kehrten in einem gemütlichen Galopp zurück. Die Pferde sollten geschont werden, solange es möglich war. Richard machte sich keine Illusionen. In einer offenen Feldschlacht wären sie Kanonenfutter.
Die Männer salutierten. Ihr Bericht war kurz. In zwei Kilometern würden sie auf ein Dorf treffen. Es gab mehrere Bauernhöfe, von Mensch und Vieh keine Spur. Dort würden sie Quartier nehmen und die Pioniere die Überquerung eines kleinen Flüsschens für den Hauptteil der Armee vorbereiten.
Es dämmerte, als sie den Ort erreichten. Richard ritt mit seinen Dragonern an den zugewiesenen Platz, teilte Aufgaben ein und kümmerte sich dann selbst um sein Pferd, auch wenn er es nicht musste. Die Soldaten bauten Zelte auf, viele beschlossen, in der lauen Augustnacht darauf zu verzichten und unter dem spätsommerlichen Sternenhimmel zu schlafen.
Schließlich betrat Richard das verlassene Wohnhaus, das ihm und vier anderen Männern des Stabs als Quartier zugeteilt worden war. Um neun war Lagebesprechung, bis dahin hatte er Zeit.
Zögernd nur betrat er das fremde Heim, das die Eigentümer in aller Hast verlassen hatten. Die gute Stube sah nicht anders aus als eine deutsche. Es roch nach Herdfeuer, angebratenen Zwiebeln und Speck. Die Menschen hatten ihr Heim so verlassen, wie sie es wiederfinden wollten. Richard betrachtete Fotografien auf einem Kaminsims. Ein junges Paar, das scheu in die Kamera lächelte. Daneben dasselbe Paar, die Gesichter ernster, vom Leben gezeichnet, aber glücklich. Die Frau hielt einen Säugling auf dem Arm, vor ihnen aufgereiht standen drei Kinder, die Tochter mit einem Puppenwagen, der ältere Sohn mit einem Welpen an der Leine.
Draußen begannen jämmerliche Schreie. Richard zuckte zusammen, seine Schultern verkrampften, die Hand ging zur Waffe. Dann erinnerte er sich wieder, dass die Pioniere Schweine gefunden hatten, die von den Bauern in einem nahen Erlenbruch versteckt worden waren.
Sie würden gut essen heute Abend.
Die Schreie ebbten einer nach dem anderen ab. Wenn nur ein paar Schweine fehlten, nachdem die Armee durchgezogen war, konnten sich die Bauern glücklich schätzen. Noch war der Krieg jung und die Soldaten nicht verroht.
Richard sah sich in dem Haus um, während an den Fenstern Schwalben vorbeizischten wie kleine rauchfarbene Geschosse. Er entdeckte das Elternschlafzimmer, jenes, in dem alle Kinder die Nächte verbrachten, und schließlich ein sehr kleines, dem der Geruch des Alters anhaftete. Er lud sein Gepäck ab und riss das Fensterchen auf. Hier würde er schlafen. Er kannte den Stab nicht und erlaubte sich den Luxus, ein Zimmer zu wählen, das er nicht teilen musste. Er setzte sich auf das schmale Bett. Gestärkte Spitzenwäsche, ein Nähkorb daneben. Vermutlich hatte hier die Großmutter ihren Platz gehabt.
Den Blick aus dem Fenster gerichtet, nahm Richard sein Schreibzeug hervor und dachte an seine Heimatstadt Hamburg.
Er zögerte, dann schrieb er:
Verehrter Freund Arnd,
Arnd war ein falscher Name, doch er wagte nicht, den richtigen zu verwenden. Wassili und er hatten sich schon Monate zuvor auf diese kleine Finte geeinigt.
Von draußen hörte er seine Männer scherzen und tief lachen, ein wenig unsicher vielleicht, nervös. Darüber trug der Sommerwind den Duft von Erde, Heu und, heimlich darunter verborgen, Schweineblut herein. Der metallische Atem des Krieges schickte einen Vorboten.
Nun finden wir uns auf den unterschiedlichen Seiten eines Spiegels. Ich fürchte, es wird für eine lange Zeit so bleiben, und wünsche Dir alles Gute. Der Besuch bei Deinen Verwandten kam genau zum rechten Zeitpunkt, meine ich. Hoffentlich nutzt Du die Gelegenheit, länger zu bleiben und alte Bande zu vertiefen.
Das Schicksal findet mich im Norden von Belgien, in einem winzigen Örtchen, dessen Name Dir nicht geläufig sein wird. Noch fliehen Volk und Armee vor uns, doch ich fürchte und ersehne zugleich den Tag, an dem wir auf den Feind treffen. Schon jetzt zermürbt es mich. Die Ungewissheit ist schlafraubend, die Männer sind gereizt, und mit jedem Kilometer werden sie unaufmerksamer, da hilft all mein Mahnen nichts …
Ein Geräusch, so leise, dass er es kaum hörte und es mehr wie ein Zupfen in seinem Bauch zu spüren war, ließ ihn innehalten. War das ein Schuss? Ein ferner Kanonenschlag? Richards Hals war plötzlich ganz trocken. Er stand auf, trat ans Fenster und sah nur Feld um Feld. Er schluckte. Dachte an Wassili, den Russen, einen Mann, dem wider allen Anstands sein Herz gehörte.
Ein weiteres Hindernis war zwischen ihnen erwachsen. Zusätzlich zur Heimlichkeit, zusätzlich zur Widernatur ihrer Empfindungen. Nun waren sie auch noch Feinde, denn Deutschland und Russland waren im Krieg. Was konnte noch hinzukommen? Falls das Schicksal noch eine weitere Feindseligkeit ersinnen könnte, sie würden sie zu spüren bekommen, das war gewiss.
Richard faltete den angefangenen Brief zusammen, packte sein Schreibutensil und verstaute es. Noch einmal sah er aus dem Fenster und spähte nach Feindesbewegungen, doch das Land war wie ausgestorben. Still, zu still, selbst die Schwalben schwiegen.
Der Angriff kam am frühen Morgen. Schüsse aus dem Hinterhalt. Wachposten fielen, bevor überhaupt klar war, woher die Waffen abgefeuert wurden.
Richard, bereits dabei, sein Pferd zu satteln, zurrte hastig die Gurte fest und ritt mit zwanzig Dragonern los. Als er sich dem Flüsschen näherte, an das der Bauernhof angrenzte, war alles in wildem Aufruhr. Sechs tote Pioniere lagen im Gras, zwei weitere bluteten, saßen aber aufrecht. Einer war schlohweiß, stotterte und wies mit ausgestrecktem Arm auf die andere Uferseite. Dort flüchteten vier Männer zu Fuß. Zwei Pioniere waren ihnen auf den Fersen. Auf dem frisch gepflügten Feld erschwerten die Erdschollen den Lauf.
Ehe Richard den Befehl geben konnte, preschten seine Männer bereits durch die Furt, das Ufer hinauf und im vollen Galopp hinter den Flüchtigen her. Säbel blitzten in der aufgehenden Sonne. Blutrot.
Eine Falle, schoss es Richard durch den Kopf. Er sah seine Männer schon in Sperrfeuer geraten. Sie waren vor belgischen Heckenschützen und französischen Sondereinheiten gewarnt worden. Doch es geschah nichts. Die Reiter überholten die Pioniere, wurden von ihnen angefeuert und verkürzten die Distanz zu den Flüchtenden blitzschnell.
Als Richards Wallach die Uferböschung hinaufsprang, fächerten die Reiter auf und griffen an. Es war ein wildes Hacken und Stechen. Kein einziger Schuss fiel.
Als Richard den Schauplatz erreichten, machten seine Männer Platz. Ihre Wangen waren gerötet, in den Augen blitzte eine Mordlust, die er so noch nie an ihnen bemerkt hatte. Zwischen den Hufen beinahe panischer Pferde lagen die verrenkten Körper von vier Belgiern. Der Kleidung nach zu urteilen Zivilisten.
Richard sprang aus dem Sattel. „Gelände sichern“, rief er, nicht erwähnend, dass die Männer seine Order nicht abgewartet hatten. Er drehte einen der Toten um und schrak zurück. Vierzehn, fünfzehn Jahre vielleicht. Sommersprossen, kindliche Züge, ein dünnes Bärtchen aus einzelnen Haaren, halber Flaum noch. Zu seinen Füßen lag ein Junge, der niemals erwachsen werden würde. In seiner Schulter klaffte ein blutiger Spalt, im Arm ein weiterer.
Auch die anderen Kämpfer nur Kinder. Das waren keine Franc-tireurs, Mitglieder des französischen Freikorps oder belgische Partisanen, vor denen sie gewarnt worden waren.
„Als hätten sie heimlich die Gewehre ihrer Väter genommen“, sagte ein Dragoner erschüttert. Er hielt seinen Säbel noch in der Hand. Von der Klinge tropfte Blut auf die taufeuchte Erde.
Vielleicht war genau das geschehen. Jugendlicher Leichtsinn, der nicht einsehen wollte, dass die Erwachsenen die Höfe dem Feind kampflos überließen. Richard fühlte betäubende Kälte in sich einkehren. Er begrüßte sie, denn sie würde ihm helfen zu ertragen, was in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukam.
„Es waren vielleicht nur Jungen, aber diesen Jungen ist es gelungen, sechs unserer Männer zu erschießen. Hiermit!“ Er riss eine alte, rostige Flinte aus toten Fingern. „Hiermit!“, wiederholte er zornig und hielt die Waffe so nah, dass die Soldaten zurückwichen.
„Verstanden, Herr Rittmeister.“
„Was?“
„Die Männer waren nachlässig.“
„Es war ein verdammtes, blutiges Lehrstück für uns. Sehen wir zu, dass wir kein weiteres erleben müssen.“









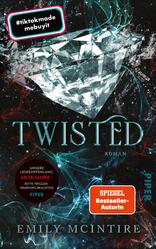
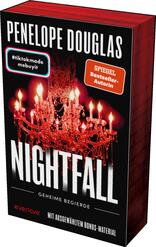







DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.