

Die Krankenschwester von St. Pauli – Wandel der Zeiten (Die St. Pauli-Saga 2) Die Krankenschwester von St. Pauli – Wandel der Zeiten (Die St. Pauli-Saga 2) - eBook-Ausgabe
Roman
— Historischer Hamburg-Roman„Aufwühlende Saga“ - Rätsel total
Die Krankenschwester von St. Pauli – Wandel der Zeiten (Die St. Pauli-Saga 2) — Inhalt
Große Gefühle: Die Familiensaga der engagierten Krankenschwester Svantje Claasen geht in die zweite Runde.
Hamburg im 19. Jahrhundert: Krankenschwester Svantje Claasen möchte trotz Kindern wieder arbeiten und muss sich gegen Widerstand durchsetzen. Ein historischer Roman mit großen Gefühlen und viel Spannung.
Nachdem sich die Hamburger Krankenschwester Svantje Claasen während der Cholera-Epidemie beweisen konnte und ihre große Liebe gefunden hat, warten in „Die Krankenschwester von St. Pauli – Wandel der Zeiten“ neue Herausforderungen auf sie. Als ihre beiden Kinder alt genug sind, möchte sie ihrem Beruf und ihrer Berufung wieder nachgehen – und stößt dabei auf Widerstand.
Starke Frauen im Kampf gegen Ungerechtigkeiten
Leserinnen des ersten Teils „Die Krankenschwester von St. Pauli – Tage des Schicksals“ können sich auf ein Wiedersehen mit vielen lieb gewonnenen Charakteren freuen. Autorin Rebecca Maly beleuchtet auch in der Fortsetzung nicht nur die willensstarke Svantje, sondern erweitert den Einblick in Alltag, Politik und Medizin des 19. Jahrhunderts durch weitere liebenswerte Charaktere.
Die studierte Altskandinavistin und erfolgreiche Drehbuchautorin wurde bereits mit dem Delia-Preis ausgezeichnet. Mit dieser Familiensaga in Norddeutschland beweist sie einmal mehr, dass die ganz großen Gefühle genau ihr Thema sind.
Ein realistischer Einblick in den Krankenhausalltag des 19. Jahrhunderts
Fans von „Call the Midwife“ und „Die Charité“ kommen in „Die Krankenschwester von St. Pauli“ voll auf ihre Kosten. Zusammen mit der engagierten Krankenschwester Svantje Claasen erleben sie die Medizin und ihre Herausforderungen im 19. Jahrhundert. Packend geschildert und genau recherchiert beschreibt Autorin Rebecca Maly den alltäglichen Kampf gegen den Tod und für die Liebe.
Leseprobe zu „Die Krankenschwester von St. Pauli – Wandel der Zeiten (Die St. Pauli-Saga 2)“
1 Hamburg, Eppendorfer Klinikum 1. Dezember 1892
Svantje hielt ihre Schwesternhaube in den Händen und lauschte gebannt. Sie musste sich zwingen, den Stoff nicht vor lauter Anspannung zusammenzudrücken. Nebenan kam es zu einem Eklat, wie ihn das Eppendorfer Klinikum noch nicht gesehen hatte. Und zwar wegen ihr. Sie wollte all das gar nicht, doch Doktor Schawacht bestand darauf.
Seitdem sie im August und September gemeinsam eine Cholerabaracke am Hafen geleitet hatten, hielt er große Stücke auf sie. Auf ihrer Hochzeit wenige Wochen später hatte er ihr [...]
1 Hamburg, Eppendorfer Klinikum 1. Dezember 1892
Svantje hielt ihre Schwesternhaube in den Händen und lauschte gebannt. Sie musste sich zwingen, den Stoff nicht vor lauter Anspannung zusammenzudrücken. Nebenan kam es zu einem Eklat, wie ihn das Eppendorfer Klinikum noch nicht gesehen hatte. Und zwar wegen ihr. Sie wollte all das gar nicht, doch Doktor Schawacht bestand darauf.
Seitdem sie im August und September gemeinsam eine Cholerabaracke am Hafen geleitet hatten, hielt er große Stücke auf sie. Auf ihrer Hochzeit wenige Wochen später hatte er ihr angeboten, Oberschwester in seinem Stab zu werden. Nun sollte sie ein eigenes Büro bekommen, doch dafür musste erst ein Zimmer geräumt werden. Die Schwestern der Station hatten zwar einen gemeinsamen Raum, doch der war mehr Lager und Durchgangsbereich und bot entsprechend wenig Ruhe.
Schawacht war entschlossen, das zu ändern, und dazu musste jemand anders seinen Platz räumen, und zwar der angehende Arzt Sebastian Küfer, der sich leichtfertig einen lebensbedrohlichen Fehler erlaubt hatte.
Wahrscheinlich hatte Doktor Schawacht Svantje in dem Glauben rufen lassen, dass der angehende Arzt seiner Anordnung sofort Folge leisten würde. Doch der gab nicht so schnell klein bei und sah nicht einmal seinen Fehler ein. Deshalb hörte sie nun alles mit an und fühlte sich mit jeder verstreichenden Minute unwohler. Natürlich hatte der Student einen gewaltigen Kunstfehler begangen, und Svantje teilte Schawachts Meinung, dass er noch nicht bereit war, sich am Leben von Patienten zu versuchen. Andererseits würde es für Außenstehende nun so aussehen, als gehe Doktor Schawacht für seinen Schützling, also sie, über Leichen. Svantje hätte sich am liebsten in Luft aufgelöst oder zumindest weitergearbeitet, sich nützlich gemacht, statt im Flur zu warten und zu hören, was nicht für ihre Ohren bestimmt war. In dem Zimmer wurden Stimmen laut. „Küfer, Sie haben sich in den letzten Wochen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Gehen Sie wieder an die Universität zurück, und verfeinern Sie Ihr Handwerk. In einem Jahr versuchen wir es noch einmal.“
„Mein Vater wird …“, protestierte der angehende Arzt.
„Ihr Vater wird gar nichts, Herr Küfer. Wenn Sie ihn herschicken, werde ich ihm sagen, dass Sie nicht verstehen, sauber zu arbeiten, was die Grundvoraussetzung für eine jede Operation ist. Sterilität rettet Leben, das sollte gerade Ihnen als Hamburger doch bekannt sein! Ihr letzter Patient hat wegen Ihnen ein Bein verloren. Ohne das beherzte Eingreifen von Schwester Falkenberg läge er nun unter der Erde. Und Sie wollen allen Ernstes mit mir diskutieren?“
Svantje war zusammengezuckt, als sie ihren Namen hörte. An den Fall erinnerte sie sich genau. Es war erst eine Woche her. Küfer hatte die Hände nur kurz unter den Wasserstrahl gehalten, statt sie gründlich einzuseifen. Er hatte einem Mann operativ einen Zeh abnehmen sollen, der bei einem Arbeitsunfall zertrümmert worden war. Der Stumpf war einen Tag später brandig geworden, und Schawacht, alarmiert von Svantje, hatte dem Patienten mitten in der Nacht den Unterschenkel abgenommen, um zumindest sein Leben zu retten. Nun war der Mann ein Krüppel, und das nur, weil Küfer zu arrogant gewesen war, die mindesten Hygienestandards einzuhalten.
Nein, es tat ihr nicht leid, dass der Medizinstudent nun sein Büro räumen musste, ganz im Gegenteil. Er sollte seine Fertigkeiten lieber noch eine Weile an Toten üben, bevor er das Leben eines weiteren Patienten ruinierte.
Die Universitäten schickten oft angehende und junge Ärzte in die Armenabteilung, wo sie an jenen, die in den Augen der Obrigkeit nur wenig Wert hatten, ihre Fähigkeiten erproben konnten.
Gute Studenten waren eine Bereicherung. Dann gab es zumindest für kurze Zeit genug Operateure für all die Menschen, die jeden Tag ins Krankenhaus gebracht wurden. Denn die Zahl der Armen wuchs beständig und damit auch die Menge der Patienten, die ohne Geld in die Krankenhäuser kamen. Bürgerliche und Wohlhabende, die in einem anderen Flügel untergebracht waren, wurden stets bestens und von ausreichend Personal versorgt. Anders die schlecht verdienenden Arbeiter. Svantje hatte den Eindruck, dass sich viele Ärzte zu fein waren, sie überhaupt zu behandeln. Nur einige wenige gab es, die sich wie Doktor Schawacht den Schicksalen der einfachen Leute verschrieben hatten.
Auch Svantje fühlte sich den Menschen in den überfüllten Krankensälen nahe. War ihre Familie doch selbst erst vor sieben Jahren hierher in die Stadt gekommen, erfüllt von der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Die Großindustrie Hamburgs wuchs wie Schaum auf einer gärenden Masse. Tausende mittellose, oft bereits kranke Leute strömten Monat für Monat in die Städte. Ganze Landstriche verwaisten. Auf dem Heimweg sah Svantje oft Familien mit ihren Koffern und Handkarren rastlos durch die Straßen ziehen. Genau so war sie selbst nach Hamburg gekommen, mit Mutter und Bruder und allem Hab und Gut auf zwei Karren. Der Vater hatte den Hof im Alten Land, der sie bis dahin mehr schlecht als recht ernährt hatte, zuerst verlassen, um auf der Werft zu schuften. Dann hatten sie durch eine Flut den Hof verloren, und die Zurückgebliebenen waren nachgekommen. Nun gehörte Svantje selbst schon beinahe zu den alteingesessenen Hamburgern.
Küfer stapfte beladen mit seinen Unterlagen und einem Koffer mit persönlichem Operationsbesteck an ihr vorbei. In jedem lauten Schritt, den er machte, schwang sein Zorn mit. Der Blick, den er Svantje zuwarf, war vernichtend, obwohl er nicht wissen konnte, dass sie sein Büro übernehmen würde.
Svantje wartete, bis Doktor Schawacht sie schließlich zu sich rief. Nur zögernd trat sie durch die Tür. Der Arzt stand mit dem Rücken zu ihr an einem weit geöffneten Fenster, das in den lichten Innenhof führte. Kühle Dezemberluft strömte herein. Sein Gesicht war von dem Streit gerötet, der schmale Mund wirkte unter dem gepflegten, grau melierten Vollbart angespannt.
„Das hätten Sie nicht tun müssen, Doktor“, sagte Svantje leise und trat neben ihren Mentor.
„O doch, Frau Falkenberg, denn es war mehr als nötig. Küfer hätte ich so oder so fortgeschickt. Das hat mit Ihnen nichts zu tun. Sie leisten hervorragende Arbeit, und nun, da Sie die Leitung der Tagschicht übernehmen, können Sie ein eigenes Büro sehr gut gebrauchen.“
„Meine Vorgängerin ist auch ohne ausgekommen“, bemerkte Svantje und dachte an die bescheidene Oberschwester Lederer, die nun aus dem Dienst geschieden war, weil sie wieder geheiratet hatte und ihr neuer Mann darauf bestand, dass sie zu Hause blieb.
„Bei allem Respekt für Frau Lederer, aber von Ihnen erwarte ich mehr, als die Schwestern morgens zum Dienst einzuteilen.“
Svantje fühlte sich, als sei sie durch seine Worte ein Stückchen gewachsen. Sie atmete tief durch und trat an den breiten Schreibtisch, strich über das dunkle, glatt polierte Holz. Sie war nun Oberschwester, mit einem eigenen Dienstzimmer. „Was genau erwarten Sie denn von mir?“, fragte sie und hörte selbst, wie hoffnungsvoll sie dabei klang.
„Sie sind eine gute Beobachterin und eine erfahrene Krankenschwester. Ich möchte, dass Sie festhalten, worunter unsere Patienten aus den einfachen Schichten zumeist leiden. Und damit meine ich nicht nur die offensichtlichen Erkrankungen. Sie wissen, dass ich in eine Kommission berufen wurde, die sich mit der Verbesserung der Lebensumstände der einfachen Leute befasst. Wir wollen nie wieder einer so verheerenden Seuche gegenüberstehen wie diesen Sommer.“
Svantje nickte ernst. Nach dem Choleraausbruch waren vom Senat endlich Maßnahmen ergriffen worden, um die Situation der Armen zu verbessern. Die Gängeviertel sollten grundlegend saniert oder abgerissen und durch gesündere Wohnquartiere ersetzt werden. Es wurde an Filtrierwerken gebaut, sogar eine Müllverbrennungsanlage war im Gespräch. Durch Schawacht wusste Svantje zudem, dass ein eigenes Hygieneinstitut für Hamburg in Planung war. Vermutlich war das auch der Grund dafür, dass er die gewünschten Auflistungen benötigte.
„Darf ich etwas fragen, Doktor?“
Er lächelte aufmunternd und rieb sich den Bart. „Aber selbstverständlich, Frau Falkenberg. Stellen Sie so viele Fragen, wie Sie möchten.“
Svantje räusperte sich. „Es ist doch mittlerweile hinlänglich bekannt, dass gutes Trinkwasser, saubere Luft und ausreichendes Essen die Situation stark verbessern würden. Und werden nicht auch bereits Filteranlagen und neue Wohnquartiere gebaut? Nicht, dass es reichen würde … aber …“ Sie suchte kurz nach Worten. „Ich weiß nicht, was ich noch dazu beitragen soll.“
„Ich habe Sie damals in den Seuchenbaracken erlebt. Ihre ruhige Art, die schnelle Auffassungsgabe. Sie sind prädestiniert, Frau Falkenberg. Ich brauche Zahlen, Daten, Vorerkrankungen. Nehmen Sie alle Patienten auf, und ordnen Sie diese nach Kategorien. Geben Sie mir etwas an die Hand, womit ich vor die Kommission treten kann. Fallbeispiele wären wünschenswert. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ihre Schwesterntätigkeit steht dahinter zurück. Lassen Sie andere die einfacheren Arbeiten erledigen. Sie unterstehen mir direkt. Falls Kollegen Probleme damit haben, schicken Sie sie zu mir. Es werden Ihnen alle Mittel zur Verfügung gestellt, die Sie benötigen. Mein Büro ist zwei Zimmer weiter, wie Sie wissen. Greifen Sie jederzeit auf meine Bücher zu.“ Er trat vor sie und streckte ihr die Hand hin. Noch immer ein wenig überwältigt, schlug Svantje schließlich ein.
„Und nun werde ich im Operationssaal erwartet, Frau Falkenberg. Ich empfehle mich.“ Er deutete eine knappe Verbeugung an und rauschte davon. Der weiße Kittel schlug ihm um die Beine, während er mit großen Schritten davoneilte.
Svantje war allein im Zimmer. „Mein eigenes Büro“, sagte sie leise und setzte sich so vorsichtig in den Schreibtischstuhl, als könne er jeden Augenblick unter ihr zusammenbrechen. Eine Weile saß sie so da und versuchte zu verinnerlichen, was der Doktor alles über die Patienten erfahren wollte. Sie zog ihr ledergebundenes Notizbuch hervor und schlug es auf. Darin schrieb sie alles nieder, was ihr während ihrer Arbeit bemerkenswert oder ungewöhnlich erschien.
Nun begann ein ganz neues Kapitel. Schichtplan, schrieb sie und unterstrich es zweimal. Rasch war die Einteilung für die nächsten beiden Wochen gemacht. Das war der einfache Teil gewesen.
Auf der nächsten Seite notierte sie nun, was Schawacht ihr zur Aufgabe gemacht hatte. Schnell wurde ihr klar, dass sie dafür ein standardisiertes System brauchen würde. Sie probierte mehrere Varianten durch und merkte kaum, wie die Zeit verflog.
Schließlich lehnte sie sich mit schmerzendem Rücken im Stuhl zurück. Viel Arbeit erwartete sie, und einen Teil davon würde sie zu Hause erledigen müssen. Das würde Friedrich nicht gefallen. Denn er akzeptierte zwar, dass sie trotz ihrer Ehe weiterhin arbeiten ging, aber mehr – das hatte er nicht nur einmal deutlich gemacht – sollte es wirklich nicht sein.
Er hatte ein hübsches Stadthaus erworben, das eigentlich darauf wartete, endlich liebevoll eingerichtet zu werden. Doch in Svantjes Augen konnte es so bleiben, wie es war. Sie hatten das Mobiliar vom Vorbesitzer übernommen, und jedes einzelne Stück war besser als alles, was ihre Eltern je besessen hatten. Kabinette aus Kirschbaumholz, das Studierzimmer verfügte ringsum über Regale aus Eichenholz mit hübschen Reliefs und Schnitzereien. Das Himmelbett hatten sie schon vor ihrer Hochzeit gemeinsam ausgesucht. Svantje erinnerte sich noch genau daran, wie sie ständig errötet war, weil sie an ihre erste gemeinsame Nacht denken musste. Auch jetzt erwachte ein zartes Flattern in ihrem Bauch. Ihre Ehe war noch so jung, dass sie sich jede Nacht liebten.
Plötzlich wollte sie keinen Moment länger im Klinikum bleiben. Feierabend hatte sie schon seit einer Viertelstunde. Erfüllt von kribbelnder Vorfreude packte sie ihre Sachen, dann fiel ihr wieder ein, dass sie versprochen hatte, heute ihre Eltern zu besuchen.
Svantje bestand darauf, weiterhin mit der Pferdebahn zur Arbeit und wieder nach Hause zu fahren, auch wenn Friedrich ihr mehrfach angeboten hatte, Pferd und Wagen zu nutzen. Doch was wäre das für ein Anblick gewesen, wenn sie jeden Morgen mit der Kutsche vorgefahren kam, um dann im Armenabteil des Klinikums zu arbeiten? Ihr besonderes Talent im Umgang mit den Patienten beruhte nicht zuletzt darauf, dass sie ihr vertrauten. Die Ärzte waren in den Augen der einfachen Leute Menschen eines anderen Standes. Schwester Svantje Falkenberg aber verstand sie, wusste, wie es war, in einfachsten Verhältnissen zu überleben. Dass es Momente gab, in denen es schlichtweg nicht möglich war, genug sauberes Wasser aufzutreiben, um es zu trinken, geschweige denn kleine Kinder zu waschen. Den Menschen, die auf den Docks und in den Fabriken schufteten, mangelte es an allem. Es war niemals genug Geld da.
Daher brachten sie den Ärzten oft nur Unglauben entgegen, wenn diese ihnen empfahlen, besser zu essen, teure Medizin zu kaufen oder die verrußten Wohnungen zu lüften, womit sie auch noch die wenige Wärme verloren hätten, die sie mit ihren schlechten Öfen zustande brachten.
Svantjes Ratschläge waren näher an ihrem Leben. Sie kannte Hausmittel und einfache Kräuterrezepturen, die sich die Menschen auch leisten konnten.
In Gedanken noch bei ihrem neuen Arbeitsplatz, kaufte sie für zwanzig Pfennig ein Billett und bestieg die Pferdebahn. Das Gefährt war voll besetzt, und sie ergatterte nur deswegen einen Sitzplatz, weil ein Herr für sie aufstand. Die Hamburger PEG, die Pferde-Eisenbahn-Gesellschaft, hatte längst auf Winterbetrieb umgestellt. Während man im Sommer offen fuhr und auch auf dem Dach sitzen konnte, zwängten sich nun alle Passagiere in stickiger Enge. Svantje genoss die Fahrt dennoch. Es gab einige Spottlieder über die angeblich stets lahmen oder faulen Gäule, doch heute zogen zwei kräftige Schimmel fleißig an. Die eisernen Räder surrten über die Schienen. Ein Mann neben ihr las in einer klein gefalteten Zeitung.
Nach zwei Stopps, an denen weitere Gäste zustiegen, passierten sie ein gewaltiges Ruinenfeld. Infolge der Choleraepidemie hatten die Stadtoberen den Abriss der heruntergekommensten Gängeviertel angeordnet, von denen es in Hamburg über die ganze Stadt verteilt ein halbes Dutzend gab. Sie waren nach den verschachtelten Gassen benannt, in denen es für Fuhrwerke längst kein Durchkommen mehr gab. Die Häuser waren so eng aneinandergebaut und immer wieder aufgestockt worden, dass zwischen den Bauten nur schmale Gänge blieben. Manchmal ragten die Dächer so weit vor, dass sie den Himmel verdeckten und sich die Nachbarn durch die Fenster die Hände reichen konnten. Stickig, nass und schmutzig war es dort. Dunkel obendrein. Eine Kanalisation gab es in den meisten Fällen nicht, und die Aborte wurden nur hin und wieder gereinigt. Zuerst wurden die Elendsquartiere in der nördlichen Neustadt abgerissen. Wie schon bei der Räumung der Gängeviertel von Kehrwieder, die acht Jahre zuvor für den Bau der neuen Speicherstadt abgerissen worden waren, kümmerte man sich auch dieses Mal kaum darum, wo all die Menschen unterkommen sollten, die plötzlich ihr Dach über dem Kopf verloren. Es hatte große Proteste und Ausschreitungen gegeben, denn der Abriss bedeutete vorerst, dass der ohnehin knappe Wohnraum noch weniger wurde. Viele fanden weiter außerhalb eine neue Bleibe und mussten nun lange Wege in Kauf nehmen, um zur Arbeit zu kommen.
Mittlerweile schritt das Bauvorhaben immerhin gut voran. Anstelle der alten, feuchten und verwinkelten Bauten sollten moderne, gesunde Wohnquartiere für die Arbeiterschaft entstehen. Noch immer transportierte man den Schutt ab, während die neuen Baumaterialien bereits angeliefert wurden.
Die Pferdebahn rumpelte an einem Platz vorbei, wo Tagelöhner im Licht von Gaslaternen Mörtel von ausgebrochenen Backsteinen schlugen, die danach wiederverwendet werden würden. Die meisten waren in Lumpen gekleidet, viele noch halbe Kinder. Das sollte nicht sein, dachte Svantje. Kein Kind sollte tagein, tagaus Steine schlagen müssen, statt zur Schule zu gehen, zu spielen …
Die Fahrt nach St. Pauli dauerte fünfzig Minuten, manchmal sogar eine Stunde, je nachdem, wie viele Gäste es gab und wie dicht der Verkehr war. Sie passierten Arbeiterviertel ebenso wie hübsche Parks, vornehme Stadthäuser, die sich gegenseitig mit ihrem Fassadenschmuck zu übertrumpfen suchten, und Kopfsteinpflasterstraßen voller kleiner Handwerksbetriebe.
Die Straßenbahn wurde schließlich langsamer, eine Glocke bimmelte, und der Kontrolleur rief ihre Haltestelle aus. Hastig drängte sich Svantje Entschuldigungen murmelnd an den anderen Passagieren vorbei und stieg aus.
St. Pauli. Der Staub einer weiteren Baustelle lag in der Luft, begleitet vom satten, erdigen Geruch der Elbe. Es war kalt geworden, den aufsteigenden Nebel roch Svantje mehr, als ihn zu sehen. Vorbei ging es an einer kleinen Polizeistation. Die provisorische städtische Entseuchungsstation war längst verschwunden. Nichts wies mehr auf die ätzenden Chlordämpfe hin, mit denen die Keime in Kleidung und auf Gerätschaften vernichtet worden waren. Hamburg war zum Alltag zurückgekehrt, und doch … die Angst hatte sich tief in die Seelen der Menschen hineingegraben. Auch wenn sie lächelten und einander in scheinbarer Fröhlichkeit grüßten, lag darunter etwas verborgen. Wie tiefe Risse in einem Mauerwerk, die nur durch ein wenig Tünche kaschiert worden waren.
Irgendwann, vielleicht schon bald, würden sie wieder an die Oberfläche dringen. Doch noch strahlte alles. Denn all die Menschen hier gehörten zu den Glücklichen, die überlebt hatten. Hamburg besaß über achttausend neue Gräber, und viele der Hinterbliebenen suchten noch heute nach der letzten Ruhestätte ihrer Lieben, deren Körper in aller Hast verscharrt worden waren.
Svantje bog in eine kleine Gasse ein und bemühte sich, die düsteren Gedanken hinter sich zu lassen, denn dort stand das Haus, in dem ihre Eltern nun lebten. Es war ein schmales, dreigeschossiges Stadthaus, einfach, aber in gutem Zustand. Friedrich hatte es gleich nach ihrer Hochzeit erworben und ihren Eltern zur Verfügung gestellt. Svantjes Vater bestand darauf, ihnen eine geringe Miete zu zahlen. Almosen lehnte er ab. Die Claasens wollten auch nicht das gesamte Haus beziehen, daher wohnte Raik nun im oberen Geschoss, wie früher. Er half den Eltern hin und wieder, deshalb zahlte auch er nur wenig Miete.
Svantje läutete die Türglocke und hörte gleich darauf kleine Füße über Holzdielen trappeln. „Svanni?“, rief eine dünne Stimme aus dem Inneren.
„Ja, kleine Maus.“
„Ich bekomme die Klinke nicht herunter!“
Svantje wusste auch, warum. Sicher hatte ihre Mutter abgeschlossen, um ihre jüngste Tochter daran zu hindern, einfach auf die Straße zu laufen. In der alten, kleinen Wohnung im Gängeviertel hatte die Tür stets offen gestanden. In dem Haus lebte fast ein Dutzend Familien mit zahllosen Kindern auf engstem Raum. Sie alle spielten im Treppenhaus und den Hinterhöfen und gaben aufeinander acht.
Hier aber lebten kaum Kinder, und die wenigen streunten selten auf der Straße herum, die Nachbarn sahen es nicht gern.
Als die Tür schließlich aufschwang, drückte und herzte Svantje zuerst das Nesthäkchen. Marie war mit ihren fünf Jahren ungewöhnlich klein und zart. Sie war spät geboren worden, als ihre Mutter eigentlich sicher war, keine Kinder mehr bekommen zu können.
„Komm herein, du siehst mööd aus, mien Deern.“
Svantje schloss die Tür hinter sich und umarmte ihre Mutter. „Mööd und glücklich.“ Sie erzählte schnell von ihrem neuen Dienstzimmer, während Marie sie an der Hand in die Küche zog, wo bereits eine Kaffeekanne und ein halb ausgetrunkenes Glas Milch für Marie bereitstanden. Auf einem großen Teller lag ein halbes Dutzend Kuchenstücke, die Mutter offenbar wie so oft von ihrer Arbeit als Haushaltshilfe mitgebracht hatte.
„Bei Harkenfelds gab es einen Empfang. Sie haben gestritten, und der Alte hat geschrien, bis ihm die Stimme weggeblieben ist. Nach Kuchen und Gebäck stand danach keinem mehr der Sinn. Die meisten Gäste sind gegangen, bevor zu Tisch gebeten wurde. Es war wirklich ein Schauspiel. Ich habe ihn noch nie so erlebt, aber seitdem er sich mit seinem Sohn zerstritten hat, ist er nicht mehr derselbe. Das sagt auch Frau Kramer, und die ist immerhin schon seit zwanzig Jahren dort im Dienst. Alle spekulieren, warum die beiden sich zerstritten haben. Die einen sagen, weil der Junior zum Militär wollte, die anderen, weil er angeblich zu den Sozialisten gegangen ist. Doch ich mag einfach nicht glauben, dass nicht mehr dahintersteckt. Aber jetzt genug darüber, es gibt Kuchen.“
„Und er sieht köstlich aus und duftet fast schon weihnachtlich“, sagte Svantje und setzte sich mit einem Lächeln. Doch die Entwicklungen in der Großindustriellenfamilie Harkenfeld waren ihr nicht so gleichgültig, wie sie vorgab. Während der überraschenden Schwangerschaft ihrer Mutter hatte sie selbst dort gearbeitet und Freundschaft mit den beiden älteren Harkenfeld-Sprösslingen geschlossen. Hilde war nun eine gute Freundin, und über Richard hatte sie ihren Ehemann kennengelernt. Der ursprünglich designierte Nachfolger der Schiffsbauer hatte mit dem Patriarchen gebrochen. Seitdem war die Familie nicht mehr zur Ruhe gekommen. Während Hilde zwar unsicher schien, aber zu ihrem Bruder hielt, suchte der Vater mit angeschlagener Gesundheit nach einem neuen Nachfolger. Dass er ein Tyrann mit üblem Temperament war, verkomplizierte die Situation zusätzlich. Svantje hatte Hilde schon mehrfach darauf angesprochen, was die Familie entzweit habe, doch ihre Freundin schwieg sich beharrlich aus. Über ihren Bruder zu reden schien ihr unangenehm, als wolle sie das Thema gar nicht anrühren. Svantje hatte hin und her überlegt, was wohl geschehen sein mochte. Die Familie war auf ihrer Hochzeit zu Gast gewesen, und zumindest anfangs hatte es nicht so gewirkt, als würde Zwist zwischen den Harkenfelds herrschen. Doch gegangen waren sie getrennt, und verabschiedet hatten sie sich von keinem, zumindest soweit Svantje wusste. Aber das mochte nichts heißen, es war schließlich ihre Hochzeit gewesen, und sie hatte getanzt und gelacht und Champagner getrunken, bis ihr schwindelig wurde.
Durch die Mutter hatte sie erfahren, dass Richard noch in der Nacht seine Sachen gepackt hatte und seitdem spurlos verschwunden war. Wie ein Geist, berichtete die Kramer, blass wie ein Gespenst war der Junior und hat kein Wort gesagt. Am darauffolgenden Tag hatte der Hausherr verkündet, Richard sei nicht mehr sein Sohn, und jedem mit Entlassung gedroht, der seinen Namen laut aussprach. Seitdem brodelte die Gerüchteküche, und alle Angestellten versuchten, mehr herauszufinden. Bislang ohne Erfolg. Frau Harkenfeld weinte viel, aber selbst sie hielt sich an die Anordnung ihres Mannes.
Svantje folgte ihrer Mutter und trug die Kuchenplatte ins Esszimmer zur reich gedeckten Kaffeetafel. Vier Teller und Tassen verteilten sich auf dem dunklen, glänzend polierten Holztisch. „Kommt Vater früher von der Arbeit?“, fragte sie.
„Nein, er wird später essen, aber ich fand es hübscher so.“
Svantje hob ihre kleine Schwester auf einen Stuhl und legte eine Serviette auf ihren Schoß.
Ihr Bruder Piet war auf einem Internat. Er sollte so viel lernen dürfen, wie er wollte. Ungewöhnlich für den Sohn eines Werftarbeiters und einer Haushaltshilfe. Svantje bezahlte die Hälfte des Schulgeldes. Er sollte genauso seinem Traum folgen können, wie Mutter es ihr selbst einst ermöglicht hatte. Friedrich wollte nicht, dass sie ihr Geld für den Haushalt nutzte. Sie solle damit tun, was sie wünsche. Und Svantje wünschte sich nichts mehr, als dass ihre Geschwister es eines Tages besser haben würden als die Eltern.
Sie wählte ein Stück Apfelkuchen aus, das am Rand etwas zerdrückt war. Er duftete nach Zimt. Zwischen den Blätterteigschichten verbargen sich eine Apfelmasse und ein heller Pudding. Während sie aß, berichtete sie von ihrem Alltag im Krankenhaus.
Die Augen der Mutter leuchteten vor Stolz. „Wer hätte das gedacht. Mein kleines Schwänchen. Du warst schon immer eine hilfsbereite Seel. Aber dass es eines Tages so honoriert würde. Was sagt denn dein Mann dazu?“
„Ich bin sicher, dass Friedrich sich mit mir freuen wird.“
„Es klingt, als würdest du dich bei den Ärzten unentbehrlich machen.“
„Doktor Schawacht hält große Stücke auf mich. Ich hoffe sehr, dass ich ihn nicht enttäusche.“
„Das wirst du nicht.“ Mutter schenkte ihnen Kaffee nach. Ihre Zuversicht tat Svantje gut, auch wenn sie wusste, dass die Worte der Liebe zu ihr entsprangen und nicht dem Wissen um ihre Aufgaben. Der prüfende Blick war spürbar wie eine Berührung auf ihrer Haut.
„Und wenn du schwanger wirst? Was geschieht dann?“
Svantje zuckte beinahe zusammen, versuchte, sich ihr Erschrecken nicht anmerken zu lassen. Schwangerschaft war ein Thema, an das sie nicht gern rührte. Natürlich wünschten Friedrich und sie sich eine Familie, aber noch war es ihr zu früh. Svantje forcierte es nicht, zu empfangen, sondern tat genau das Gegenteil. Es war ihr kleines Geheimnis, von dem Friedrich nicht einmal ahnte. Sie waren beide noch jung, und bevor man sie schräg ansah, würde noch einige Zeit vergehen können. Bis dahin trank sie täglich ihren Kräutertee und wendete Salzwasserspülungen an, nachdem sie und Friedrich sich geliebt hatten.
Denn nur solange sie kinderlos war, konnte sie Oberschwester bleiben. Bis die Kleinen dann so groß wären, dass sie wieder in ihren Beruf zurückkehren könnte, würden Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen. Manche Ehen wurden mit sechs, einige sogar mit zehn Kindern gesegnet, und die armen Frauen waren beständig schwanger. Und noch war Svantje nicht bereit, einen Beruf hinter sich zu lassen, den sie gerade erst ergriffen hatte und der mit jeder Woche interessanter wurde.
Mutter drückte ihre Hand und lächelte zuversichtlich. „Bestimmt wird es noch etwas dauern.“
Svantje lächelte verkrampft. Und wenn nicht? Ihre Methoden verringerten das Risiko, aber sicher waren sie nicht.
***
Hilde lag mit weit aufgerissenen Augen im Bett, die Hände über ihrem perlweißen, seidenen Nachthemd gefaltet, und fror. Es war eine Kälte, die aus ihrem Inneren kam, eine, die aus Angst geboren wurde. Über ihr bauschte sich der blaue Baldachin des Himmelbetts in einem sachten Windzug, der durch das Fenster hereinwehte. Es sah aus wie die sanften Wellen eines Meeres. Hinter ihr lag die erste Nacht in ihrem Bett nach ihren Flitterwochen an der See in Heiligendamm. Neben ihr schlummerte ihr Ehemann Walter. Sie wandte den Kopf, um sein Profil zu mustern. Eine Nase mit einem leichten Knick, eine gewölbte, hohe Stirn mit wachsender Glatze. Er war über zehn Jahre älter als sie und hatte vermutlich schon als Kind sehr erwachsen ausgesehen. Er war ein ernster, zuverlässiger Mann. Weich. Seine Wangen wirkten füllig, obwohl er nicht dick war, und seine Lippen standen ein wenig auseinander, um hin und wieder ein leises Schnarchen zu entlassen. Er war gut zu ihr und behandelte sie wie eine Heilige, obwohl sie alles andere war als das. Nein wirklich, heilig war sie nicht.
Hilde betrog ihren Mann seit dem ersten Tag ihrer Ehe. Sie hatten am 15. November geheiratet, nur etwa drei Wochen nach Svantjes Hochzeit und nur sieben nach Hildes Entführung. Es hatte schnell gehen müssen, das war vor allem dem Vater wichtig gewesen, der nicht von der Vorstellung abzubringen gewesen war, dass sie in den Händen der Entführer ihre Unschuld verloren hatte. Er versprach ihrem Zukünftigen, das daraus eventuell entstehende Kind wegzugeben, sodass die bessere Gesellschaft Hamburgs nie davon erführe.
Walter aber hatte sie alle überrascht und nicht nur auf die Ehe bestanden, sondern auch darauf, ein mögliches Kind als sein eigenes anzunehmen. Er war ein weit besserer Mann, als Hilde je für möglich gehalten hatte. Doch um ihn zu lieben, reichte es nicht. Dass sie ihn dennoch geheiratet hatte, war dem Schwur zu verdanken, den sie in der dunkelsten Stunde ihres Lebens sich selbst gegenüber geleistet hatte: Wenn das Schicksal sie aus ihrem Kerker rettete, würde sie der arrangierten Ehe zustimmen. Nur Augenblicke später war Svantjes Nachbar aufgetaucht und hatte sie heldenhaft befreit.
Raik – ein charmanter Prachtkerl von einem Mann mit Kampfgeist, Schneid und nicht zuletzt einem begehrenswerten Äußeren. Sofort hatte Hilde ihren Schwur bereut. Sie hatten sich an jenem Tag geküsst und auf Svantjes Hochzeit getanzt, bis ihre Füße glühten. Und doch wäre Hilde ihrem Mann treu geblieben, wenn da nicht Vaters bittere Reden gewesen wären, sie sei bereits eine gepflückte Blume. Es schien ihn überhaupt nicht zu interessieren, was sie sagte. Er glaubte ihr nicht, dass sie ihre Unschuld nicht verloren hatte. Dass er auch ohne ihre Zustimmung bereits mit ihrem zukünftigen Ehemann gesprochen hatte, gab Hilde das Gefühl, für ihn kaum mehr zu sein als beschädigte Ware. Und nachdem auch Walter ihr immer wieder beteuert hatte, dass es ihm nichts ausmache, sie zu heiraten, obwohl sie geschändet worden war, kam eins zum anderen. Noch vor ihrer Eheschließung war sie Raik erneut begegnet. Das erste Mal trafen sie sich zufällig in Svantjes neuem Haus. Raik hatte mit Vater Claasen einige Dinge vorbeigebracht. In jeder unbeobachteten Sekunde hatte er sie sehnsüchtig angesehen, und ihr war schnell klar geworden, dass er sie ebenso sehr begehrte wie sie ihn. Flüsternd bat Hilde ihn um ein Wiedersehen am Folgetag, denn er hätte es wohl nicht gewagt, eine Harkenfeld um eine Verabredung zu bitten. Sie waren spazieren gegangen, hatten sich in einem Schuppen geküsst wie zwei Verhungernde, bis Hilde sich fühlte, als würde sie innerlich verglühen. Der Duft seiner Haut verfolgte sie einen ganzen Tag lang.
Beim dritten Treffen nahm Raik ein Zimmer, trug sie beide als Ehepaar Kämmer ein, und Hilde verlor in seinen Armen ihre Unschuld. Wenn sie schon einen Langweiler wie Walter Degen heiraten musste, der ohnehin keine Jungfrau erwartete, dann wollte sie zumindest ein Mal, ein einziges Mal mit einem Mann schlafen, den sie auch begehrte. Vielleicht tat sie es auch als stille Rebellion gegen den Vater, der seinem eigenen Kind nicht glauben wollte.
Doch es blieb nicht bei dem einen Mal mit Raik, dafür war es zu wundervoll gewesen.
Ihren Liebhaber hatte sie nun schon zwei Wochen nicht gesehen, und sie sehnte sich nach seinen Berührungen, nach seinen derben Scherzen und dem würzigen Geruch seiner Haut.
Hilde drehte sich zur Seite und Walter den Rücken zu. Sie konnte ihn nicht ansehen und dabei an Raik denken, dann wog ihr Verrat noch schwerer.
Walter hatte zu ihr gehalten, nachdem sie überfallen und entführt worden war. Sie geheiratet, obwohl er glaubte, ihr sei Gewalt angetan worden und sie keine Jungfrau mehr. Kaum ein Mann hätte das getan. Walter hielt zu ihr, auch wenn sie Hosen anzog und im Park Fahrrad fuhr. Er lachte über die entsetzten Blicke der Spaziergänger und begegnete ihren abfälligen Sprüchen mit Humor. In ihren Flitterwochen hatte er Hilde jeden Wunsch von den Lippen abgelesen – auch die weniger damenhaften. Hinter seiner gestrengen Fassade steckte ein fortschrittlicher Geist. In der kommenden Woche würden sie gemeinsam zum Amt für Allgemeines Vorlesungswesen gehen, wo er eine Erlaubnis unterschreiben wollte, damit sie als Gasthörerin zugelassen wurde. Hamburg verfügte zwar über keine eigene Universität, doch es gab viele Forschungsinstitute, die dazu gedrängt wurden, Vorträge abzuhalten.
Und wenn ich schwanger bin?, hatte sie gefragt. Dann besorgen wir ein Kindermädchen, antwortete er lapidar. Welch ein Glück sie mit Walter hatte, und wie böse sie es ihm vergalt. Er liebte sie wirklich, da war sie sich sicher. Raik unterschied sich von ihm wie Tag und Nacht. Wobei sie nicht sagen konnte, was er verkörperte. Das Zusammensein mit ihm war sündhaft, dunkel und schrecklich aufregend. Er hatte sie aus den Händen ihrer Entführer gerettet, sich für sie geschlagen und geblutet.
Was mit einem Kuss gleich nach ihrer Rettung begann, hatte sie in einer schnellen Spirale abwärtsgerissen. Sie konnte jetzt nicht einfach damit aufhören. So mussten sich Süchtige in einer Opiumhöhle fühlen. Sie musste Raik wiedersehen, musste!
Hilde schloss die Augen, und ihre Erinnerung trug sie zu jenem Tag zurück, an dem alles begonnen hatte. Die Choleraepidemie hielt die Stadt fest in ihren gierigen Klauen. Der Tod hing wie ein düsteres Leichentuch über Straßen und Gassen. Trotzdem fühlte sich Hilde nach ihrer Befreiung so lebendig wie nie zuvor. Wie eine Fackel in der Dunkelheit. Sie hatte überlebt, war dem Tod auf zweifache Weise ganz nahe gekommen und ihm trotzdem nicht zum Opfer gefallen. Raik hatte sie gerettet. Ausgerechnet ein Werftarbeiter, als wollte das Schicksal sie, eine Harkenfeld, verhöhnen. Männer wie Raik kannte Hilde bislang nur aus der Ferne. Als anonyme Menschenmenge, über die ihr Vater herrschte wie ein König. Doch Raik Alberts war einer, der sich nicht beherrschen ließ, das war ihr sofort klar gewesen.
Bereits gestern hatte er ihr eine Nachricht zukommen lassen. Er schrieb ihr unter dem Namen seiner Schwester Emma. Hatte sie eingeladen in ein Café, um über alte Zeiten zu plaudern, wie er schrieb. Café war ihr Geheimwort für eine bestimmte Parkbank.
Hilde wusste nicht, ob Walter ihre Korrespondenz las, aber Raik und sie waren lieber übervorsichtig.
Hilde stand auf, drückte Walter einen Kuss auf die Wange, der sich daraufhin träge regte, und ging ins Ankleidezimmer. Mit klopfendem Herzen legte sie sich zurecht, was sie tragen würde: ein cremefarbenes Hauskleid für den Vormittag und dann etwas Schlichtes, aber Hübsches für das Treffen mit Raik. Falls man sie zufällig zusammen sah, sollte nicht jeder auf den ersten Blick wissen, dass sie zwei verschiedenen Schichten entstammten. Das Kleid war von einem unauffälligen, hellen Braunton, der feine Seidenstoff schimmerte mit jeder Bewegung. Schmale Rüschensäume und Biesen betonten die schmale Taille, bauschige Ärmel und weite Schöße die modische Sanduhr-Silhouette. Eine einfache, schmucklose Pelerine aus rostrotem, weichem Kaschmir komplettierte ihre Wahl. Das Haar würde sie aufstecken, aber so, dass es später auch ohne die hübschen Perlenkämme hielt. In den Wochen vor ihrer Hochzeitsreise hatte sie sich bereits ein wenig darin üben können, sich zu verstecken und zu verstellen.
Hilde wusch sich, kleidete sich an und wartete dann am Frühstückstisch auf Walter.
Heute würde er seinen neuen Posten bei Harkenfeld beziehen. Zwar war er in den Wochen vor ihrer Ehe bereits regelmäßig in der Werft ein und aus gegangen, um sich einzuarbeiten, doch ab heute war er offiziell Vaters rechte Hand. Er schien nicht nervös. Hilde aber konnte nur daran denken, dass er dadurch auch häufiger auf Raik treffen würde. Die beiden Männer kannten sich bislang flüchtig, weil Raik Walter seine entführte Verlobte zurückgebracht hatte. Vater duldete den aufrührerischen Gewerkschaftler nur deshalb noch in der Werft.
Walter merkte gar nicht, dass seine Frau in Gedanken war. Sie aßen, er las Zeitung und gab ungefragt kurze Zusammenfassungen und seine Sicht der Dinge wieder. Außerhalb des Schlafzimmers siezten sie sich, weil er fand, dass es vom Respekt der Eheleute füreinander zeugte. In Hildes Augen verstärkte es vor allem die Distanz zwischen ihnen. Manchmal erschien es ihr, als lebe sie mit einem Fremden zusammen, dann war er ihr wieder so vertraut, als kenne sie Walter schon seit ihrer Kindheit.
Der Vormittag verging wie im Flug. Ihre Ehe war noch jung, und Walters Anwesen, das sie nach der Hochzeit bezogen hatte, trug noch nicht ihre Handschrift. Die grundlegende Einrichtung war da, doch es fehlte an Gemälden und Stoffen. Die Hochzeit war zwar knapp anberaumt gewesen, dennoch waren aus Walters und ihrer eigenen Verwandtschaft viele Geschenke gekommen. Kistenweise stapelten sie sich nun in Walters Haus. Manches war per Kurier oder Post geliefert worden und erst eingetroffen, während sie in den Flitterwochen waren. Hilde ließ die Pakete von einer Hausangestellten öffnen und verschaffte sich eine Übersicht über das, was sie an Aussteuer erhalten hatte. Darüber verging der ganze Morgen. Nachdem sie angeordnet hatte, was wohin geräumt werden sollte und welche Geschenke besser unauffällig verschwinden oder eingelagert werden mussten, aß sie einen Imbiss zu Mittag und ließ sich dann ins Zentrum fahren.
Walter wusste, dass sie Besorgungen machen wollte und danach eine Freundin traf, mit der sie zu Abend essen würde. Er hatte sich daraufhin mit einem Geschäftspartner verabredet, der außerhalb Hamburgs eine Spedition betrieb.
Ihr Treffen mit Raik war so sicher, wie es nur sein konnte.
Nachdem sie bei einem Tuchhändler Tischdecken, Servietten und Stoffe für Stuhlbezüge ausgewählt hatte, schlenderte sie davon. Entlang der Alster zupfte sie sich nach und nach ihre perlenbesetzten Kämme aus dem Haar und legte sich die schlichte Pelerine um die Schultern, die sie zuvor über dem Arm getragen hatte.
Kahle, hohe Ulmen warfen Schatten auf den Weg vor ihr. Auf einer Wiese tollten Kinder umher, spielten Ball und Haschen. Drei Buben und ein Mädchen trieben auf einem Platz, wo an Feiertagen manchmal eine kleine Kapelle spielte, mit Stöcken einen Reifen an. Hilde setzte sich auf eine Bank und schlug ein kleines Büchlein auf. Sie gab nur vor zu lesen. Man würde sie für eine Mutter halten, die mit ihren Kindern an einem schönen, milden Wintertag in den Park gegangen war. Nichts Ungewöhnliches. Sie konnte den Eingang des Zoologischen Gartens aus der Ferne sehen. Niemand, den sie kannte, besuchte je die Tierschauen, es sei denn, es fand eine Völkerschau in einem festlichen Rahmen statt. Hier war sie sicher vor Entdeckung, und doch fühlte sie sich nicht so. Immer wieder meinte sie, fremde Blicke zu spüren, doch da war niemand.
Hilde atmete tief durch und blätterte eine Seite weiter. Kribbelige Aufregung machte ihren Hals trocken, und dann spürte sie ihn. Raik. Unter gesenkten Lidern sah sie den Weg hinab. Mit festem Schritt kam er auf sie zu. Er war groß und schlank, mit kräftigen Schultern, geformt von seiner Arbeit als Schiffszimmerer. Er trug eine Kappe auf seinem dunklen Haar, die er nun abnahm. Hildes Knie wurden weich. Sie wusste genau, wie sich seine Haut anfühlte, seine Küsse schmeckten. Röte stieg ihr in die Wangen, als er neben ihr stehen blieb und mit einem Hunger auf sie hinabsah, der ihrem ebenbürtig war. Sein Lächeln war anziehend, und er wusste um dessen Wirkung auf sie.
Raik deutete eine knappe Verbeugung an. „Hilde“, sagte er. Nur ihren Namen. Sie hielt ihm ihre Hand entgegen, damit er ihr aufhalf. Schon die erste Berührung ließ sie angenehm erschauern.
Er legte ihre Hand auf seinen Unterarm, und los schlenderten sie. Ihr klopfte das Herz bis zum Halse. Sie versuchte, sich so zu verhalten, als sei nichts dabei, mit ihm durch den Park zu schlendern. Doch immer wieder zog es ihren Blick zu seinem markanten Profil, den geheimnisvollen dunkelbraunen Augen, die von dünnen Fältchen umkränzt waren, der etwas schiefen Nase. Sie hatte nie gefragt, wann er sie sich gebrochen hatte.
„Wohin gehen wir?“, brach sie das Schweigen.
Er nannte eine Pension, die sie vor einigen Wochen schon einmal aufgesucht hatten. Dort gab es einfache, saubere Zimmer. „Denkst du, es ist genügend Zeit verstrichen, seit wir zuletzt da waren?“
„Mit Sicherheit.“ Er klang überzeugt, aber er betrog ja auch niemanden. Im Gegensatz zu ihr war er ungebunden.
„Ich habe uns wieder als Ehepaar Kämmer gebucht und sofort bezahlt, da fraagt niemand nach einem Ausweis als Sicherheit.“
Sie seufzte. „Ich hoffe es.“
„Die letzten Weken waren einsam ohne dich“, sagte er leise und ohne sie anzusehen.
„Wie ist es dir ergangen?“
„Ich habe Doppelschichten gearbeitet. Dien Vader ist der reinste Sklaventreiber.“
Sie schluckte. „Es tut mir leid.“
Er wandte den Kopf und sah sie an, als habe sie etwas Überraschendes gesagt. „Früher oder später wird es ihm leidtun. Der Arbeiterrat gewinnt mehr und mehr Einfluss.“
Raik war Gewerkschaftler und Sozialist. Wenn er nicht Hilde aus den Fängen ihrer Entführer gerettet hätte, wäre er längst nicht mehr in der Werft beschäftigt gewesen, das wussten sie beide. Von seiner sicheren Position aus entwickelte er sich zur Nemesis ihres Vaters und hatte schon einige Verbesserungen für die Belegschaft erreicht. Raik besaß Rückgrat, und das imponierte ihr.
Sie erreichten die kleine Pension und wechselten kaum ein Wort. Meist schlief Raik in der Nacht nach ihrem Treffen noch einmal in ihrer jeweiligen Unterkunft, damit sie kein Aufsehen erregten. Niemand sollte denken, dass sie sich nur für das eine trafen.
Sobald er die Tür hinter ihnen schloss, atmete Hilde auf. Gleichzeitig klopfte ihr Herz immer schneller. Sie legte ihre Pelerine ab und stellte die Handtasche auf ein kleines Tischchen. In der Luft schwebte der Geruch von Bohnerwachs und gestärkter Bettwäsche. Ein getrocknetes Bündelchen Lavendel hing über dem Bett. Als Raik sich umwandte, brachte der Blick in seinen Augen ihren Atem zum Stocken. Es war, als ließen sie beide im selben Moment ihre Masken fallen. Da war es wieder, dieses Lächeln, das ihr schon bei der ersten Begegnung aufgefallen war. Es verriet ihr, dass er sie begehrte und es ihn noch immer verblüffte, dass er ausgerechnet Hilde, die Tochter des Werkseigners, verführt hatte.
Er hob seine Linke und strich mit dem Handrücken über ihre Wange. Eine Berührung, so flüchtig wie Schmetterlingsflügel. Hilde entfuhr ein leises Seufzen. Ihre Haut fühlte sich plötzlich übersensibel an. Jede Faser ihres Körpers wollte diesen Mann. Wo sie Walter mit Gleichgültigkeit entgegentrat, entfachte Raik ein Glühen in ihr wie in einer Esse. Der leiseste Hauch genügte, um die Flammen auflodern zu lassen. Sie wünschte, dass es nicht so gewesen wäre, dass sie ihrem Ehemann gegenüber so hätte empfinden können, wie sie es für Raik tat. Aber es wollte sich nicht einstellen, und sie hatte es aufgegeben, sich dagegen zu wehren.
Mit einem einzigen Schritt schloss sie die Distanz, stellte sich auf die Zehenspitzen und schloss die Augen. Raiks Lippen drückten sich weich und beinahe scheu auf ihre. Hilde wollte mehr. Sie grub ihre Hände in sein Haar, umschlang seine Schultern. Raik spannte die Muskeln, und im nächsten Augenblick hatte er sie hochgehoben. Er hielt sie mühelos. Mit ihr im Arm trat er an das kleine Fenster und zerrte die Gardine davor. Weiche Schatten legten sich über das kleine Zimmer.
Raik trug sie zum Bett. In seinen Armen fühlte sie sich geborgen. Er war ihr Retter und nun auch ihr Liebhaber.
Die erste Vereinigung war immer drängend, getrieben von der Sehnsucht nach dem Körper des anderen, die sich über Tage und diesmal sogar Wochen aufgestaut hatte.
Beim zweiten Mal ließen sie sich Zeit, genossen. Als sie schließlich erschöpft nebeneinanderlagen, fühlte Hilde sich beinahe schwerelos. Nur der Arm, den Raik um ihre Mitte geschlungen hatte, schien ihren Körper davon abzuhalten, einfach davonzuschweben. Gedankenverloren spielte sie mit seinem Haar, das fest, ja beinahe drahtig war. Wärme stieg aus seiner Haut, zusammen mit dem ureigenen Duft von ihm und ihr.
Raik lag dicht neben ihr, den Arm unter einem Kissen, den Kopf darauf gestützt. Er begann sie spielerisch mit der freien Hand zu berühren. Seine Fingerspitzen zogen Linien um ihren Nabel, hinauf zum Ansatz ihrer Brüste und wieder zurück.
In seiner Nähe fiel es ihr schwer, auch nur einen einzigen klaren Gedanken zu fassen. Viel Zeit hatten sie nicht mehr. Der Klang der Rathausuhr reichte bis zur Pension, und die Glocken hatten bereits Viertel vor fünf geschlagen. Bald würde sie gehen müssen, und alles, was ihr dann noch blieb, war die Erinnerung, die manchmal so stark war, dass Hilde meinte, noch Tage später seine Berührung zu spüren. Dann stieg ihr Hitze in die Wangen und ließ ihre Haut rosig werden.
„Und wenn ich dir ein Kind mache?“, brach Raik die Stille. Seine Finger verharrten auf ihrem Unterleib. In Hilde spannte sich alles an, wie bei einer scheuen Katze, die von einem Geräusch aus dem Schlaf geweckt worden war. Bereit zur Flucht.
„Wie kannst du so etwas sagen?“, empörte sie sich.
Er grinste lausbubenhaft. „Mein Sohn als Kuckuckskind von Walter Degen. Ein uneheliches Arbeiterkind, dem jeder erdenkliche Reichtum zu Füßen gelegt wird …“
Während er seine Idee weiterspann, wurde Hilde ganz still. Sie musste wieder an ihre Hochzeitsnacht denken. Furchtsam und zugleich erwartungsvoll hatte sie ihren frisch angetrauten Ehemann erwartet. Es war ihre erste Nacht in seinem Haus. Sie trug ein knöchellanges Nachthemd, das ein kleines Vermögen gekostet hatte. Die Seide schmiegte sich wie eine zweite Haut an ihren Körper, auf den Stickereien saßen echte Perlen, die im weichen Kerzenlicht schimmerten. Große Blumenbouquets schmückten die Nachttische und ein kleines Kabinett.
Walter hatte lange im Bad gebraucht, als fürchte er sich plötzlich vor der Intimität. Mehr als einige keusche Küsse hatte es bis zu diesem Tag zwischen ihnen nicht gegeben. Schließlich trat er ihr in einem dunkelblauen Schlafanzug und einem Hausmantel gegenüber. Er lief einige Male auf und ab, suchte nach Worten, dann kniete er sich neben das Bett und nahm ihre Hand vorsichtig in seine. „Hast du Angst?“, fragte er weich und sah ihr dabei nicht in die Augen, sondern zu einem Punkt über ihrer Schulter.
„Ich bin ein wenig aufgeregt, aber Angst? Nein, das nicht“, erwiderte Hilde ehrlich. Sie wollte es vor allem hinter sich bringen. Das erste Mal mit einem Mann hatte sie in Raiks Armen erlebt und es genossen. Der Vollzug der Ehe mit Walter Degen war etwas, das sie erdulden musste. Es wurde so von ihr erwartet, und sie hatte sich geschworen ihm, so gut es ging, zu Gefallen zu sein.
Sie hatte auf dem Fest genug Champagner getrunken, dass sie sich zutraute, nicht die Nerven zu verlieren. Zumindest nicht, wenn er sich beeilte.
Sacht zog sie an seiner Hand. „Leg dich zu mir, mein Ehemann.“
Fragend zog er die Brauen zusammen. „Willst du das wirklich, nach allem, was diese Männer dir angetan haben?“
„Es wird gehen“, sagte sie nach einem Moment des Schweigens. Es war ja doch sinnlos, ihn zu korrigieren.
„Aber, Hilde, wir können warten … ich kann warten.“ Er sagte es, als würde er beinahe darauf hoffen.
Hilde wurde schlagartig die Kehle eng. Sie würde jetzt doch nicht weinen. „Willst du mich denn nicht?“, fragte sie mit brüchiger Stimme und im vollen Bewusstsein darüber, wie niederträchtig ihr Vorgehen war. Doch wenn er jetzt nicht mit ihr schlief, würde es vielleicht lange dauern, bis sie sich wieder überwinden konnte.
Er beugte sich hastig vor und küsste sie auf den Mund, presste seine Lippen so fest auf ihre, dass sie die Zähne darunter spürte. Unbeholfen kroch er zu ihr ins Bett. Der Blick war fiebrig, während er mit seinen großen Händen über ihre Haut rieb, knetete, tastete.
Hilde hielt einfach still. Nichts anderes wurde von einer unerfahrenen Beinahejungfrau erwartet. Walters Erregung nahm zu, sie hörte es an seinem Atem, doch seine Männlichkeit blieb schlaff. Er mühte sich noch eine Weile, dann entschuldigte er sich, schob es auf den Alkohol und legte sich neben sie.
Doch es war nicht der Alkohol gewesen. Denn jeder neue Versuch endete genauso. Hilde hatte schnell ihre Scheu überwunden, alles versucht – auch das ein oder andere wenig Damenhafte – und schließlich ebenfalls aufgegeben.
Und so konnte sie nun, im Dämmerlicht des Pensionszimmers, seufzend und im Brustton der Überzeugung auf Raiks Frage antworten: „Er wird wissen, dass es nicht von ihm ist.“
Seine Finger, die bis dahin ihr Ringelreih um Hildes Nabel fortgesetzt hatten, stoppten. Hilde sah an sich herab, und ihr wurde klar, dass sie zugenommen hatte. Wenn sie sonst auf dem Rücken lag, war ihr Bauch immer etwas eingesunken, nun wölbte er sich einen Hauch nach außen. Sie würde doch nicht, es konnte doch nicht …
„Raik!“
Er sah zu ihr auf, grinste. „Wenn Degen nicht Manns genoog ist, dann …“
Sie stieß wieder seinen Namen aus und schubste seine Hand zur Seite. „Sicher ist es dem guten Essen in der Kur geschuldet.“
„Dann hättest du auch an anderen Stellen zugenommen.“ Er kniff ihr liebevoll in die Schenkel. Hilde gab ihm eine Ohrfeige und setzte sich hektisch auf. Einsetzende Panik marschierte ihr Rückgrat hinab wie eine Armee von Ameisen. „Nein, nein, nein“, stotterte sie, doch das leichte Bäuchlein war im Sitzen sogar noch auffälliger. Raik hielt sich die Wange, aber die Ohrfeige hatte sein unverschämtes Grinsen nicht auszulöschen vermocht.
„Du Mistkerl!“ Hilde kämpfte mit den Tränen. Er versuchte, sie in den Arm zu nehmen, doch sie rutschte auf der anderen Seite vom Bett. „Fass mich nicht an!“
„Hilde. Hilde! Alles wird good.“
„Was soll denn daran gut werden? Er wird es herausfinden. Alles! Das mit uns …“ Nun liefen die Tränen, als sei ein Damm gebrochen. „Ich muss es wegmachen, dabei will ich doch ein Kind! Mit Walter werde ich nie eins bekommen.“
„Wegmachen? Wat seggst du denn da? Hör mir zu, Hilde.“ Raik war ihr gefolgt und fasste sie an den Schultern, doch sie schlug nach ihm, und er ließ sie wieder los. „Hilde! So hör doch!“
„Was denn, willst du mich weiter verhöhnen?“
„Im Gegenteil“, sagte er beschwörend. „Mi dücht, bist du nur ein paar Wochen länger schwanger, als du verheiratet bist. Es könnte von deinen Entführern sein, versteist du?“
„Nein, ich verstehe gar nichts!“ Sie schüttelte den Kopf, wieder und wieder. Raiks Gesicht wirkte durch die vielen Tränen verschwommen, sie konnte sein Mienenspiel nicht lesen. Und doch ahnte sie bereits, worauf er hinauswollte. Eigentlich hätte sie von selbst darauf kommen müssen, doch die aufkeimende Panik hatte im ersten Moment jeden klaren Gedanken überdeckt.
„Degen hat an de Ehe mit dir festgehalten, obwohl er glaubte, dass diese Männer Beischlaf mit dir hatten. Er wusste um das Risiko einer Schwangerschaft. Das hast du mir doch selbst vertellt, es waren deine eigenen Worte! Nur deshalb haben wir es gewagt, das erste Mal. Du denkst nicht klar, weil du so aufgeregt bist. Hilde, overlegg doch mal!“
Sie atmete tief durch und wischte ihre Tränen fort. Der Knoten, der ihre Brust zusammengedrückt hatte, schien sich zu lösen. Raik hatte recht. „Dann sind wir sicher?“
Er strich die Tränen von ihren Wangen. „Ja, wir sind sicher. Und unser Kind ist es ok.“
„Unser Kind“, wiederholte Hilde weich und berührte ihren Bauch. Aber was, wenn Walter es nur so dahingesagt hatte und nicht damit rechnete, dass der schlimmste Fall wirklich eintrat? Nun, es würde wohl nicht mehr lange dauern, bis sie es herausfand.










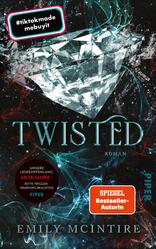






DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.