

Die Letzten werden die Ersten sein Die Letzten werden die Ersten sein - eBook-Ausgabe
Roman
— Unterhaltsame Satire auf den FitnesswahnDie Letzten werden die Ersten sein — Inhalt
„Shriver scheint uns immer ein paar Schritte voraus zu sein. Sie ist die Kassandra der amerikanischen Literatur.“ New York Times Book Review
„Ich habe beschlossen, einen Marathon zu laufen“, verkündet Remington Alabaster, noch bevor er auch nur ein einziges Mal joggen war. Seine Frau Serenata dagegen hat fast alle Sportarten dieser Welt ausprobiert, bis eine Arthrose in den Knien sie zur Untätigkeit verdammte. Bleiben ihrem Mann nur deswegen so viel Kraft und Elan, weil er sie sich 64 Jahre lang aufgespart hat? Serenatas Belustigung weicht bald dem puren Entsetzen.
Scharfzüngig und beschwingt schildert Lionel Shriver den Verfall unserer Körper und entwirft ein herrlich eigensinniges Paar, dessen Ehe durch einen aberwitzigen Entschluss ins Wanken gerät.
„Alt gegen jung, hässlich gegen schön, gesund gegen krank: Shriver stachelt alle gegeneinander auf, unterhaltsam und bissig.“ Der Spiegel
Leseprobe zu „Die Letzten werden die Ersten sein“
1
„Ich habe beschlossen, einen Marathon zu laufen.“
In einer zweitklassigen Sitcom hätte sie Kaffee über ihr Frühstück gespuckt. Aber Serenata war ein zurückhaltender Mensch und gerade zwischen zwei Schlucken. „Was?“ Ihr Ton war ein wenig spitzbübisch, aber höflich.
„Du hast mich schon verstanden.“ Am Herd lehnend, bedachte Remington sie mit einem irritierend ruhigen Blick. „Ich denke an den Lauf in Saratoga Springs im April.“
Sie hatte das Gefühl – selten in ihrer Ehe –, sie müsse achtgeben, was sie sagte. »Du meinst es ernst. Du willst mich nicht auf den [...]
1
„Ich habe beschlossen, einen Marathon zu laufen.“
In einer zweitklassigen Sitcom hätte sie Kaffee über ihr Frühstück gespuckt. Aber Serenata war ein zurückhaltender Mensch und gerade zwischen zwei Schlucken. „Was?“ Ihr Ton war ein wenig spitzbübisch, aber höflich.
„Du hast mich schon verstanden.“ Am Herd lehnend, bedachte Remington sie mit einem irritierend ruhigen Blick. „Ich denke an den Lauf in Saratoga Springs im April.“
Sie hatte das Gefühl – selten in ihrer Ehe –, sie müsse achtgeben, was sie sagte. „Du meinst es ernst. Du willst mich nicht auf den Arm nehmen.“
„Tue ich das oft? Dass ich eine Absichtserklärung abgebe und dann sage: April, April, war nur Spaß? Mir ist nicht klar, wie ich deinen Zweifel nicht als Beleidigung auffassen sollte.“
„Mein Zweifel könnte etwas mit der Tatsache zu tun haben, dass ich dich noch nie auch nur von hier ins Wohnzimmer habe laufen sehen.“
„Warum sollte ich ins Wohnzimmer laufen?“
Seine wörtliche Auslegung war nichts Ungewöhnliches. Für Remington und Serenata war es völlig normal, einander mit solchen Korinthenkackereien zu beharken. Es war ein Spiel. „In den letzten zweiunddreißig Jahren hast du dich kein einziges Mal zu einem Dauerlauf um den Block aufgerafft. Und jetzt erzählst du mir, ohne mit der Wimper zu zucken, dass du einen Marathon laufen willst. Du musstest damit rechnen, dass ich ein wenig überrascht sein würde.“
„Na, dann los. Sei überrascht.“
„Es stört dich nicht …“, Serenata schien ein gewisses Maß an Behutsamkeit weiterhin angeraten, obwohl sie mit Behutsamkeit lieber nichts am Hut gehabt hätte, „… dass dein Vorhaben hoffnungslos banal ist?“
„Überhaupt nicht“, sagte er leutselig. „Das ist etwas, das dich stört. Mal ganz abgesehen davon, dass mein Verhalten immer noch von der großen Masse der Menschen bestimmt wäre, wenn ich nur deshalb keinen Marathon laufen würde, weil so viele andere Leute es tun.“
„Was ist das hier, Projekt Löffelliste? Hast du deine alten Beatles-Platten gehört, und plötzlich ist dir klar geworden, dass sich When I’m Sixty-Four auf dich beziehen könnte? Löffelliste …“, wiederholte sie und schreckte zurück. „Wo habe ich das bloß her?“
Tatsächlich war das ständige Wiederholen dieses inzwischen dem allgemeinen Sprachgebrauch einverleibten Idioms genau die Art von lemminghaftem Verhalten, das sie zur Weißglut trieb. (Die Gleichsetzung tat den Lemmingen schweres Unrecht. In einer Dokumentation, die den Mythos ihres Massenselbstmords propagierte, hatten die Filmemacher die armen Kreaturen von der Klippe geworfen. Insofern war die berühmte, aber auf einem Trugschluss beruhende Metapher für massenhafte Konformität selbst ein Beispiel für massenhafte Konformität.) Okay, es war nichts verkehrt daran, sich einen neuen Begriff zu eigen zu machen. Was nervte, war die Tatsache, dass plötzlich alle munter und vollkommen selbstverständlich von ihrer Löffelliste redeten, als sei es das Normalste von der Welt.
Serenata hatte das Interesse an ihrem Tablet und den Neuigkeiten aus Albany verloren und stemmte sich aus ihrem Stuhl hoch. Sie waren erst vor vier Monaten nach Hudson gezogen, und sie fragte sich, wie lange sie die Verbundenheit zu ihrer ehemaligen Heimatstadt noch vorzutäuschen gewillt sein würde, indem sie online die Times Union las.
Sie selbst war erst sechzig – allerdings war ihre Generation die erste, die einen derart ernüchternden Sachverhalt mit dem Zusatz erst versah. Nachdem sie eine halbe Stunde in derselben Stellung verharrt hatte, waren ihre Knie steif geworden, und das rechte zu strecken erwies sich als knifflig. Wenn es einmal verkrampft war, konnte man es nur sehr langsam aus seiner Position befreien. Außerdem wusste sie nie genau, wann eines der Knie etwas Gruseliges oder Unerwartetes veranstalten würde – zum Beispiel plötzlich Pong machen und ein bisschen aus dem Gelenk springen und dann wieder zurück. Das war es, was alte Leute beschäftigte und wovon sie redeten. Sie wünschte, sie könnte sich bei ihren verstorbenen Großeltern, deren medizinisches Gejammer sie als Kind kaum hatte ertragen können, nachträglich entschuldigen. Alte Menschen unterschätzten die erbarmungslose Selbstbezogenheit ihrer Nächsten und Liebsten und ergingen sich in detaillierten Schilderungen der eigenen Leiden, weil sie unterstellten, dass jeder, der sich für sie interessierte, sich auch für ihre Schmerzen interessieren würde. Doch niemand hatte sich für die Schmerzen ihrer Großeltern interessiert, und jetzt würde sich niemand für die Schmerzen von deren Enkeltochter interessieren, die einst so gefühlskalt gewesen war. Brutale Gerechtigkeit.
Der Übergang in den aufrechten Stand war ein Erfolg. Herrje, welche mickrigen Errungenschaften würden ihr in ein paar Jahren als Triumph erscheinen. Sich an das Wort Mixer zu erinnern. Einen Schluck Wasser zu trinken, ohne das Glas fallen zu lassen. „Hast du dir über den Zeitpunkt dieser Ankündigung Gedanken gemacht?“ Sie stöpselte das Tablet ein – Beschäftigungstherapie; die Batteriekapazität war noch bei 64 Prozent.
„Was ist damit?“
„Er fällt mit einer gewissen Invalidität zusammen. Ich habe gerade erst im Juli mit dem Laufen aufgehört.“
„Ich wusste, dass du es persönlich nimmst. Darum hatte ich Angst, es dir zu erzählen. Willst du wirklich, dass ich mir etwas versage, nur weil es bei dir ein Gefühl der Wehmut auslöst?“
„Wehmut. Du meinst, das löst bei mir ein Gefühl der Wehmut aus?“
„Missgunst“, korrigierte sich Remington. „Aber wenn ich mich auf ewig an einen Stuhl fessele, ist deinen Knien damit auch nicht geholfen.“
„Ja, das ist alles sehr rational.“
„Das hört sich an, als wolltest du mich kritisieren.“
„Du findest es also irrational, auf die Gefühle deiner Frau Rücksicht zu nehmen.“
„Wenn ein Opfer, das ich erbringe, nicht dazu führt, dass sie sich besser fühlt, dann ja.“
„Du planst das schon länger?“
„Seit ein paar Wochen.“
„Hat dieses untypische Erwachen eines Interesses an körperlicher Betätigung deiner Meinung nach irgendwas mit den Vorfällen im Amt für Transport und Verkehr zu tun?“
„Nur insofern, als mir die Vorfälle im Amt ein unerwartetes Maß an Freizeit beschert haben.“ Obwohl er das Thema damit vom Tisch gewischt hatte, machte es Remington nervös. Er kaute auf der Innenseite seiner Wange herum, wie es seine Art war, und sein Ton wurde eisig und säuerlich, garniert mit ein paar Tropfen Bitterkeit, wie ein Cocktail.
Serenata verachtete Frauen, die ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, indem sie in der Küche herumlärmten, aber es kostete sie ein geradezu lächerliches Maß an Selbstbeherrschung, nicht die Spülmaschine auszuräumen. „Wenn du Probleme hast, deinen Terminkalender zu füllen, vergiss nicht, warum wir überhaupt hergezogen sind. Der letzte Besuch bei deinem Vater ist schon wieder verdammt lange her, und in seinem Haus gibt es an allen Ecken und Enden etwas zu reparieren.“
„Ich werde nicht den Rest meines Lebens unter der Spüle meines Vaters verbringen. Ist das deine Methode, mir den Marathon auszureden? Das kannst du doch besser.“
„Nein, ich möchte selbstverständlich, dass du tust, was immer du tun willst.“
„So selbstverständlich scheint mir das nicht zu sein.“
Die Spülmaschine hatte sich als unwiderstehlich erwiesen. Serenata hasste sich dafür.
„Du bist so lange gelaufen …“
„Siebenundvierzig Jahre lang“, sagte sie schroff. „Gelaufen, und noch vieles andere mehr.“
„Also – vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben.“ Remingtons Vorschlag kam zögerlich. Er wollte keine Tipps.
„Vergiss nicht, dir die Schuhe zuzubinden. Sonst gibt es weiter nichts zu bedenken.“
„Schau mal … Es tut mir wirklich leid, dass du etwas aufgeben musstest, was du geliebt hast.“
Serenata richtete sich auf und stellte eine Schüssel ab. „Ich habe das Laufen nicht geliebt. Hier ist doch ein Tipp für dich: Niemand liebt das Laufen. Die Leute behaupten das, aber sie lügen. Das einzig Gute ist, gelaufen zu sein. Während man es tut, ist es öde und hart im Sinne von anstrengend, aber nicht im Sinne von schwierig zu bewältigen. Es ist monoton. Es führt nicht geradewegs in die Offenbarung, wie man dich garantiert hat glauben machen. Wahrscheinlich bin ich dankbar dafür, dass ich eine Entschuldigung habe aufzuhören. Vielleicht ist es das, was ich mir nicht verzeihen kann. Aber immerhin bin ich endlich der riesigen Meute von Schwachköpfen entronnen, die auf dieser Welle mitreiten und sich für etwas verdammt Besonderes halten.“
„Schwachköpfen wie mir.“
„Schwachköpfen wie dir.“
„Du kannst mich nicht dafür verachten, dass ich etwas tue, was du, ich zitiere, siebenundvierzig Jahre lang getan hast.“
„Ach nein?“, sagte sie mit einem verbissenen Lächeln, bevor sie sich zur Treppe umwandte. „Wart’s ab.“
Remington Alabaster war ein schlanker, hochgewachsener Mann, der sich seine Figur scheinbar ohne Mühe hatte erhalten können. Seine Gliedmaßen waren von Geburt an wohlgeformt. Mit ihren schmalen Fesseln, festen Waden, glatten Knien und Oberschenkeln, die nicht schlabberten, hätten diese Beine nach einer kurzen Rasur jeder Frau zur Ehre gereicht. Er hatte schöne Füße – ebenfalls schlank, mit hohem Spann und langen Zehen. Wann immer Serenata ihm die Fußsohlen massierte, waren sie trocken. Die Muskeln seiner unbehaarten Brust waren erfreulich dezent, und sollten sie infolge andauernden verbissenen Bankdrückens je übermäßig an Umfang zulegen, würde Serenata eine solche Transformation als Verlust empfinden. Zugegeben, in den letzten Jahren hatte sich bei ihm oberhalb der Gürtellinie ein kleiner Wulst gebildet, den zu erwähnen sie vermied. So lautete doch wohl die unausgesprochene Vereinbarung aller Paare: Solange er das Thema nicht von sich aus ansprach, waren derartige Schwankungen des körperlichen Zustands allein seine Sache. Weshalb sie sich am Morgen, obwohl sie sehr versucht gewesen war, die Frage verkniffen hatte, ob es bei diesem Marathonquatsch nicht einzig darum ging, dass er angesichts einer Gewichtszunahme von schätzungsweise höchstens zweieinhalb Kilo durchdrehte.
Abgesehen von dem harmlosen Wulst alterte Remington gut. Seine Gesichtszüge waren immer schon markant gewesen. Die Maske der Unempfindlichkeit, die er sich in den letzten Jahren seines Berufslebens zugelegt hatte, war eine Abwehrreaktion, eine Schutzmaßnahme, für die allein eine gewisse Lucinda Okonkwo verantwortlich gemacht werden konnte. Seit er sechzig geworden war, schienen jene Gesichtszüge wie von einer Ascheschicht überzogen: Es war diese Homogenisierung des Teints, die hellhäutigen Gesichtern mit zunehmendem Alter ein immer unprägnanteres, konturloseres und irgendwie verschossenes Aussehen verlieh, Vorhängen gleich, deren einst kräftige Farben und Muster von der Sonne ausgebleicht worden waren. Doch vor ihrem inneren Auge pflegte Serenata die ergraute, provisorischere Gegenwart mit den entschiedeneren Zügen seines jüngeren Gesichts zu überblenden, sie zog die Linien um die Augen nach und rötete seine Wangen, als würde sie ihn im Geiste schminken.
Sie sah ihn. Sie konnte ihn mit einem einzigen Blick in unterschiedliche Altersstufen versetzen und sogar, wenn auch unfreiwillig, in dem immer noch vitalen Gesicht den gebrechlichen alten Mann erkennen, der er einmal sein würde. Diesen Mann in seiner Gänze zu erfassen, als den, der er jetzt war, als den, der er einmal gewesen war, und als den, der er einmal sein würde, darin bestand ihre Aufgabe. Es war eine bedeutsame Aufgabe, umso bedeutsamer, da er alterte, denn für ihre Mitmenschen wäre er bald nichts weiter als ein greiser Knacker. Aber er war nicht bloß ein greiser Knacker. Mit siebenundzwanzig hatte sie sich in einen attraktiven Bauingenieur verliebt, und der steckte immer noch in ihm. Es war verwirrend: Andere Menschen alterten Tag für Tag und bemerkten die geheimnisvollen Veränderungen an sich selbst, für die sie nicht notwendigerweise die Verantwortung trugen. Sie wussten von sich, dass sie einmal jünger gewesen waren. Aber Junge wie Alte nahmen andere in ihrer Umgebung gleichermaßen als unbewegliche Konstanten wahr, wie Parkschilder. Wer fünfzig war, war fünfzig und sonst nichts, war es immer gewesen und würde es immer bleiben. Permanent seine Vorstellungskraft einzusetzen war vielleicht schlicht zu anstrengend.
Auch war es ihre Aufgabe, ihren Mann mit Wohlwollen zu betrachten. Dinge zu sehen und zu übersehen. Mit den Augen zu blinzeln und die Ausbrüche unwillkommener Hautveränderungen zu glätten – zu einer Alabaster-Oberfläche. Eine Generalamnestie für sämtliche Leberflecken, für jede sich durch Erosion vertiefende Spalte zu erlassen. Der einzige Mensch auf Erden zu sein, der die leichte Verdickung unter seinem Kinn nicht als Charakterschwäche deutete. Der einzige Mensch, der aus dem schütter werdenden Schläfenhaar nicht den Schluss zog, dass es auf ihn nicht mehr ankam. Im Gegenzug würde Remington ihr die runzeligen Ellenbogen verzeihen und die scharfe Linie entlang ihrer Nase, wenn sie zu lange auf der rechten Seite geschlafen hatte – eine tiefe Einkerbung, die bis weit in den Nachmittag hinein Bestand haben konnte und bald gar nicht mehr verschwinden würde. Sollte er registriert haben, und es konnte ihm unmöglich entgangen sein, dass die körperliche Beschaffenheit seiner Frau nicht mehr identisch war mit der jener Frau, die er einst geheiratet hatte, so wäre Remington der Einzige, der dies nicht als Zeichen dafür deuten würde, dass sie etwas falsch gemacht hatte, vielleicht sogar auf moralischer Ebene. Er würde ihr nicht vorhalten, dass sie eine Enttäuschung sei. Auch das war Teil der Vereinbarung. Es war ein guter Deal.
Doch dafür, dass Remington, als sie sich kennenlernten, nicht in eine Schutzhülle aus Plastik eingeschweißt gewesen war wie ein Personalausweis, musste er das schier grenzenlose Vergebungspotenzial seiner Frau kaum anzapfen. Für vierundsechzig sah er verdammt gut aus. Es sei dahingestellt, wie er es geschafft hatte, ohne nennenswerte körperliche Ertüchtigung so schlank, dynamisch und wohlproportioniert zu bleiben. Sicher, er ging viel zu Fuß und nahm ohne Murren die Treppe, wenn irgendwo ein Fahrstuhl nicht funktionierte. Aber weder hatte er irgendwelche Sieben-Minuten-Ganzkörper-Work-outs ausprobiert, noch war er jemals Mitglied in einem Fitnessstudio gewesen. Mittags aß er zu Mittag.
Mehr Sport würde seine Durchblutung ankurbeln, den Gefäßwiderstand erhöhen und dem Abbau kognitiver Fähigkeiten vorbeugen. Sie hätte sich über seinen Sinneswandel freuen sollen. Hätte ihn mit Proteinriegeln füttern und auf einem Schreibblock in der Diele voller Stolz die Fortschritte bei der Erweiterung seiner Laufstrecke aufzeichnen sollen.
Die ganze Nummer mit der Unterstützung wäre natürlich machbar gewesen, wenn er sein Vorhaben mit dem gebührenden Verdruss angekündigt hätte: „Mir ist schon klar, dass ich die Distanzen, die du früher gelaufen bist, niemals auch nur annähernd schaffen werde. Dennoch frage ich mich, ob es nicht vielleicht gut für mein Herz wäre, wenn ich zwei- oder dreimal die Woche, na, sagen wir, bescheidene drei Kilometer laufen würde.“ Aber nein. Es musste gleich ein Marathon sein. Für den Rest des Tages widmete sich Serenata voller Hingabe der Vortäuschung intensiver Berufsausübung, um ihrem Mann aus dem Weg zu gehen. Sie kam erst nach unten, um sich einen Tee zu machen, als sie hörte, dass er das Haus verlassen hatte. Das war nicht nett, nicht rational, aber die spezifische Teilmenge an menschlicher Erfahrung, um die es hier ging, gehörte ihr, und sein Timing war nun einmal grausam.
Wahrscheinlich hatte bei ihr alles damit angefangen, dass sie selbst andere nachmachte – auch wenn es sich damals nicht so angefühlt hatte. Ihre beiden Eltern bewegten sich wenig und neigten zur Fülligkeit, und daraus wurde, was in der Natur der Sache lag, schnell Übergewicht. Ihre Vorstellung von körperlicher Betätigung bestand im Rasenmähen mit Handmäher, doch der wurde bei der erstbesten Gelegenheit gegen einen Motormäher eingetauscht. Was an sich nicht zu kritisieren war. Im Amerika ihrer Kindheit waren „arbeitssparende Gerätschaften“ schwer angesagt. Die Reduktion des Einsatzes persönlicher Energie stand in den Sechzigerjahren hoch im Kurs.
Als Marktanalyst für Johnson & Johnson musste ihr Vater ungefähr alle zwei Jahre den Ort wechseln. Serenata war im kalifornischen Santa Ana geboren, hatte aber nicht die Möglichkeit gehabt, die Stadt richtig kennenzulernen, ehe die Familie nach Jacksonville, Florida, gezogen war. Bald ging es weiter nach West Chester, Pennsylvania; Omaha, Nebraska; Roanoke, Virginia; Monument, Colorado; Cincinnati, Ohio, und schließlich an den Hauptsitz des Unternehmens in New Brunswick, New Jersey. Die Folge war, dass sie keine regionale Bindung entwickelte und zu einem der seltenen Geschöpfe wurde, deren einziger geografischer Identifikator das große schlabbrige Land als Ganzes war. Sie war Amerikanerin, ohne genauere Kennung oder Ergänzung – denn sich als Amerikanerin mit griechischen Wurzeln zu bezeichnen, nachdem sie in ihrer Kindheit kaum einmal eine Schüssel Avgolemono-Suppe gelöffelt hatte, wäre ihr verzweifelt vorgekommen.
Da sie als Mädchen von einer Schule auf die nächste wechseln musste, war sie argwöhnisch geworden, was den Aufbau von Beziehungen anging. Erst im Erwachsenenalter hatte sie eine Vorstellung von Freundschaft entwickelt, aber auch dann nicht ohne Schwierigkeiten – sie neigte dazu, Weggefährten aus bloßer Gedankenlosigkeit aus den Augen zu verlieren, so wie man auf der Straße ein Paar Handschuhe verbummelte. Für Serenata war Freundschaft eine Fertigkeit. Sie war allzu einverstanden mit sich selbst, und manchmal hatte sie sich gefragt, ob es vielleicht ein Manko war, sich nicht einsam zu fühlen.
Ihre Mutter war den zahllosen örtlichen Verpflanzungen auf ihre Weise begegnet, indem sie, sobald die Familie in einer neuen Stadt Quartier bezog, an zahlreichen Kirchen- und Freiwilligengruppen andockte wie ein Oktopus auf Speed. Dank der mit diesen Mitgliedschaften einhergehenden permanenten Zusammenkünfte war ein Einzelkind zwangsläufig auf sich gestellt, ein Umstand, der Serenata alles in allem behagte. Als sie alt genug war, sich ihre Fluffernutter-Sandwiches selbst zu schmieren, verbrachte sie ihre unbeaufsichtigte Zeit nach Schulschluss mit dem Aufbau von Kraft und Kondition.
Sie legte dann zum Beispiel die Handflächen auf den Rasen und zählte, wie viele Sekunden – eins-eintausend, zwei-eintausend – sie es schaffte, die gestreckten Beine dreißig Zentimeter über dem Boden schweben zu lassen (entmutigend kurz, aber es war ja erst der Anfang). Oder sie packte einen tief hängenden Ast und mühte sich damit ab, das Kinn darüber zu bringen, lange bevor sie erfuhr, dass diese Übung Klimmzug genannt wurde. Sie erfand ihre eigene Gymnastik. Beim sogenannten Beinbruch musste man auf einem Fuß einmal rund um den Garten hüpfen, während das andere Bein wie beim Entengang nach vorne gestoßen wurde, und das Ganze dann rückwärts wiederholen. Für sogenannte Rolly-Pollies legte man sich ins Gras, zog die Knie an die Brust, schaukelte auf dem Rücken eins-zwei-drei! vor und zurück, um dann die Beine gerade über den Kopf zu werfen; später erweiterte sie den Abschluss der Übung um eine Kerze. Als Erwachsene erinnerte sie sich beklommen und ungläubig daran, dass es ihr, wenn sie mit ihren selbst erfundenen Übungen ihre eigene Gartenolympiade veranstaltete, nie in den Sinn gekommen war, die Kinder aus der Nachbarschaft einzuladen.
Viele ihrer Verrenkungen hatten etwas Albernes, aber wenn sie sie nur oft genug wiederholte, war sie immerhin reichlich erschöpft. Angenehm erschöpft, obwohl nicht einmal diese selbst ausgedachten Übungen – über die sie in einem gebundenen Notizheft, das sie unter ihrer Matratze versteckte, in verkrumpelten Druckbuchstaben akribisch und heimlich Buch führte – ihr wirklich Spaß machten. Es schien ihr interessant herauszufinden, dass es möglich war, keine besondere Lust darauf zu haben und sie trotzdem zu absolvieren.
Während der Physical Education ihrer Schulzeit waren die mickrigen athletischen Ansprüche, die an Mädchen gestellt wurden, eine der wenigen Konstanten, denen sie in Jacksonville, West Chester, Omaha, Roanoke, Monument, Cincinnati und New Brunswick gleichermaßen begegnete. In der Grundschule wurde in der halbstündigen Pause meist Kickball gespielt – und wenn man es schaffte, unterwegs zu sein, ehe die Mitspielerinnen das Inning verloren, durfte man vielleicht ganze zehn Meter zur First Base laufen. Völkerball war noch absurder: mit dem einen Fuß in die eine Richtung springen, mit dem anderen in die andere. Beim regulären Sportunterricht in der Mittelstufe gingen zwanzig der fünfundvierzig Minuten für das An- und Ausziehen der Sportklamotten drauf. Die Sportlehrerinnen wiesen die Mädchen unisono an, zehn Hampelmänner und fünf Burpees zu machen und dann für dreißig Sekunden auf der Stelle zu laufen. Nach einem derart schlaffen Herumgestrampel, das die Bezeichnung Krafttraining kaum verdiente, war es im Grunde nicht fair, die Fitness ebendieser Mädchen in der achten Klasse einer formalen Wertung zu unterziehen – wobei die Sportlehrerin, nachdem Serenata bei den Sit-ups die Einhundertermarke erreicht hatte, einschritt und ihr mit panikschriller Stimme aufzuhören befahl. In den folgenden Jahrzehnten sollte sie Sit-ups in Fünfhundertergruppen absolvieren. Sit-ups waren nicht wirklich effizient, was die Bauchmuskulatur betraf, aber Serenata hatte eine Schwäche für die Klassiker.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Serenata Terpsichore – was sich auf Hickory reimte, auch wenn sie sich mit Lehrern hatte abfinden müssen, die den Namen auf der ersten Silbe betonten und die letzte wie eine lästige Pflicht nachschleppten – hatte keinerlei Ambitionen, im Leistungssport zu reüssieren. Sie wollte keinen Platz in der Volleyballnationalmannschaft ergattern. Sie wollte nicht zum Ballett. Sie hatte es nicht auf Meisterschaften für Gewichtheberinnen abgesehen oder darauf, Adidas als Sponsor zu gewinnen. Sie hatte es nie auch nur in die Nähe irgendeiner Rekordmarke geschafft und es auch nicht versucht. Das Aufstellen von Rekorden lief letztendlich darauf hinaus, die eigenen Leistungen in Relation zu den Leistungen anderer zu setzen. Es stimmte, sie hatte sich seit ihrer Kindheit tagtäglich drastische, selbst erfundene körperliche Leistungen abverlangt, aber das hatte rein gar nichts mit anderen zu tun. Liegestütze waren Privatsache.
Serenata hatte nie eine tiefere Beziehung zu irgendeiner bestimmten Sportart entwickelt. Sie lief, sie radelte, sie schwamm; sie war weder Läuferin noch Schwimmerin noch Radsportlerin, alles Bezeichnungen, die es diesen bloßen Fortbewegungsarten erlaubt hätten, einen Anspruch auf sie zu erheben. Auch war sie kein, wie hieß es so schön, Teamplayer. Auf einer in ihren Augen idealen Laufstrecke war sie allein. Sie genoss die Ruhe eines leeren Schwimmbeckens. Seit zweiundfünfzig Jahren war das Fahrrad ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel, und jeder in Sichtweite befindliche Radfahrer beraubte sie ihrer Einsamkeit und verdarb ihr die Stimmung.
Wenn man davon ausging, dass Serenata auf einer einsamen Insel in der Gesellschaft von Fischen prächtig hätte gedeihen können, war es befremdlich, dass sie so häufig von der Masse der Menschen, wie Remington es ausgedrückt hatte, kooptiert worden war. Früher oder später wurde jede Marotte, jede merkwürdige Angewohnheit oder Obsession von einer Menschenmasse kolonisiert.
Mit sechzehn hatte sie, einem Impuls folgend, ein düsteres Etablissement in Cincinnati aufgesucht, um sich auf der zarten Innenseite ihres rechten Handgelenks ein winziges Tattoo stechen zu lassen. Das Design, für das sie sich entschied, war im wahrsten Sinne des Wortes aus der Luft gegriffen: eine fliegende Hummel. Da keine weiteren Kunden im Studio waren, nahm sich der Tätowierer Zeit. Kunstvoll stach er die transparenten Flügel, die forschenden Fühler, die zur Landung bereiten feinen Beinchen. Das Motiv hatte nichts mit ihr zu tun. Doch wer ein Wesen aus dem Nichts erschuf, griff auf das zurück, was auf der Hand lag; wir alle waren Kunstwerke, die sich der Zufälligkeit verdankten. Und so verwandelte sich das Willkürliche schon bald in ein Markenzeichen. Die Hummel wurde ihr Emblem, unzählige Male auf die Leinendeckel ihrer Ringbücher gekritzelt.
In den Siebzigern waren Tattoos im Wesentlichen Hafenarbeitern, Seeleuten, Gefängnisinsassen und Motorradgangs vorbehalten. Für eigensinnige Kinder der Mittelschicht bedeuteten sie, die damals noch nicht Tats hießen, eine Art Schändung. In jenem Winter verbarg Serenata die Tätowierung vor ihren Eltern mittels langer Ärmel. Im Frühjahr dann wechselte sie ihre Armbanduhr aufs rechte Handgelenk, mit dem Zifferblatt nach unten. Sie lebte in der ständigen Furcht, entdeckt zu werden, während die Geheimhaltung das Bild zugleich mit gewaltigen Kräften auflud. Rückblickend wäre es würdiger gewesen, die Verstümmelung freiwillig zu gestehen und die Konsequenzen zu tragen, aber das war die Sichtweise eines Erwachsenen. Junge Menschen, für die die Zeit wie im Flug verging, sodass es in jedem Augenblick den Anschein hatte, als könnte die Gnadenfrist ewig währen, legten viel Wert aufs Hinauszögern.
Unweigerlich verschlief sie eines Morgens den Wecker. Ihre Mutter, die gekommen war, um die Schlafmütze hochzuscheuchen, erspähte das bloße, nach oben gekehrte Handgelenk. Nachdem der Teenager zugegeben hatte, dass das Bildchen nicht aus einem Filzstift stammte, fing ihre Mutter an zu weinen.
Der entscheidende Punkt: Serenata war auf der Highschool wahrscheinlich die einzige Schülerin mit Tattoo. Heute dagegen? Mehr als ein Drittel der Achtzehn- bis Fünfunddreißigjährigen hatten mindestens ein Tattoo, und die Gesamtfläche amerikanischer Haut, auf der es von Hobbits, Stacheldraht oder Barcodes, von Augen, Tigern oder Tribals, von Skorpionen, Totenköpfen oder Superhelden nur so wimmelte, entsprach der Größe von Pennsylvania. Serenatas abenteuerliche Reise in die Unterwelt hatte sich vom Kühnen ins Banale verkehrt.
In ihren Zwanzigern, frustriert darüber, dass sich in herkömmlichen Haargummis Strähnen ihres dicken schwarzen Haars verfingen, nähte Serenata Röhren aus buntem Stoff, durch die sie kräftige Gummibänder fädelte. Sie knotete die Enden der Gummibänder zusammen und vernähte die Stoffröhren zu geschlossenen Ringen. Das Ergebnis waren Haargummis, die ihr die Haare aus dem Gesicht hielten, ohne sich in ihnen zu verfangen, und die zugleich ihrer Haarpracht einen gewissen Pep verliehen. Einige Freundinnen fanden die Handarbeit überkandidelt, aber nicht wenige ihrer Arbeitskolleginnen wollten wissen, wo man so ein Ding bekommen könne. Bis in den Neunzigern plötzlich die meisten ihrer Landsmänninnen mindestens fünfundzwanzig Exemplare in allen erdenklichen Farben besaßen. Sie kappte ihr Haar knapp unterhalb der Ohren und warf die inzwischen offenbar Scrunchies genannten Haargummis in den Müll.
Es musste auch ungefähr 1980 gewesen sein, als sie einen ihrer aufwendigen Anläufe unternahm, Freundschaften zu schließen, und eine Handvoll Kolleginnen von der Kundenbetreuung bei Lord & Taylor zum Abendessen einlud. In den vorangegangenen Jahren hatte sie mit der japanischen Cuisine herumgestümpert, getrieben von einem Enthusiasmus, den sie der aussichtslosen Affäre mit einem Mann verdankte. Er hatte sie zu einem Hole-in-the-Wall mitgenommen, wo seine ausgewanderten Landsleute es sich schmecken ließen. Sie war begeistert von der Glätte, der Kühle, der Raffinesse. Zu Hause experimentierte sie mit Sushireis, grünem Wasabipulver und einem scharfen Messer. Erpicht darauf, ihre Entdeckungen mit anderen zu teilen, servierte sie ihren Gästen eine Vielzahl von Gerichten, in der Hoffnung, jenen Effekt zu erzielen, der später als Wow-Faktor bekannt werden sollte.
Doch ihre Kolleginnen waren entsetzt. Keines der Mädchen konnte die Vorstellung ertragen, rohen Fisch zu essen.
Heute dagegen ließen sich rund um einen einzigen Block in einer mittelgroßen Stadt in Iowa problemlos drei verschiedene Sushibars entdecken. Jeder noch so trostlose Student hatte eine Vorliebe für Fluss- oder Seeaal. Natürlich konnte Serenata für die jahrhundertealten Traditionen einer sagenumwobenen Inselnation im Osten keinerlei Urheberrecht beanspruchen. Und doch, was einst eine Besonderheit gewesen war, fiel nun unter Crowdfunding.
Die Armbanduhr, die ihre Sünde der Selbstverstümmelung verdeckt hatte? Sie hatte hervorragend als Tarnung getaugt, weil sie von ihrem Vater stammte. Seither hatte Serenata immer übergroße Männerarmbanduhren getragen. Und siehe da, in den 2010er-Jahren trugen alle Frauen auf einmal wuchtige Männeruhren. Lieblingsbücher, die bei Erscheinen kein oder kaum Aufsehen erregt hatten – Ein Zuhause am Ende der Welt oder Die Stadt am Ende der Zeit –, wurden samt und sonders verfilmt, und plötzlich waren diese privaten Totems öffentliches Eigentum. Kaum hatte sie, bevor irgendjemand auch nur wusste, dass es so etwas gab, die fast vergessene Kunst des Quiltnähens, des Zusammensteppens von Stücken abgetragener Cordhosen und alter Handtücher wiederbelebt – wobei sie Breaking Bad schaute –, schon schossen mit epidemischer Wucht überall im Land aufs Quiltnähen spezialisierte Handarbeitsgruppen aus dem Boden. Sollte sich Serenata Terpsichore jemals für eine obskure Band begeistern, die ausschließlich in mickrigen Clubs oder auf Hochzeiten spielte, dann stiegen genau diese Nobodys im darauffolgenden Jahr garantiert in die Top 40 auf. Sollte sie sich, um besser durch den Winter in Albany zu kommen, unglaublich warme, weiche Lammfellstiefel anschaffen, die bis dahin ausschließlich in der kleinen australischen und kalifornischen Surferszene populär gewesen waren, konnte man sicher sein, dass Oprah Winfrey bald die gleiche Entdeckung machen würde. Grrr.
Vielen anderen Menschen musste Ähnliches widerfahren sein. Es gab nur eine begrenzte Anzahl von Dingen, die man anziehen, toll finden, tun konnte. Und es gab zu viele Menschen. Also wurde alles, was man für sich selbst beanspruchte, früher oder später von mehreren Millionen Gleichgesinnter adaptiert. Was bedeutete, dass man sich entweder von den eigenen Begeisterungen verabschieden oder sich wie betäubt dem Erscheinungsbild sklavischer Konformität unterwerfen musste. Meistens hatte sich Serenata für Letzteres entschieden. Und trotzdem kam es ihr jedes Mal wie eine Art Belagerungszustand vor, als würde eine Horde Fremder in ihrem Garten campieren.
Und so war es im Laufe der vergangenen zwanzig Jahre auch mit jeglicher Form von Sport gewesen, die sich stetig und doch mit wachsender Geschwindigkeit ausbreitete. Sie konnte sie förmlich hören, ein Getrampel in ihrem Schädel wie von einer wild gewordenen Herde Gnus. Staub stieg ihr in die Nase, das Gestampfe der Hufe kam vom Horizont her immer näher. Diesmal hockten die Vielen nicht ruhig und isoliert in ihren Häusern und äfften ihren Musik- und Literaturgeschmack nach, nein, sie kamen massenweise, überzogen in Scharen die Hügel und Täler öffentlicher Parks, sie platschten in geschlossener Front über alle sechs Bahnen ihres angestammten Schwimmbades, sie traten als Horden von Radfahrern mit gesenktem Kopf hechelnd und keuchend in die Pedale, jeder versessen darauf, das Gefährt vor sich zu überholen, nur um an der nächsten roten Ampel anhalten zu müssen – wo die Meute lauerte, bereit, über die anderen herzufallen wie Hyänen. Diesmal war der Einbruch in ihr Territorium keine bloße Metapher, er ließ sich in Quadratmetern messen. Und nun hatte sich ihr geliebter Ehemann unter die hirnlosen, uniformen Geschöpfe dieser dampfenden Herde gemischt.
2
Obwohl das rechte Knie bei jedem Schritt protestierte, weigerte sich Serenata, die Treppe Stufe für Stufe zu nehmen wie ein Kleinkind. Als sie am nächsten Nachmittag heruntergehumpelt kam, saß Remington im Wohnzimmer. Auch wenn sie sich noch nicht daran gewöhnt hatte, dass er unter der Woche zu Hause war, wäre es nicht in Ordnung gewesen, dem eigenen Ehemann die Anwesenheit übel zu nehmen, wo es doch auch sein Haus war. Die Frühpensionierung war nicht seine Idee gewesen, oder, genauer gesagt, seine Schuld.
Sein Aufzug allerdings war in jeder Hinsicht irritierend: Leggings, grüne Funktionsshorts, darunter leuchtend violette Kompressionsshorts und ein glänzend grünes Shirt mit violetten Netzeinsätzen zur Belüftung – ein komplettes Set, dessen Preisschild noch hinten am Kragen baumelte. Am Handgelenk schimmerte eine neue Sportuhr. Bei einem jüngeren Mann hätte das rote Stirnband vielleicht verwegen gewirkt, bei Remington mit seinen vierundsechzig Jahren sah es nach einer Verkleidung aus, die jeder Kinogänger auf den ersten Blick entschlüsselt hätte: Dieser Typ ist ein Vollidiot. Und wenn das Stirnband nicht reichen sollte, genügte in jedem Fall ein Blick auf die orangefarbenen Air-Traffic-Control-Schuhe mit Zierstreifen, auch die violett.
Erst als Serenata hereinkam, beugte er sich vor und umfasste mit beiden Händen eines seiner Sprunggelenke. Er hatte auf sie gewartet.
Also schön, sie sah ihm zu. Er hielt das Sprunggelenk, hob dann die Arme über den Kopf und tauchte hinab zum anderen Bein. Als er auf einem Fuß ins Wanken geriet, während er das andere Knie vor die Brust zog, ging sie, um sich einen Earl Grey zu machen. Bei ihrer Rückkehr stand er da, beide Hände an der Wand abgestützt, und dehnte einen Wadenmuskel. Das ganze Ritual roch verdächtig nach Internet.
„Mein Lieber“, sagte sie. „Es spricht einiges dafür, dass Dehnübungen ihr Gutes haben, aber erst nach dem Laufen. Vorher haben sie nur einen einzigen Zweck, nämlich das Unangenehme hinauszuzögern.“
„Du bist echt zickig, was das Thema angeht.“
„Wahrscheinlich“, sagte sie leichthin und rauschte nach oben ab. Als die Haustür ins Schloss fiel, traute sie sich auf die Seitenveranda im ersten Stock und lugte über das Geländer. Nachdem er minutenlang auf die komplizierte Armbanduhr eingestochert hatte, brach der Unerschütterliche zu seinem Antrittslauf auf – er trottete durchs Gartentor und die Union Street hinunter. Sie hätte ihn als Spaziergängerin überholen können.
Der Impuls war boshaft, aber sie sah auf die Uhr. Zwölf Minuten später hörte sie die Haustür wieder auf- und zugehen. Fürs Duschen würde er länger brauchen. War das die Art, wie sie dieses Martyrium durchstehen wollte? Mit Herablassung? Es war erst Oktober. Es würde ein langer Winter werden.
„Wie war das Laufen?“, zwang sie sich während eines wortkargen Abendessens zu fragen.
„Erfrischend“, verkündete er. „Ich fange an zu verstehen, warum du das gemacht hast, all die siebenundvierzig Jahre.“
Aha. Warte ab, bis es kalt wird, bis der Schneeregen einsetzt und dir der Sturm ins Gesicht bläst. Warte ab, bis dein Gedärm sich meldet und du noch zehn Kilometer zu laufen hast, bis du dich zusammenkauerst zu einem verkrampften Knäuel und hoffst, dass du es schaffst, ehe sich alles in deine glänzend grünen Shorts entlädt. Mal sehen, wie erfrischend du das dann findest.
„Und bis wohin bist du gelaufen?“
„Am Highway Nine hab ich kehrtgemacht.“
Keinen Kilometer von ihrer Haustür entfernt. Aber er platzte schier vor Stolz. Fasziniert sah sie ihn an. Es war unmöglich, ihn zu beschämen.
Und warum sollte sie ihn auch beschämen wollen? Was sie an seinem dämlichen Mitmachimpuls, einen Marathon zu laufen, so sehr aufregte, war eben die Tatsache, dass sich ein derart fieses Bedürfnis bereits in ihrem Kopf breitmachte, nachdem die einzige sportliche Betätigung ihres Mannes darin bestand, dass er einen Lauf von anderthalb Kilometern absolviert hatte – wenn man das überhaupt einen Lauf nennen konnte. Sie war keine streitsüchtige Xanthippe, war es in den zweiunddreißig Jahren ihres Zusammenseins nie gewesen. Im Gegenteil, es lag in der Natur argwöhnischer Einzelgänger, sich ganz und gar und uneingeschränkt hinzugeben, nachdem die furchterregenden Barrieren, die sie vor allem und jedem errichteten, einmal überwunden waren. Die meisten Menschen fanden Serenata unnahbar, und das war ihr auch ganz recht; als eine Frau wahrgenommen zu werden, die andere auf Abstand hielt, half dabei, sie auf Abstand zu halten. Aber mit Remington Alabaster war sie nicht auf Abstand geblieben, schon nach der Hälfte ihres ersten Dates nicht mehr. Generell auf Abstand zu bleiben bedeutete nicht, dass man das normale menschliche Bedürfnis nach Gesellschaft nicht kannte. Es bedeutete, dass man es vorzog, alles auf ein Pferd zu setzen. Remington war ihr Pferd. Sie konnte es sich nicht leisten, diesem Pferd etwas zu verübeln – es beschämen zu wollen oder zu hoffen, dass es scheitern würde, wenn es sich einer Sache zuwandte, die sich zu einem ziemlich banalen Kennzeichen des eigenen Status entwickelt hatte.
Sie verdankte ihm, dass etwas, das andernfalls zu dürrer Einsamkeit hätte werden können, nun rund und prall und reichhaltig war. Sie hatte es genossen, seine einzige Vertraute zu sein, als es beim Amt für Transport und Verkehr den Bach runterging; er hatte es nicht riskieren wollen, sich mit irgendwelchen Arbeitskollegen zu besprechen. Während des ganzen Debakels hatte er unerschütterlich darauf vertraut, dass sie zuverlässig an seiner Seite stand. Ihr fehlte die Kameraderie dieser gemeinsamen Empörung. Ab und an waren sie durchaus unterschiedlicher Meinung gewesen, besonders, was die Kinder betraf, die sich beide, offen gesagt, ein wenig sonderbar entwickelt hatten. Nichtsdestotrotz, die Bemessungsgrundlage für eine Ehe war eine militärische: Wenn die Ehe gut war, war sie eine Allianz.
Außerdem hatte sie gerade überhaupt nicht weitergewusst, als sie sich begegneten. Sie verdankte ihm ihre Berufswahl.
Als Kind, nach einem Familienurlaub auf Cape Hatteras, hatte sie ihren größten Wunschtraum verkündet, nämlich Leuchtturmwärterin zu werden – verbannt an die überhängende Spitze einer Landzunge, hoch oben mit einem Blick in endlose Weiten, angesichts derer man sich je nach Stimmung sehr klein oder sehr groß fühlen konnte. Wie eine Königin über einen großartigen Leuchtturm zu herrschen. Sie würde in einem kleinen runden, mit Treibholz dekorierten Zimmer leben, auf einer Heizplatte Dosensuppen warm machen, unter einer am Kabel schwingenden, nackten Glühbirne Pippi Langstrumpf (na ja, sie war damals erst acht) lesen und auf einem winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher, wie es ihn in dem Hotel auf den Outer Banks gab, Wiederholungen von Bezaubernde Jeannie (dito) anschauen. Später, während der bei Mädchen typischen Pferdeschwärmphase, malte sie sich aus, einmal Aufseherin in einem Nationalpark zu werden und allein endlose Waldgebiete zu durchreiten. Noch später, inspiriert von einer Liste ungewöhnlicher Berufe, die sie in einer Zeitung gefunden hatte, begeisterte sie die Vorstellung, Verwalterin eines Anwesens auf einer tropischen Insel zu sein, das einem sehr reichen Mann gehörte, welcher nur einmal im Jahr mit seinem Privatjet und in Begleitung eines Aufgebots an Promigästen vorbeischauen würde. Die restliche Zeit hätte sie das Herrenhaus für sich – mit einer Tafel für hundert Personen, einem von Lüstern erleuchteten Ballsaal, einer privaten Menagerie, einem Golfplatz und Tennisplätzen, und das alles, ohne zunächst Geld verdienen und irgendein langweiliges Unternehmen aufbauen zu müssen. Bei der letzten dieser Fantasien kam ihr nie in den Sinn, dass unbegrenzter Zugang zu einem Golfplatz und zu Tennisplätzen nur von begrenztem Wert war, wenn man niemanden hatte, mit dem man spielen konnte.
Nachdem sie die Gartenturnübungen ihrer Kindheit als Teenager durch ein zwar heimliches, aber ehrgeiziges Fitnessprogramm ersetzt hatte, zog Serenata Jobs in Betracht, die ihr in der praktischen Ausübung einige Kraftanstrengung abverlangen würden. Sie sah sich als einzige Frau in einem Bautrupp, die Nägel einschlug, riesige Rigipsplatten schleppte und schwere Pressluftbohrer bediente – und auf diese Weise ihre männlichen Kollegen beeindruckte, die sich zunächst über das Anfänger-Girlie lustig gemacht hatten, sie aber bald bewunderten und in Bars ihre Ehre verteidigten. Oder sie wäre eine wichtige Kraft in einem Umzugsunternehmen (die Kollegen würden sich über sie lustig machen, sie bald bewundern und in Bars ihre Ehre verteidigen …). Sie zog eine Tätigkeit als Baumpflegerin in Betracht. Doch leider Gottes war harte körperliche Arbeit offenbar den schlecht Ausgebildeten vorbehalten und schlecht bezahlt, und ihre Mittelschichtseltern taten all diese Knochenjobideen als lächerlich ab.
Jahrelang hatte das Einzelkind seine Eltern mit der Produktion eigener Hörspiele amüsiert. Sie nahm sämtliche Rollen auf einem tragbaren Kassettenrekorder auf und unterlegte diese Dramen mit Soundeffekten – knallenden Türen, Schritten, Papierknüllen für ein Feuer. Plötzlich schien Serenatas alles beherrschende Kindheitssehnsucht, einen eigenbrötlerischen Beruf zu ergreifen, in eine intuitive Selbsterkenntnis zu münden. Schriftstellerin zu werden passte demnach genau.
Klar, ihre Eltern betrachteten diese Bestrebung als ebenso ungeeignet wie den Beruf der Bauarbeiterin. Sie fanden, ihre Tochter solle einfach heiraten. Aber immerhin würde eine literarische Veranlagung ein Collegestudium rechtfertigen, womit sich die Qualität und das potenzielle Einkommen ihrer Freier verbessern würde. Also gaben die Eltern ihren Segen. Sie immatrikulierte sich im Hunter, einen Steinwurf von New Brunswick entfernt, und erwies sich anschließend, wie die meisten graduierten Geisteswissenschaftler, als gänzlich unvermittelbar.
In ihren Zwanzigern war Serenata planlos und lebte von der Hand in den Mund. Sie konnte sich keine eigene Wohnung leisten, musste sich ihre Bude also (Anathema) mit anderen Mädchen teilen, die in ihren Zwanzigern planlos waren und von der Hand in den Mund lebten. Die einfachen Jobs, die Serenata fand, setzten wahrlich keinen Collegeabschluss voraus. Sie versuchte, sich Zeit für ihre Arbeit zu nehmen, ohne dass sie diese anmaßende Formulierung laut aussprach. Es war demütigend, dass sämtliche Leute ihres Alters, denen sie in New York begegnete, sich ebenfalls als Schriftsteller bezeichneten und sich ebenfalls Zeit für ihre Arbeit nahmen.
Das Blatt wendete sich, als sie Telefondienste in der Kundenbetreuung von Lord & Taylor übernahm. Ein junger Mann rief an und wollte eine geschmacklose Krawatte zurückgeben, die er geschenkt bekommen hatte. Er beschrieb das knallbunte Teil hochkomisch in allen Einzelheiten. Er brachte sie dazu zu erklären, was ein Kunde mit respektive ohne Quittung unternehmen sollte, sofern er die Quittung denn noch hatte oder eben nicht mehr hatte. Allmählich dämmerte ihr, dass er sie am Apparat zu halten versuchte. Schließlich bat er sie inständig, ihm diese Worte nachzusprechen: „Zurückbleiben, bitte.“
„Wie?“
„Sagen Sie’s einfach. Mir zuliebe. Zurückbleiben, bitte.“
Na ja, er hatte sie ja schließlich nicht gebeten, ihm nachzusprechen und „kann ich bitte Ihren Schwanz lutschen“ zu sagen. Sie erfüllte seine Bitte.
„Perfekt“, sagte er.
„Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das schlecht sagen könnte.“
„Die meisten Menschen würden es schlecht sagen“, erwiderte er – und erklärte ihr dann, dass er beim städtischen Amt für Transport und Verkehr arbeite. Er sei beauftragt, einen neuen Ansager für den öffentlichen Nahverkehr zu suchen, und bitte sie, sich um den Job zu bewerben. Sie war misstrauisch, natürlich. Als Vorsichtsmaßnahme schlug sie das Amt für Transport und Verkehr von New York City im Telefonbuch nach, und die Adresse stimmte mit der überein, die er ihr genannt hatte.
Am Ende wurde von höherer Stelle verfügt, dass die New Yorker für eine weibliche Autoritätsperson noch nicht reif seien, und sie bekam den Job nicht. Wie Remington ihr später verriet, hatte einer der Männer im Team, nachdem ihr Bewerbungsband zum wiederholten Mal abgespielt worden war, erklärt, dass bei dieser sinnlichen Stimme kein männlicher Fahrgast den Inhalt der Ansagen mitbekäme; er würde davon träumen, den Lautsprecher zu besteigen.
Doch noch bevor die enttäuschende Entscheidung getroffen war, hatte sie einem gemeinsamen Abendessen zugestimmt – allerdings erst nach Remingtons zweiter Einladung. Die spontane erste Einladung, unmittelbar im Anschluss an ihre Bewerbungsaufnahme, hatte sie ablehnen müssen, weil die Fahrradstrecke zwischen ihrem Apartment im East Village und dem downtown gelegenen Amt offiziell zu kurz war, um zu zählen; sie konnte unmöglich essen gehen, ohne vorher trainiert zu haben. Später verabredeten sie sich im Café Fiorello am Broadway, einer teuren italienischen Trattoria, die Langzeit-New-Yorker gerne Touristen empfahlen. Trotz der Exklusivität des Ortes bestand Serenata darauf, wie immer mit dem Fahrrad zu kommen.
Offenbar hatte Remington vom Eingang des Restaurants aus beobachtet, wie sie neben einem Parkschild ihre standardmäßige Cinderella-Verwandlung vollzog. Mit der Schuhspitze streifte sie einen verranzten Sneaker vom Fuß, balancierte auf dem anderen und schüttelte sich die Jeans vom Bein – wobei sie sicherstellte, dass der Rock, der darüberflatterte, sie in geziemender Weise bedeckte. Es war März und noch frisch, und eine hautfarbene Strumpfhose hatte ihr als zusätzliche Isolierung gedient. Aus einer Satteltasche zog sie ein paar umwerfende rote Lacklederschuhe. Als Nächstes stützte sie sich, auf einem Stöckelschuh balancierend, auf dem Fahrradsattel ab und wiederholte den Striptease mit dem anderen Bein, um die zusammengerollte Jeans anschließend in die Satteltasche zu stopfen. Nachdem sie den Rock zurechtgezogen hatte, malte sie sich hastig die Lippen nach; für rote Wangen hatte die Fahrt selbst gesorgt. Sie nahm den Helm ab, schüttelte das dicke schwarze Haar und bändigte es mit einem ihrer selbst genähten Stoffgummis, der damals noch nicht Scrunchie hieß. Inzwischen hatte sich Remington ins Restaurant zurückgezogen, um ihr Zeit zu geben, ihre siffige Jacke und die speckigen Satteltaschen, deren ursprüngliches Leuchtgelb inzwischen den ekelerregenden düsteren Farbton einer vergammelten Olive angenommen hatte, an der Garderobe abzugeben.
Bei Hummerpasta reagierte ihr Gegenüber auf die von ihr geäußerte Absicht, Schriftstellerin zu werden, auf eine Weise neutral, die ein inneres Augenrollen verborgen haben musste. Schließlich rollte sie ja selbst die Augen darüber. „Ich fürchte, ein solches Vorhaben wirkt mittlerweile ziemlich ichbezogen. Und alle, denen ich in dieser Stadt begegne, wollen auch Schriftsteller werden.“
„Wenn es das ist, was Sie wirklich machen wollen, dann spielt es keine Rolle, dass es ein Klischee ist.“
„Aber ich weiß nicht, ob es das ist, was ich wirklich will. In der Isolation blühe ich auf. Aber es drängt mich nicht, mich selbst zu offenbaren. Ich will andere Menschen um jeden Preis aus meinen Angelegenheiten raushalten. Ich ziehe es vor, meine Geheimnisse für mich zu behalten. Immer wenn ich versuche, einen erzählenden Text zu schreiben, entstehen Figuren, die nichts mit mir zu tun haben.“
„Ha! Vielleicht liegt Ihre Zukunft tatsächlich in der Literatur.“
„Nein, es gibt da noch ein anderes Problem. Das wird Ihnen nicht gefallen.“
„Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht.“ Er lehnte sich zurück und ließ seine Gabel in den Fettuccine stecken.
„Sie kennen das doch, dass man in den Nachrichten immer nur Menschen sieht, die hungern oder bei einem Erdbeben sterben, oder? Ich begreife langsam, dass sie mich nicht weiter kümmern.“
„Naturkatastrophen ereignen sich oft in weiter Ferne. Die Opfer kommen uns abstrakt vor. Vielleicht ist es einfacher, etwas für Leute zu empfinden, die dem eigenen Zuhause näher sind.“
„Leidende Menschen kommen mir nicht abstrakt vor. Im Fernsehen sind sie so real wie die Sünde. Und was die Menschen angeht, die meinem Zuhause näher sind – die kümmern mich auch nicht.“
Remington schmunzelte. „Das ist entweder wohltuend oder abscheulich.“
„Ich plädiere für abscheulich.“
„Wenn andere Menschen Sie nicht kümmern, was bin ich dann für Sie?“
„Möglicherweise“, sagte sie vorsichtig, „eine Ausnahme. Ich mache hin und wieder welche. Aber meine Standardeinstellung ist Selbstvergessenheit. Das ist eine miserable Qualifikation für eine Schriftstellerin, finden Sie nicht? Außerdem … Ich weiß gar nicht, ob ich die richtige Stimme habe, um aufzufallen.“
„Na, und ob“, sagte er, „auf jeden Fall haben sie eine Stimme. Ich würde Ihnen begeistert zuhören, wenn Sie mir das komplette Einkommenssteuergesetz vorlesen.“
Sie ergänzte den seidigen Ton in ihrer Kehle um eine raue Komponente: „Wirklich?“ Remington gestand später, dass er bei diesem Adverb eine Erektion bekommen hatte.
Sie wechselten das Thema. Aus reiner Höflichkeit fragte sie, warum er beim Amt für Transport und Verkehr gelandet sei. Seine Antwort war überraschend leidenschaftlich.
„Auf den ersten Blick sieht es nach reiner Mechanik aus, aber Verkehr ist eine höchst emotionale Angelegenheit! Es gibt keinen anderen Aspekt des Stadtlebens, der derart heftige Gefühle hervorruft. In manchen Straßen kann es zum Aufruhr kommen, wenn man eine Fahrspur für den Radverkehr reserviert. Wenn eine falsche Ampelschaltung dazu führt, dass die Grünphase für Fußgänger zwei Minuten dauert, kann man die Autofahrer durch die geschlossenen Wagenfenster auf ihre Lenkräder einhämmern hören. Busse, die bei minus fünf Grad eine Stunde Verspätung haben … U-Bahnen, die eine halbe Ewigkeit unterm East River feststecken, ohne dass über Lautsprecher eine Erklärung erfolgt … fürchterlich konzipierte Autobahnauffahrten, bei denen eine unübersichtliche Kurve den Einbiegern die Sicht auf den Verkehr versperrt … eine verwirrende Beschilderung, die einen auf dem New Jersey Turnpike dreißig Kilometer ohne Ausfahrt nach Süden rasen lässt, wenn man nach Norden will, und man ist sowieso schon spät dran. Andere Menschen scheren Sie vielleicht einen feuchten Kehricht, aber der Verkehr? Verkehr schert jeden.“
„Mag sein. Ich betrachte mein Fahrrad als Pferd. Ein geliebtes Pferd.“
Er gestand, dass er ihre Burleske auf dem Bürgersteig beobachtet hatte. „Und was, wenn wir zusammen irgendwo hinwollten?“
„Ich würde mit dem Fahrrad kommen und Sie dort treffen.“
„Auch wenn ich Ihnen anbieten würde, Sie abzuholen?“
„Ich würde ablehnen. Höflich.“
„Das Höflich würde ich mal bezweifeln, weil schon die Ablehnung an sich stur und rüde wäre.“
„Darauf zu bestehen, dass ich eine lebenslange Praxis ändere, bloß um Ihnen einen Gefallen zu tun oder einer Konvention zu genügen, wäre doch genauso rüde.“
Wie die meisten unbeugsamen Menschen kümmerte es Serenata wenig, ob ihre Inflexibilität eine sonderlich betörende Eigenschaft war. Die wahrhaft Verstockten ließen sich nie zum gewinnenderen Geben und Nehmen überreden. Sie hielten sich ans Programm.
Serenata gab dem entwaffnenden Drängen des Bauingenieurs nach und ging zu einem Vorsprechen für einen Synchronisationsjob bei einer Werbeagentur. Sie wurde vom Fleck weg engagiert. Ähnliche Engagements folgten mit solcher Regelmäßigkeit, dass sie ihre Arbeit bei Lord & Taylor aufgeben konnte. Sie erwarb sich eine gewisse Reputation. Bald las sie auch Hörbücher ein, und heute bestand ein Großteil ihrer Arbeit in Infomercials und Videospielen. Wenn sie sich auch für andere Menschen wenig interessierte, so doch sehr für Exzellenz, und es freute sie unbändig, wenn sie ein neues Timbre entdeckte oder ihre Stimmlage nach oben oder unten ausweiten konnte, um zickige Kinder oder grummelige alte Männer zu geben. Es war eine der schönsten Qualitäten des Sprechens, dass man sich nicht auf die begrenzte Anzahl von Noten auf einer Tonleiter beschränken musste, und sie berauschte sich an den endlosen Tonabstufungen eines Glissandos der Enttäuschung.
Da sie als Kind so oft umgezogen war, verfügte sie über eine geradezu exotisch unspezifische und nützlicherweise auch flüssige Diktion. In ihren Ohren klangen sämtliche Aussprachevarianten von Balkon oder Soße oder Pecannuss gleichermaßen richtig und gleichermaßen beliebig. Es fiel ihr leicht, Dialekte zu imitieren, weil sie nicht in ihrem eigenen gefangen war – und selbst routinierte Lingualdetektive vermochten die Ursprünge ihres Jargons nicht zu identifizieren. Remington hatte sie erklärt: „Ich komme nirgendwoher. Manchmal missverstehen die Leute meinen Vornamen und schreiben ihn Sarah Nada: Sarah Nichts.“
Doch ihr Liebeswerben war merkwürdig keusch. Ihre verhaltene Art hatte frühere Freier zu dem Versuch verleitet, die Schutzwälle zu stürmen – mit fatalen Folgen. Vielleicht war es also schlau von Remington, ihrer Zurückhaltung seinerseits mit Zurückhaltung zu begegnen, aber sie begann zu befürchten, dass er deshalb die Finger von ihr ließ, weil er sie einfach nicht attraktiv genug fand. „Ich weiß, du bist auf meine Stimme abgefahren“, bemerkte sie schließlich. „Aber als die Stimme dir in Fleisch und Blut gegenübertrat – war die Dreidimensionalität ein Abtörner?“
„Du schützt deine Grenzen“, sagte er. „Ich habe auf die Erteilung eines Visums gewartet.“
Also küsste sie ihn – nahm dabei seine Hand und drückte sie fest auf die Innenseite ihres Schenkels und damit in aller Form den Stempel in seinen Pass. Jetzt, viele Jahre später, stellte sich die Frage: Wenn es damals Remington Alabasters Respekt vor ihrem erbitterten Gebietsschutz gewesen war, der sie bezaubert hatte, warum überschritt er jetzt, im Alter von vierundsechzig Jahren, ihre Grenzen?
„Fertig mit dem oberen Badezimmer“, verkündete die junge Frau und zerrte sich die Gummihandschuhe übers Handgelenk, sodass sie sich verkrumpelt von innen nach außen kehrten.
Serenata wies mit dem Kopf auf die feuchten, muffig riechenden Handschuhe auf der Kücheninsel. „Du hast es schon wieder getan.“
„Oh, Mist!“
„Ich bezahl dich nicht stundenweise dafür, dass du die Finger einzeln wieder zurückkrempelst.“ Das war erkennbar frotzelnd gemeint.
„Okay, wird von der Arbeitszeit abgezogen.“ Mit einem Blick auf ihre Armbanduhr begann Tomasina March – kurz Tommy – mit der mühsamen Arbeit, in den verkrumpelten Zeigefinger des ersten Handschuhs hineinzustochern und ihn millimeterweise durch die klebrige gelbe Röhre zu ziehen.
Obwohl ihre Eltern eine Putzfrau beschäftigt hatten, hatte Serenata vor dem Umzug nach Hudson Haushaltshilfen stets verschmäht. Nein, sie litt nicht an liberalem Unbehagen, was Bedienstete anging. Sie wollte einfach keine Fremden – keine anderen Leute – in ihrem Haus haben. Doch mit sechzig hatte sie einen Punkt erreicht, der ihr einen neuen Überblick erlaubte. Sie war auf den Gipfel gestiegen und überschaute nun den vor ihr liegenden Abstieg. Sie konnte sich dafür entscheiden, einen beträchtlichen Teil des erstaunlich kurzen und potenziell steilen Niedergangs damit zu verbringen, die Seifenränder am Abfluss der Dusche wegzuschrubben, oder sie konnte jemand anderen dafür bezahlen, es zu tun. Die Antwort lag auf der Hand.
Zwar wäre Serenata die Anwesenheit einer weiteren Fitnessfanatikerin normalerweise zuwider gewesen, aber als sie am Tag ihres Einzugs die neunzehnjährige Nachbarin auf ihrem mit kaputten Möbeln übersäten Rasen Hunderte Burpees machen sah, fühlte sie sich an die Beinbrüche und Rolly-Pollies ihrer eigenen Kindheit erinnert. Tommy, die sich über das Taschengeld (Serenata zahlte zehn Dollar die Stunde – in Upstate New York schrecklicherweise ein üppiger Lohn) freute, war ein spargeliges Mädchen, langgliedrig und ungelenk, dünn, aber unförmig. Ihr honigfarbenes Haar war fein und strähnig. Sie hatte ein offenes und argloses Gesicht. Dass es noch so unbeschrieben wirkte, brachte einem schlagartig in Erinnerung, wie wahrhaft fürchterlich es war, dieses ganze bescheuerte Leben vor sich aufragen zu sehen, ein Leben, um das man nicht gebeten hatte, und keine blasse Ahnung zu haben, was man mit ihm anfangen sollte. In Tommys Alter wurden die meisten jungen Leute, die halbwegs bei Verstand waren, von dem mulmigen Gefühl beschlichen, dass es für jeden Plan, den sie vielleicht irgendwann zusammengeschustert hätten, zu spät wäre, weil sie etwas hätten unternehmen müssen – mit neunzehn –, um das Strategem in die Praxis umzusetzen. Es war unbegreiflich, warum Menschen beim Gedanken an ihre Jugend nostalgisch wurden. Diese Wehmut war pure Amnesie.
„Wo ist eigentlich Remington?“, fragte Tommy.
„Der ist laufen, ob du’s glaubst oder nicht. Das heißt, es bleiben uns noch ganze sechs Minuten, um hinter seinem Rücken über ihn zu ratschen.“
„Ich wusste gar nicht, dass er läuft.“
„Hat er auch nie getan. Bis vor zwei Wochen. Jetzt will er einen Marathon laufen.“
„Na, gut für ihn.“
„Ist das gut für ihn?“
„Klar doch.“ Tommys Konzentration galt dem Handschuh. Sie hatte den Zeigefinger immer noch nicht gerettet. „Alle wollen einen Marathon laufen, was soll daran verkehrt sein?“
„Genau die Tatsache, dass alle es wollen. Ich weiß, dass er nicht viel mit sich anzufangen weiß, aber ich wünschte, er hätte sich was Originelleres ausgesucht.“
„Es gibt nicht so viel, was man machen kann. Was immer einem einfällt, irgendjemand hat es schon gemacht. Originell sein ist eine aussichtslose Sache.“
„Ich bin gemein“, sagte Serenata, ohne sich auf Remington zu beziehen – aber natürlich war sie auch, was ihn anging, gemein. „Diese Handschuhe – ich werde dir einfach ein neues Paar kaufen. Obwohl du schneller vorankämst, wenn du aufhören würdest, hier die ganze Zeit so rumzuhampeln.“
Tommy fuhr fort, vor und zurück durch die Küche zu hüpfen, während sie Serenata triumphierend den richtig gekrempelten Zeigefinger präsentierte. „Kann ich nicht. Erst bei zwölftausend, und es ist schon vier.“
„Zwölftausend was?“
„Schritte.“ Sie zeigte auf das Plastikband an ihrem linken Handgelenk. »Ich habe ein Fitbit. Eine Billigkopie, aber genauso gut. Allerdings, wenn ich unterbreche, zählt das Ding aus irgendeinem bescheuerten Grund die ersten dreißig Schritte nicht. In der Anleitung steht als Begründung, „falls du nur jemandem die Hand schüttelst“, als würden irgendwelche Leute sich allen Ernstes dreißigmal die Hand schütteln. Diese Gebrauchsanweisungen werden doch alle von chinesischen Menschen geschrieben, denen amerikanische Sitten und Gebräuche offensichtlich komplett fremd sind. Das soll nicht heißen, dass mit chinesischen Menschen irgendwas nicht stimmt«, schob sie besorgt hinterher. „Darf man die so nennen? Chinesische Menschen? Klingt irgendwie beleidigend. Egal, diese dreißig verlorenen Schritte, wieder und wieder – da kommt was zusammen.“
„Und warum spielt das eine Rolle? Dein ewiges Hin und Her macht mich ganz dusselig.“
„Na ja, man postet seine Schritte. Jeden Tag. Online. So ziemlich alle verbuchen für sich um die zwanzigtausend oder mehr, und Marley Wilson, diese blöde Scheißkuh aus der Abschlussklasse, die postet regelmäßig dreißig.“
„Wie viele Kilometer sind das?“
„Rund fünfundzwanzig“, sagte Tommy wie aus der Pistole geschossen.
„Wenn sie sich nicht schwer ranhält, braucht sie gut und gerne fünf Stunden am Tag, um so eine Strecke zu gehen. Macht sie sonst noch irgendwas?“
„Darauf, was sie sonst noch macht, kommt es nicht an.“
„Warum kümmert es dich, wie viele Schritte andere Leute schaffen?“
„Du kapierst es nicht. Der Hauptgrund, warum es dich wurmt, dass Remington mit dem Laufen angefangen hat, ist der, dass du aufgehört hast.“
„Ich hab nicht gesagt, dass es mich wurmt.“
„Musstest du auch nicht. Er schlägt dich. Selbst wenn er nur sechs Minuten unterwegs ist, schlägt er dich.“
„Ich trainiere immer noch, nur anders.“
„Nicht mehr lange. Letzte Woche hast du diese ganze Tirade abgelassen, dass es praktisch keine Aerobicübung gibt, bei der du nicht die Knie brauchst. Du kannst nicht mal mehr schwimmen, wenn sie zu doll geschwollen sind.“
Es wäre lächerlich gewesen, beleidigt zu sein, weil Tommy lediglich Serenatas eigene Äußerungen zitierte.
„Falls es dich beruhigt“, fügte Tommy hinzu und wedelte siegesfroh mit einem komplett zurückgekrempelten Handschuh, „die meisten Leute, die Marathons laufen, geben das Laufen ziemlich bald danach wieder ganz auf. Wie die Biggest Loser, die sich gleich hinterher wieder fett fressen. Sie haken das Kästchen auf ihrer Löffelliste ab, und weiter geht’s.“
„Wusstest du, dass es den Begriff Löffelliste erst seit ungefähr zehn Jahren gibt? Ein Drehbuchautor hat eine Liste aufgestellt, was er noch alles machen will, bevor er den Löffel abgibt. Und weil ganz oben auf der Liste die Produktion eines seiner Drehbücher stand, hat er ein Drehbuch zum Thema geschrieben. Der Film muss ganz gut gelaufen sein, denn der Begriff ging viral.“
„Vor zehn Jahren. Da war ich neun. Was mich angeht, haben wir das schon immer gesagt.“
„Der Begriff viral gehen ist auch erst ein paar Jahre vorher viral gegangen. Ich frage mich, ob es dafür eine Bezeichnung gibt – für etwas, das genau das ist, was es beschreibt.“
„Du interessierst dich mehr für die Bezeichnungen von Sachen als ich.“
„Das nennt man Bildung. Solltest du auch mal probieren.“
„Wozu? Ich hab dir doch gesagt, ich will Synchronsprecherin werden wie du. Lesen kann ich schon ganz gut. Jetzt muss ich vor allem besser werden im Noch mal, mit mehr Gefühl, wie du gesagt hast.“
Diese ob des Altersunterschieds ungewöhnliche Freundschaft hatte ihren Anfang genommen, als das Mädchen entdeckte, dass Serenata Terpsichore das Hörbuch zu einem ihrer liebsten Young-Adult-Romane eingelesen hatte. Tommy hatte noch nie jemanden gekannt, dessen Name bei einem Amazon-Download auftauchte, weshalb ihre Nachbarin für sie auf der Stelle zum Superstar wurde.
„Ich glaube, was an diesen schlagartig ubiquitären Ausdrücken nervt …“
Tommy fragte nicht nach.
„… was heißt, dass plötzlich jeder sie benutzt“, fügte Serenata hinzu. „Es ist einfach so, dass Leute, die mit Modewörtern um sich werfen, meinen, sie seien ach so hip und erfinderisch. Aber hip und erfinderisch, das schließt einander aus. Man kann nur unhip und erfinderisch oder hip und konformistisch sein.“
„Für eine Lady, die sich nicht dafür interessiert, was andere Leute denken und tun, redest du verdammt viel darüber, was andere Leute denken und tun.“
„Das liegt daran, dass mir andere Leute die ganze Zeit auf die Pelle rücken.“
„Ich rücke dir auf die Pelle?“, fragte Tommy schüchtern und blieb tatsächlich stehen.
Serenata zog sich hoch – es war ein Schlimmes-Knie-Tag – und legte einen Arm um das Mädchen. „Auf gar keinen Fall! Wir beide gegen den Rest der Welt. Nachdem du jetzt stehen geblieben bist, kannst du die nächsten dreißig Schritte eh abschreiben. Also machen wir uns einen Tee.“
Dankbar sank das Mädchen auf einen Stuhl. „Wusstest du, dass sich dein ganzer Körper innerhalb von fünfzehn Minuten, wenn du dich hinsetzt, also, dass er sich verändert und so? Dein Herz und alles.“
„Ja, das habe ich mal gelesen. Aber ich kann nicht mehr zwölf Stunden am Stück stehen. Das tut weh.“
„He, ich wollte dir vorhin kein schlechtes Gewissen machen. Wegen dem Laufen und so. Weil, also, das steht ja wohl mal fest, für einen alten Menschen … siehst du noch ziemlich heiß aus.“
„Danke, kann schon sein. Erdbeer-Mango, okay?“ Serenata zündete die Flamme unter dem Kessel an. „Aber so eine halbwegs gute Verfassung hält nicht ewig. Trainieren war mein Geheimnis. Ein Geheimnis, das out ist, fürchte ich.“
„Gar nicht so out. Die meisten Leute sehen furchtbar aus. Wie meine Mutter.“
„Du hast doch erzählt, sie hat Diabetes.“ Dass Serenata genau in diesem Moment einen Teller Mandelkekse vor sie hinstellte, war schlechtes Timing. „Sei nicht so streng mit ihr.“
Tommy March wurde nicht nicht geliebt, aber sie wurde zu wenig geliebt, und das war schlimmer – so wie eine radikale Fastenkur in ihrem Absolutismus stärkend wirkte, während eine endlose Diät einen reizbar und schwach machte. Der Vater war vor langer Zeit abgehauen, und ihre Mutter verließ kaum das Haus. Vermutlich lebten sie von Sozialhilfe. Deshalb wohnte Tommys Mutter, obwohl das hier eine Gegend mit niedrigen Immobilienpreisen war – dieses riesige Schindelhaus mit zwei Bädern, drei Veranden und sechs Schlafzimmern war für 235 000 Dollar ein Schnäppchen gewesen –, zwangsläufig immer noch zur Miete. Sie hatte ihre Tochter nie darin bestärkt, aufs College zu gehen. Was ein Jammer war, denn Tommy steckte voller Energie, aber ihrem Drang zur Selbstoptimierung fehlte das Ziel. Wie eine Flipperkugel kullerte sie von Fimmel zu Fimmel, ohne die größeren gesellschaftlichen Kräfte zu durchschauen, von denen die Flipper in Bewegung gehalten wurden. Als sie sich zur Veganerin erklärte (um nach zwei Wochen festzustellen, dass sie ohne den Käse auf der Pizza nicht leben konnte), meinte sie, die Idee sei ihr aus heiterem Himmel gekommen.
Deshalb hatte Tommy auch ein nervöses Verhältnis zu Zucker, typisch für ihre Zeit und Generation. Als würde sie das Gebäck hinter dem eigenen Rücken stibitzen, schoss ihre Hand wie die Zunge einer Eidechse blitzschnell vor und schnappte sich einen Keks. „Was Social Media angeht, bist du immer noch die griesgrämig-verpeilte alte Lady, stimmt’s?“
„Ich habe Besseres zu tun. In der realen Welt.“
„Soziale Medien sind die reale Welt. Viel realer als diese hier. Das weißt du bloß nicht, weil du dich selbst ausgeschlossen hast.“
„Ich ziehe es vor, dich als Spionin zu benutzen. Remington habe ich jahrelang auf die gleiche Weise missbraucht. Er zog hinaus in die amerikanische Arbeitswelt und hat mir dann berichtet. Und wenn ich bedenke, was er dort rausgefunden hat … Eine Isolationsschicht scheint mir vernünftig.“
„Ich glaube bloß, dass du wissen solltest … Also, auf diesen YA-Plattformen …“ Tommy sah Serenata jetzt nicht mehr in die Augen. „Es ist irgendwie nicht so super, wenn Weiße, die Hörbücher einlesen, Akzente imitieren. Schon gar nicht bei POC.“
„People of Color!“, sagte Serenata. „Ich wette, du hast gedacht, dass ich das nicht weiß. Remington fand es immer irrsinnig lustig, dass er rausfliegen würde, wenn er bei der Arbeit stattdessen Colored People gesagt hätte. Aber dann ist er trotzdem geflogen. So viel zum Korbleger, wenn du kein professioneller Basketballspieler bist.“
„Also, ich mache die Regeln nicht.“
„Aber natürlich machst du die Regeln. Remington meint, dass diese willkürlich zusammengebastelten Tabus ihre Macht erst dadurch entfalten, dass jeder sie sklavisch befolgt. Er meint, Regeln, die rundum nicht befolgt werden, sind nur Empfehlungen.“
„Du hörst mir nicht zu! Der Punkt ist, dass dein Name kursiert. Und nicht im positiven Sinne.“
„Und was war noch mal verkehrt daran, Akzente zu benutzen? Ich kann das nicht nachvollziehen.“
„Es ist … problematisch.“
„Und was heißt das?“
„Es heißt einfach alles. Es ist ein großes, dickes, fettes Wort für absolut alles, was superschlimm ist. Jetzt sagen nämlich alle, dass es Mimikry ist, wenn weiße Leser so tun, als würden sie wie Randgruppen sprechen, und auch so was wie kulturelle Aneignung.“
„Es deprimiert mich zutiefst, dass du Randgruppen und kulturelle Aneignung, was immer das sein soll, runterrasseln kannst, während du das Wort ubiquitär nicht kennst.“
„Ich kenne es ja! Es bedeutet, dass jeder es tut.“
„Nein. Omnipräsent, überall. Also, warum kursiert mein Name?“
„Ehrlich? Deine Akzente in den Hörbüchern. Ich glaube, es liegt daran, dass du sie so gut beherrschst. Du hast einen Ruf auf dem Gebiet. Wenn diese Leute ein Beispiel brauchen, fällt ihnen dein Name ein.“
„Nur damit ich das richtig verstehe“, sagte Serenata. „Ich soll den Dialog mit einem Koksdealer in Crown Heights jetzt so sprechen, als wäre er Professor für Mittelalterliche Literatur in Oxford. ›Jo, Bro, die Tusse is nix wie ’ne Hure, echt jezz ma.‹“ Sie hatte den Satz mit einer englischen, aristokratischen Hochnäsigkeit unterlegt, und Tommy musste lachen.
„Bitte erzähl Remington nichts von alldem“, sagte Serenata. „Versprich’s mir. Ich meine es todernst. Er flippt sonst aus.“
„Erzähl Remington nichts wovon?“ Der Genannte höchstpersönlich schloss hinter sich die Terrassentür. Es war November, und er hatte den üblichen Fehler gemacht, sich dick einzumummeln, obwohl das größte Problem beim Laufen darin bestand, dass einem heiß wurde. Unter den ganzen Wintersportklamotten war er schweißgebadet, sein Gesicht war rot angelaufen. Die rötliche Färbung wurde durch ein Glühen verstärkt, das eher von innen kam. Du liebe Zeit, sie hoffte inständig, dass sie selbst nie derartig vor Selbstgefälligkeit strotzend von einem lächerlich kurzen Lauf zurückgekommen war.









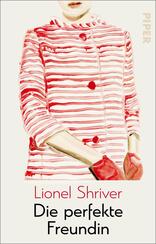












DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.