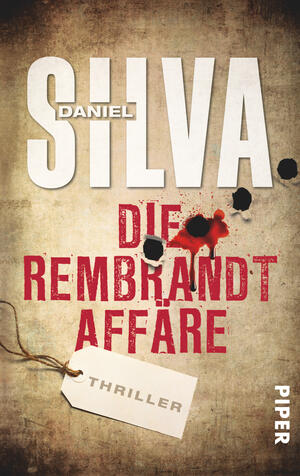
Die Rembrandt Affäre (Gabriel-Allon-Reihe 10)
Thriller
„Packend bis zur letzten Seite. (...) So muss ein moderner Thriller sein.“ - OÖ Nachrichten
Die Rembrandt Affäre (Gabriel-Allon-Reihe 10) — Inhalt
Der brutale Raub des Rembrandt-Gemäldes ist nicht nur für die Kunstwelt ein Schock. Schon bald entdeckt der Restaurator und Geheimagent Gabriel Allon, dass das wertvolle Portait ein gefährliches Geheimnis birgt. Und dass zahllose Menschen sterben werden, wenn er diesem Geheimnis nicht ganz auf den Grund geht.
Leseprobe zu „Die Rembrandt Affäre (Gabriel-Allon-Reihe 10)“
Für Jeff Zucker – für Freundschaft,
Unterstützung und persönlichen Mut.
Und wie immer für meine Frau Jamie
und meine Kinder Lily und Nicholas.
Hinter jedem großen Vermögen
steckt ein großes Verbrechen.
Honoré de Balzac
PROLOG
PORT NAVAS, CORNWALL
Zufällig war es Timothy Peel, der als Erster erfuhr, dass der Fremde nach Cornwall zurückgekehrt war. Diese Entdeckung machte er Mitte September an einem regnerischen Mittwoch kurz vor Mitternacht. Und das nur, weil er die drängenden Aufforderungen seiner Arbeitskollegen, zu ihrem Mittwochsbesäufnis im Godolphin [...]
Für Jeff Zucker – für Freundschaft,
Unterstützung und persönlichen Mut.
Und wie immer für meine Frau Jamie
und meine Kinder Lily und Nicholas.
Hinter jedem großen Vermögen
steckt ein großes Verbrechen.
Honoré de Balzac
PROLOG
PORT NAVAS, CORNWALL
Zufällig war es Timothy Peel, der als Erster erfuhr, dass der Fremde nach Cornwall zurückgekehrt war. Diese Entdeckung machte er Mitte September an einem regnerischen Mittwoch kurz vor Mitternacht. Und das nur, weil er die drängenden Aufforderungen seiner Arbeitskollegen, zu ihrem Mittwochsbesäufnis im Godolphin Arms in Marazion mitzukommen, höflich abgelehnt hatte.
Peel war es ein Rätsel, weshalb sie sich noch die Mühe machten, ihn einzuladen. Tatsächlich hatte er sich nie viel aus der Gesellschaft von Trinkfreudigen gemacht. Und wenn er heute einen Pub betrat, gab es immer irgendeinen Betrunkenen, der ihn anquatschte und über den „kleinen Adam Hathaway“ ausfragen wollte. Vor einem halben Jahr hatte Peel den Sechsjährigen in einer der dramatischsten Aktionen der Königlichen Seenotrettungsgesellschaft aus der gefährlichen Brandung vor Sennen Cove gefischt. Die Medien hatten Peel zum Nationalhelden erklärt – und wurden dann enttäuscht, als der breitschultrige Zweiundzwanzigjährige, der noch dazu wie ein Filmstar aussah, jedes Interview verweigerte. Insgeheim ärgerte Peels Schweigen auch seine Kollegen, von denen jeder die Chance sofort genutzt hätte, für einen Moment im Rampenlicht zu stehen – auch wenn sie nur die alten Klischees auspacken sollten, von wegen „Teamwork als oberstes Gebot“ und „Stolz auf die Diensttradition“. Es kam auch nicht gut an bei den ewig im Schatten stehenden Einwohnern West Cornwalls, die immer auf der Suche nach einem Anlass waren, sich mit einem einheimischen Helden zu schmücken und es so den englischen Snobs im Binnenland zu zeigen. Von der Falmouth Bay bis nach Land,s End löste die bloße Erwähnung von Peels Namen unweigerlich verwundertes Kopfschütteln aus. Ein bisschen seltsam, sagten die Leute. Schon immer gewesen. Muss an der Scheidung gelegen haben. Hat seinen richtigen Vater nie gekannt. Und diese Mutter! Hat sich immer mit den falschen Kerlen eingelassen. Erinnert ihr euch an Derek, den Wein pichelnden Stückeschreiber? Er soll den Jungen geschlagen haben. Zumindest erzählte man sich das in Port Navas.
Das mit der Scheidung stimmte. Und sogar das mit den Prügeln. Tatsächlich war an fast allem Tratsch über Peel etwas Wahres dran. Aber nichts davon spielte eine Rolle dabei, dass er sich weigerte, den Helden zu geben. Peels Schweigen zollte einem Mann Tribut, dem er vor langer Zeit nur kurz begegnet war. Ein Mann, der in dem alten Lotsenhäuschen am Port Navas Quay knapp oberhalb der Austernfarm gewohnt hatte. Ein Mann, der ihm beigebracht hatte, wie man segelte und Oldtimer instand setzte, von dem er gelernt hatte, bedingungslos loyal zu sein und die Oper zu lieben. Ein Mann, der ihn gelehrt hatte, es gebe keinen Grund, damit anzugeben, dass man nur seine Pflicht getan hatte.
Der Mann hatte einen poetisch klingenden ausländischen Namen gehabt, aber für Peel war er immer nur „der Fremde“ gewesen. Er war Peels Komplize, Peels Schutzengel gewesen. Und obwohl er nun schon seit vielen Jahren aus Cornwall verschwunden war, wartete Peel gelegentlich noch auf ihn, genau wie er,s als Elfjähriger getan hatte. Peel besaß noch immer das zerfledderte Notizbuch, in dem er das unregelmäßige Kommen und Gehen des Fremden festgehalten hatte, und die Fotos von dem unheimlichen weißen Licht, das nachts das Häuschen des Fremden erhellt hatte.
Und noch heute konnte Peel den Fremden sehen, wie er nach einer auf See verbrachten langen Nacht am Ruder seiner geliebten Ketsch stehend die Helford Passage heraufkam. Peel hatte immer am Fenster seines Zimmers gewartet und den Arm zu einem stummen Gruß erhoben. Und wenn der Fremde ihn gesehen hatte, hatte er als Antwort seine Positionslichter zweimal ein- und ausgeschaltet.
In Port Navas erinnerte nur noch wenig an die damalige Zeit. Peels Mutter war mit ihrem neuen Liebhaber nach Bath gezogen. Derek, der pichelnde Stückeschreiber, hauste angeblich irgendwo in Wales in einer Hütte am Strand. Und das alte Lotsenhäuschen war von Grund auf renoviert worden und gehörte jetzt reichen Wochenendbesuchern aus London, die lärmende Partys gaben und dauernd ihre verzogenen Kinder anbrüllten. Von dem Fremden war nur die Ketsch übrig, die er in jener Nacht, in der er mit unbekanntem Ziel aus Cornwall geflüchtet war, Peel vermacht hatte.
In dieser Regennacht Mitte September wiegte das Boot sich an seinem Liegeplatz in der hereinkommenden Flut, die kleine Wellen an seinen Rumpf schlagen ließ, als ein unbekanntes Motorengeräusch Peel aus dem Bett holte, um seinen vertrauten Beobachtungsposten am Fenster einzunehmen. Ins nasse Dunkel hinausspähend sah er einen Range Rover in Metallicgrau langsam die Straße entlangkommen. Er bremste vor dem alten Lotsenhäuschen, blieb mit abgeblendeten Scheinwerfern und laufenden Scheibenwischern stehen. Dann wurde plötzlich die Fahrertür aufgestoßen, und eine Gestalt, die zu einem dunkelgrünen Barbour-Regenmantel eine tief ins Gesicht gezogene flache Sportmütze trug, stieg aus. Selbst aus einiger Entfernung wusste Peel sofort, dass dies der Fremde war. Es war seine Gangart, die ihn verriet: der selbstbewusste, zielstrebige Schritt, der ihn scheinbar mühelos zum Kai führte. Dort blieb er außerhalb des Lichtkreises der einzigen Lampe kurz stehen und starrte die Ketsch an. Dann stieg er rasch die Steintreppe zum Fluss hinunter und war außer Sicht.
Zunächst fragte Peel sich, ob der Fremde gekommen war, um sich das Boot zurückzuholen. Diese Angst verflog jedoch, als er mit einem kleinen Päckchen in der linken Hand wieder auftauchte. Es hatte ungefähr die Größe eines Buches und schien in Plastikfolie verpackt zu sein. Die Schlammschicht außen herum sah danach aus, dass das Päckchen sehr lange versteckt gewesen war. Früher einmal hatte Peel den Fremden für einen Schmuggler gehalten. Vielleicht hatte er doch recht gehabt.
Dann bemerkte Peel, dass der Fremde nicht allein war. Auf dem Beifahrersitz des Rovers wartete jemand auf ihn. Peel konnte das Gesicht nicht ganz erkennen, nur eine Silhouette und eine üppige Mähne. Er lächelte zum ersten Mal. Im Leben des Fremden schien es endlich eine Frau zu geben.
Peel hörte den gedämpften Schlag, mit dem die Autotür zufiel, und sah den Rover sofort mit einem Ruck anfahren. Wenn er sich beeilte, konnte er ihn noch aufhalten. Doch blieb er emotional erstarrt, wie es ihm seit seiner Kindheit nicht mehr passiert war, bewegungslos am Fenster stehen und hob stumm grüßend die Hand. Der Rover beschleunigte, und Peel fürchtete einen Augenblick lang, der Fremde habe sein Zeichen nicht gesehen. Dann wurde der Geländewagen plötzlich langsamer, und seine Scheinwerfer blinkten zweimal, bevor er unter Peels Fenster vorbeifahrend in der Nacht verschwand.
Peel blieb noch einen Augenblick länger auf seinem Posten und horchte, bis das Motorengeräusch ganz verklungen war. Dann ging er wieder ins Bett zurück und zog die Decken bis unters Kinn hoch. Seine Mutter war fort, Derek war in Wales, und das alte Lotsenhäuschen war unter ausländische Besatzung geraten. Vorläufig war Peel jedoch nicht allein. Der Fremde war nach Cornwall zurückgekehrt.
TEIL I
Provenienz
I
GLASTONBURY, ENGLAND
Obwohl der Fremde nichts davon ahnte, verschworen sich schon in dieser Nacht zwei voneinander getrennte Ereignisketten, um ihn wieder aufs Schlachtfeld zu locken. Eine setzte sich hinter den verschlossenen Türen der weltweiten Geheimdienste in Bewegung, während die andere Gegenstand einer globalen Medienhysterie war. Die Zeitungen schrieben vom „Sommer der Diebstähle“, weil Europa die schlimmste Serie von Kunstdiebstählen seit einer Generation erlebte. Bberall auf dem Kontinent verschwanden unbezahlbare Gemälde wie Postkarten aus dem Ständer eines Souvenirshops. Während besorgte Museumsdirektoren sich schockiert über diesen Kunstraub in großem Stil äußerten, wunderten sich die Profis unter den Strafverfolgern darüber, dass es überhaupt noch Gemälde zu stehlen gab. „Nagelt man hundert Millionen Dollar an eine schlecht bewachte Wand“, sagte ein gestresster Interpol-Experte, „ist,s nur eine Frage der Zeit, bis ein entschlossener Dieb sie sich zu holen versucht.“
Die Diebe waren nicht nur kühn, sondern auch sehr kompetent. Dass sie geschickt waren, stand außer Zweifel. Was die Polizei am meisten an ihnen bewunderte, war ihre eiserne Disziplin. Es gab keine undichten Stellen, keine Anzeichen für interne Auseinandersetzungen und keine einzige Lösegeldforderung, zumindest keine echte. Die Diebe stahlen häufig, aber selektiv – und nie mehr als ein Gemälde auf einmal. Sie waren keine Amateure, die rasch Kasse machen wollten, oder Profis aus der Welt des organisierten Verbrechens auf der Suche nach einer neuen Einnahmequelle. Sie waren Kunstdiebe im reinsten Sinn des Wortes. Ein pessimistischer Ermittler sagte voraus, alle in diesem langen, heißen Sommer gestohlenen Gemälde würden Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang verschollen bleiben. Tatsächlich, fügte er verdrossen hinzu, stünden die Chancen sehr gut, dass sie ins Museum der Verschwundenen gelangen und niemals wieder öffentlich gezeigt werden würden.
Selbst die Polizei staunte über den Variantenreichtum der Diebe. Man kam sich vor, als beobachte man einen großartigen Tennisspieler, der in einer Woche auf Sand und in der nächsten auf Gras siegen konnte. Im Juni warben die Diebe einen unzufriedenen Sicherheitsmann des Kunsthistorischen Museums Wien an und stahlen eines Nachts Caravaggios David mit dem Haupte Goliaths. Im Juli entschieden sie sich für ein gewagtes Unternehmen in Barcelona und raubten im Museum Picasso das Porträt der Se/ora Canals. Nur eine Woche später verschwanden die hübschen Häuser von Fenouillet so unauffällig von den Wänden des Matisse-Museums in Nizza, dass die ratlose französische Polizei sich fragte, ob das Bild Beine bekommen habe und selbst hinausspaziert sei. Und am letzten Augusttag folgte der nach klassischem Muster ablaufende gewaltsame Raub von Vincent van Goghs Selbstporträt mit verbundenem Ohr aus der Londoner Courtauld Gallery. Das gesamte Unternehmen war in erstaunlichen siebenundneunzig Sekunden erledigt – umso eindrucksvoller, weil einer der Täter auf der Flucht durch ein Fenster im ersten Stock sich auch noch die Zeit nahm, Modiglianis üppigen Weiblichen Akt mit einer obszönen Geste zu kommentieren. Bereits am selben Abend machte das Bberwachungsvideo Furore im Internet. Dies sei, sagte der verzweifelte Museumsdirektor, der passende Abschluss eines fürchterlichen Sommers.
Die Diebstähle führten zu vorhersehbaren Anschuldigungen wegen zu laxer Sicherheitsvorkehrungen in den Museen von Weltrang. Die Times berichtete, bei einer kürzlich durchgeführten internen Risikobewertung in der Courtauld Gallery sei dringend empfohlen worden, den van Gogh in einen sichereren Saal zu hängen. Das sei jedoch nicht umgesetzt worden, weil er dem Museumsdirektor an seinem angestammten Platz besser gefiel. Um sich nicht übertreffen zu lassen, brachte der Telegraph eine fundierte Serie über die finanziellen Schwierigkeiten der großen britischen Museen. Dabei stellte sich heraus, dass die National Gallery und die Tate ihre Sammlungen nicht einmal versicherten, sondern ganz auf Bberwachungskameras und schlecht bezahltes Wachpersonal setzten. „Wir sollten uns nicht fragen, wie es kommt, dass große Kunstwerke aus Museen verschwinden“, erklärte der bekannte Londoner Kunsthändler Julian Isherwood der Zeitung. „Stattdessen sollten wir uns fragen, warum das nicht öfter passiert. Unser kulturelles Erbe wird Stück für Stück geplündert.“
Die wenigen Museen, die das Geld dafür hatten, verschärften rasch ihre Sicherheitsmaßnahmen, während die übrigen, die von der Hand in den Mund lebten, nur ihre Türen verriegeln und hoffen konnten, nicht auf der Liste der Diebe zu stehen. Aber als der September ohne weiteren Diebstahl verstrich, atmete die Kunstwelt kollektiv auf und versicherte sich unbekümmert, das Schlimmste sei überstanden. Die Welt der gewöhnlichen Sterblichen hatte sich ohnehin schon dringlicheren Themen zugewandt. Solange im Irak und in Afghanistan Krieg herrschte und die Weltwirtschaft am Rand des Abgrunds balancierte, konnten sich nur wenige über das Verschwinden von vier bemalten Leinwandrechtecken empören. Der Leiter einer internationalen Hilfsorganisation schätzte, mit dem Erlös der gestohlenen Werke ließen sich die Hungernden Afrikas über Jahre hinweg ernähren. Wäre es nicht besser, fragte er, wenn die Reichen ihre überschüssigen Millionen nützlicher verwendeten, als ihre Wände mit Kunstwerken vollzuhängen und ihre geheimen Bankschließfächer damit zu füllen?
Solche Worte waren Ketzerei für Julian Isherwood und seine Kollegen, die sich ihren Lebensunterhalt mit der Habgier der Reichen verdienten. Auf fruchtbaren Boden fielen sie jedoch in Glastonbury, dem alten Wallfahrtsort auf den Somerset Levels westlich von London. Im Mittelalter waren die Gläubigen nach Glastonbury gepilgert, um die berühmte Abtei zu besichtigen und unter dem heiligen Dornbaum zu stehen, der gewachsen sein sollte, als Josef von Arimathäa, ein Jünger Jesu, im Jahr 63 n. Chr. dort seinen Wanderstab abgelegt hatte. Heutzutage, fast zwei Jahrtausende später, war die Abtei nur noch eine prachtvolle Ruine: Die Reste ihres einst hoch aufragenden Mittelschiffs standen verloren in einer smaragdgrünen Parklandschaft – wie Grabsteine eines untergegangenen Glaubens. Die neuen Glastonbury-Pilger machten sich selten die Mühe, sie zu besichtigen. Sie zogen es vor, den als Tor bekannten mystischen Hügel zu besteigen oder an den Läden für New-Age-Utensilien vorbeizuschlurfen, mit denen die High Street dicht gesäumt war. Manche kamen auf der Suche nach sich selbst, andere suchten eine Hand, die sie führen würde. Und einige wenige kamen tatsächlich auf der Suche nach Gott – oder zumindest nach einem glaubhaften Faksimile Gottes.
Christopher Liddell war aus keinem dieser Gründe hier. Er war wegen einer Frau gekommen und blieb wegen eines Kindes. Er war kein Pilger, sondern ein Gefangener.
Hester hatte ihn hierher geschleppt: Hester, seine große Liebe, sein schlimmster Fehler. Vor fünf Jahren hatte sie darauf bestanden, Notting Hill zu verlassen, damit sie sich in Glastonbury finden könne. Bei ihrer Selbstfindung hatte Hester jedoch entdeckt, dass der Schlüssel zu ihrem Glück darin lag, Liddell zu verlassen. Ein anderer Mann wäre vielleicht versucht gewesen, wegzuziehen. Aber während Liddell ohne Hester leben konnte, wollte er sich ein Leben ohne Emily nicht einmal vorstellen. Lieber in Glastonbury bleiben und die Druiden und Heiden ertragen, als nach London zurückzukehren und in der Erinnerung seines einzigen Kindes zu verblassen. Und so verbarg Liddell seinen Kummer und seinen Drger und machte tapfer weiter. So reagierte er auf alle Herausforderungen. Auf ihn war Verlass. Seiner Ansicht nach war das der wichtigste Charakterzug eines Mannes.
Glastonbury war nicht ganz ohne Charme. Zu seinen Reizen gehörte seit 2005 das CafE Hundred Monkeys mit vegetarischer und umweltfreundlicher Küche, das Liddells Stammlokal war. Liddell saß an seinem gewohnten Tisch und hatte ein Exemplar des Evening Standard schützend vor sich ausgebreitet. Am Nebentisch las eine Frau in mittleren Jahren ein Buch mit dem Titel Erwachsene Kinder: die geheime Dysfunktion. In der hintersten Ecke predigte ein Prophet mit Glatze und wallendem weißen Bart sechs aufmerksam zuhörenden Schülern von den Geheimnissen des Zen-Spiritualismus. Und an dem Tisch am Ausgang saß ein Mann Anfang dreißig, der die Hände nachdenklich unter sein unrasiertes Kinn gelegt hatte. Sein Blick war auf die Anschlagtafel gerichtet. Dort hing der übliche Schund – eine Einladung zum Beitritt der hiesigen Gruppe für Positives Leben, die Ankündigung eines kostenlosen Seminars zur Analyse von Eulen-Gewölle, ein Werbezettel für tibetanisches Impulsheilen –, aber der Mann schien die Aushänge ungewöhnlich aufmerksam zu lesen. Vor ihm stand eine Tasse Kaffee, die er nicht angerührt hatte, neben einem aufgeschlagenen Notizbuch, ebenfalls nicht angerührt. Ein Dichter auf der Suche nach einer Inspiration, dachte Liddell. Ein Polemiker, der darauf wartet, dass Wut einsetzt.
Liddell taxierte ihn mit geübtem Blick. Wie jedermann in Glastonbury trug er zerschlissene Jeans und ein Flanellhemd. Sein zurückgekämmtes dunkles Haar steckte in einem kurzen Pferdeschwanz, seine fast schwarzen Augen wirkten ein wenig glasig. Am rechten Handgelenk trug er eine Uhr mit breitem Lederband, am linken mehrere billige Armreifen aus Kupfer und Silber. Liddell suchte Handrücken und Unterarme nach Tätowierungen ab, fand jedoch keine. Merkwürdig, dachte er, denn in Glastonbury zeigten sogar Großmütter stolz ihre Tätowierungen. Unberührte Haut war hier so selten zu sehen wie die Sonne im Winter.
Die Bedienung kam und legte den Kassenbon neckisch mitten auf Liddells Zeitung. Sie war eine groß gewachsene junge Frau, ziemlich hübsch, mit strohblondem Haar, das sie in der Mitte gescheitelt trug, und einem Schild mit dem Namen GRACE an ihrem knapp sitzenden Pulli. Aber seit Hester ihn sitzengelassen hatte, hatte Liddell die Fähigkeit verloren, sich mit fremden Frauen zu unterhalten. Außerdem gab es jetzt eine andere Frau in seinem Leben. Sie war ein stilles Mädchen, das seine Fehler tolerierte, für seine Zuneigung dankbar war. Und vor allem brauchte sie ihn so dringend wie er sie. Sie war die perfekte Liebhaberin. Die perfekte Geliebte. Und sie war Christopher Liddells Geheimnis.
Er zahlte die Rechnung bar – Kreditkarten gehörten zu den vielen Dingen, wegen denen er mit Hester Krieg führte – und ging zum Ausgang. Der Dichter-Polemiker kritzelte eifrig in sein Notizbuch. Liddell schlüpfte an ihm vorbei und ging hinaus auf die Straße. Draußen herrschte leichter Nieselregen, und irgendwo in der Ferne war rhythmisches Trommeln zu hören. Dann fiel ihm ein, dass heute Donnerstag war: der Abend für schamanische Trommeltherapie im Bürgerhaus.
Liddell überquerte die Straße und ging an der St. John,s Church und dem Gemeindekindergarten vorbei. Morgen Nachmittag um vierzehn Uhr würde er zwischen Müttern und Kindermädchen stehen, um Emily zu begrüßen, wenn sie herauskam. Der Richterspruch hatte ihn zu wenig mehr als einem Babysitter degradiert. Zwei Stunden täglich war die ihm zugeteilte Zeit, kaum genug für ein paar Karussellfahrten und ein Korinthenbrötchen in der Bäckerei. Hesters Rache.
Er bog in die Church Lane ab: eine zwischen sandsteingrauen hohen Mauern verlaufende schmale Gasse. Die einzige Straßenlampe war wie gewöhnlich durchgebrannt, auf der Gasse herrschte schwärzeste Nacht. Liddell hatte seit Langem vor, sich eine kleine Taschenlampe von der Art zu kaufen, die seine Großeltern während des Kriegs gehabt hatten. Er glaubte Schritte hinter sich zu hören und spähte über die Schulter ins Dunkel. Dort war niemand, entschied er, alles nur Einbildung. Alberner Christopher, konnte er Hester sagen hören. Dummer, dummer Kerl.
Am Ende der Gasse begann ein kleines Wohngebiet mit Terrassen- und Doppelhäusern. Henley Close lag am Nordrand mit Blick auf einen Sportplatz. Seine vier Cottages waren etwas größer als die meisten in diesem Viertel und hatten von Mauern umgebene Gärten. Seit Hester fort war, wirkte der Garten der Nummer acht zunehmend melancholisch verwahrlost, wofür Liddell böse Blicke des Paars von nebenan einstecken musste. Er steckte seinen Schlüssel ins Schloss und sperrte die Haustür auf. In der Diele empfing ihn das laute Piepen der Alarmanlage. Er tippte den Ausschaltcode – Emilys Geburtsdatum in acht Zahlen –, dann stieg er ins Dachgeschoss hinauf. Die junge Frau wartete dort in der Dunkelheit. Liddell machte Licht.
„Politisch aktueller sowie brisant, rasend spannender Thriller. Urlaubslektüre vom Feinsten.“
„Packend bis zur letzten Seite. (...) So muss ein moderner Thriller sein.“
„Sein bislang bestes Werk.“
„Daniel Silva versteht es mal wieder meisterlich, eine hochsensible Geschichte kompakt, spannend sowie mit viel Gefühl für Sprache und Stil zu erzählen.“
„Große Verbrechen, schöne Frauen und edle Kunst – ein gelungener Mix.“
„Ein gehaltvoller Thriller.“
„Packend.“
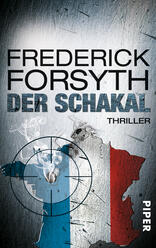

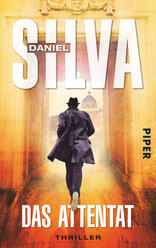


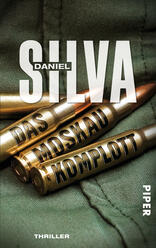







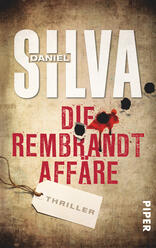



DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.