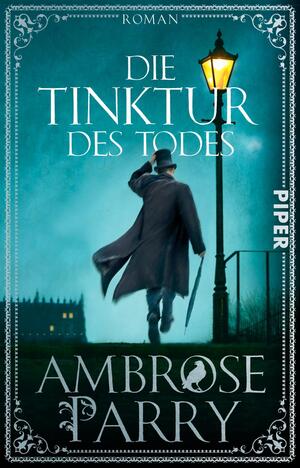

Die Tinktur des Todes (Die Morde von Edinburgh 1) Die Tinktur des Todes (Die Morde von Edinburgh 1) - eBook-Ausgabe
Roman
— Ein historischer Krimi der besonderen Art – Medizin trifft auf MordDas Buch ist flott vom Stil her, bringt die Stadt, die Einwohner und die damaliege Zeit sehr gut rüber. Geschichte in der Geschichte mag ich einfach irre gerne. - Kejas Wort Rausch
Die Tinktur des Todes (Die Morde von Edinburgh 1) — Inhalt
„Eine Aufsehen erregende Kriminalgeschichte vor dem Hintergrund medizinischer Experimente im Edinburgh des 19. Jahrhunderts. Das Buch lässt sowohl die Stadt als auch die Epoche lebendig werden und ist eine großartige Lektüre.“ Ian Rankin
1847: Eine brutale Mordserie an jungen Frauen erschüttert Edinburgh. Alle Opfer sind auf dieselbe grausame Weise gestorben. Zur gleichen Zeit tritt der Medizinstudent Will Raven seine Stelle bei dem brillanten und renommierten Geburtshelfer Dr. Simpson an, in dessen Haus regelmäßig bahnbrechende Experimente mit neu entdeckten Betäubungsmitteln stattfinden. Hier trifft Will auf das wissbegierige Hausmädchen Sarah, die jedoch einen großen Bogen um ihn macht und rasch erkennt, dass er ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt. Beide haben ganz persönliche Motive, die Morde aufklären zu wollen. Ihre Ermittlungen führen sie in die dunkelsten Ecken von Edinburghs Unterwelt und nur, wenn es ihnen gelingt, ihre gegenseitige Abneigung zu überwinden, haben sie eine Chance, lebend wieder herauszufinden.
„Parrys viktorianisches Edinburgh wird auf eindringliche Weise lebendig – als Welt des Schmerzes.“ Val McDermid
Ambrose Parry ist das gemeinsame Pseudonym von Christopher Brookmyre und Marisa Haetzman. Das Paar ist verheiratet und lebt in Schottland. Brookmyre arbeitete nach seinem Studium der Englischen Literatur- und Theaterwissenschaften als Journalist in London, Los Angeles und Edinburgh. Der mehrfach preisgekrönte Autor hat über zwanzig Romane veröffentlicht, darunter internationale Bestseller. Marisa Haetzman ist Medizinhistorikerin und hat zwanzig Jahre als Anästhesistin gearbeitet. Ihre Forschungsarbeit zur modernen Anästhesie inspirierte das Paar, „Die Tinktur des Todes“ zu schreiben.
Sherlock Holmes trifft Jack the Ripper – die packende Krimi-Reihe im historischen Edinburgh
Die „Morde von Edinburgh“-Reihe schickt sich an, dem viktorianischen Historienroman ein neues, schauriges Kapitel hinzuzufügen, das sich vor den großen Vorbildern des Genres nicht verstecken muss. Denn mit den sympathischen Protagonisten Will Raven und Sarah Fisher hat Ambrose Parry ein neues Powerpaar erschaffen, dem seine Fans in jedes Abenteuer folgen.
Leseprobe zu „Die Tinktur des Todes (Die Morde von Edinburgh 1)“
Kapitel 1
Eine gute Geschichte sollte nicht mit einer toten Dirne beginnen – dafür bitte ich um Verzeihung –, schließlich handelt es sich nicht um ein Thema, mit dem achtbare Menschen sich gern zu befassen pflegen. Doch gerade die Überzeugung, die braven Leute Edinburghs würden sich solch einer Angelegenheit niemals widmen, führte Will Raven im Winter 1847 auf seinen schicksalhaften Weg. Zwar hätte Raven die Entdeckung der unglücklichen Evie Lawson ungern als Beginn seiner eigenen Geschichte betrachtet gewusst, doch trieb ihn vor allem die [...]
Kapitel 1
Eine gute Geschichte sollte nicht mit einer toten Dirne beginnen – dafür bitte ich um Verzeihung –, schließlich handelt es sich nicht um ein Thema, mit dem achtbare Menschen sich gern zu befassen pflegen. Doch gerade die Überzeugung, die braven Leute Edinburghs würden sich solch einer Angelegenheit niemals widmen, führte Will Raven im Winter 1847 auf seinen schicksalhaften Weg. Zwar hätte Raven die Entdeckung der unglücklichen Evie Lawson ungern als Beginn seiner eigenen Geschichte betrachtet gewusst, doch trieb ihn vor allem die Entschlossenheit an, dass es nicht das Ende der ihren bleiben durfte.
Er fand sie in einer kalten, schiefen, kleinen Dachkammer im vierten Stock am Canongate. Es stank nach Alkohol und Schweiß, kaum abgemildert von einer angenehmeren Note: einem Damenduft, wenn auch einem billigen, der nur eine käufliche Dame verhieß. Wenn er mit diesem Geruch in der Nase die Augen schloss, konnte er sich vorstellen, sie wäre noch dort und würde sich gleich zum dritten oder vierten Mal in ebenso vielen Stunden wieder hinunter auf die Straße schleppen. Doch seine Augen standen offen, und er brauchte auch nicht nach dem fehlenden Puls zu tasten, um sich zu versichern.
Raven war mit dem Sterben vertraut und erkannte, dass ihr Übergang von diesem Leben ins nächste kein leichter gewesen war. Die Laken waren zerwühlt, also hatte sie sich wohl stärker gewunden als jemals zuvor in gespielter Leidenschaft, und Raven fürchtete, es habe länger gedauert als jede Zusammenkunft mit einem ihrer Freier. Ihr Körper ruhte ganz und gar nicht in Frieden, sondern er lag vollkommen verrenkt da, als quälte sie immer noch der Schmerz, der sie fortgetragen hatte, als hätte der Tod ihr keine Erlösung gebracht. Ihre Stirn blieb zerfurcht, ihr Mund aufgesperrt. In den Mundwinkeln hatte sich Schaum gesammelt.
Raven legte die Hand auf ihren Arm und zog sie schnell wieder zurück. Er erschrak vor der Kälte, auch wenn er es nicht hätte sollen. Schließlich war er den Umgang mit Leichen gewohnt, nicht allerdings den mit einer Leiche, deren Berührung im warmen Zustand er gekannt hatte. In diesem Augenblick des Kontaktes bewegte ihr Übergang von einem Menschen zu einer Sache in ihm etwas Uraltes.
Schon viele Männer vor ihm hatten in diesem Zimmer gesehen, wie Evie sich verwandelte: vom Objekt äußerster Begierde zum armseligen Gefäß des ungewollten Samens, angebetet bis zum Moment des Ergusses, dann verhasst.
Doch nicht er. Wann immer sie beieinander gewesen waren, hatte er sich allein mit einer Verwandlung befasst – mit dem Wunsch, sie alledem zu entheben. Er war nicht bloß ein weiterer Freier. Sie waren Freunde: Nicht wahr? Deshalb hatte sie ihm doch ihre Hoffnung verraten, einmal eine Anstellung als Dienstmädchen in einem ehrbaren Hause zu finden, und deshalb hatte er auch versprochen, sich ihrethalben zu erkundigen, sobald er in den rechten Kreisen verkehrte.
Deshalb hatte sie ihn um Hilfe gebeten.
Sie hatte ihm nicht sagen wollen, wofür das Geld war, nur dass es eilte. Raven vermutete, dass sie es jemandem schuldete, doch der Versuch, ihr zu entlocken, wem, war aussichtslos. Dazu war Evie viel zu erfahren in der Kunst der Täuschung. Jedenfalls wirkte sie außerordentlich erleichtert und versicherte ihm unter Tränen ihre Dankbarkeit, als sie die Summe hatte. Er verriet ihr nicht, woher er das Geld hatte, und verschwieg die Sorge, dass er nun womöglich bei demselben Geldleiher in der Kreide stand und Evies Schuld lediglich auf sich überschrieben hatte.
Letztere betrug zwei Guineas, von denen er gut und gerne mehrere Wochen hätte leben können und zu deren Rückzahlung er folglich nicht unmittelbar imstande war. Das sorgte ihn aber nicht. Er wollte helfen. Raven wusste, dass manche die Vorstellung belächelt hätten, doch wenn Evie glaubte, sie könne sich als Dienstmädchen neu erfinden, dann wollte er es um ihretwillen doppelt glauben.
Doch das Geld hatte sie nicht gerettet, und nun gab es keinen Ausweg mehr.
Er sah sich im Zimmer um. Die Reste zweier Kerzen flackerten in alten Ginflaschen, während eine dritte schon vor Langem ganz abgeschmolzen war. Im winzigen Kamin glommen noch schwach die Reste eines Feuers, in das sie normalerweise schon vor Stunden sparsam Kohlen aus der Schütte nachgelegt hätte. Am Bett stand eine flache Schüssel Wasser, über deren Rand nasse Lappen hingen, daneben ein Krug. Damit wusch sie sich hinterher. In der Nähe lag eine Flasche Gin in einem Pfützchen, das zeigte, wie wenig noch darin gewesen war, als sie umkippte.
Die Flasche trug kein Etikett, ihre Herkunft war unbekannt und deshalb verdächtig. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass irgendein Hinterhoffuselbrenner versehentlich einen Todestrunk gepanscht hatte. Komplizierter wurde diese Deutung aber durch den Anblick einer noch halb vollen Flasche Brandy auf der Fensterbank. Die hatte wohl ein Freier mitgebracht.
Raven fragte sich, ob dieser auch Evies Todesqualen beigewohnt und die Flasche in der Eile, dem Nachspiel zu entfliehen, zurückgelassen hatte. Wenn Ersteres stimmte, warum hatte er dann nicht um Hilfe gerufen? Wahrscheinlich, weil es für manche ebenso schlimm wäre, mit einer kranken Buhldirne erwischt zu werden wie mit einer toten, warum sollte man also die Aufmerksamkeit auf sich lenken? Das war Edinburgh: öffentlicher Anstand und heimliche Sünde, Stadt Tausender Doppelleben.
Genau. Manchmal brauchte es nicht mal einen Erguss, damit sich das Gefäß verwandelte.
Er sah sich noch einmal die glasige Leere ihrer Augen an, die verzerrte Fratze, die nichts mehr mit ihrem Gesicht gemein hatte. Er schluckte, weil er einen Kloß im Hals hatte. Zum ersten Mal hatte Raven sie vier Jahre vorher gesehen, als er noch Internatsschüler an George Heriot’s School für vaterlose Jungen gewesen war. Er erinnerte sich gut an die Tuscheleien der älteren Jungen, die wussten, wen sie vor sich hatten, wenn sie sie auf dem Cowgate sahen. Sie waren voll dieser seltsamen Mischung aus lüsterner Faszination und ängstlichem Spott gewesen, misstrauisch gegenüber all dem, was ihr eigener Instinkt sie spüren ließ. Sie wollten sie, sie hassten sie, selbst damals schon. Nichts hatte sich seitdem geändert.
In dem Alter wirkte die Zukunft ungreifbar, auch wenn er darauf zuraste. Für Raven war Evie die Gesandte einer Welt, die er noch nicht bewohnen durfte. Aus diesem Grunde betrachtete er sie als jemanden, der über ihm stand, auch dann noch, als er merkte, dass die Zukunft bereits da war, und erfuhr, wie überaus greifbar gewisse Dinge in Wirklichkeit waren.
Sie wirkte so viel älter, so viel weltgewandter, bis er mit der Zeit verstand, dass sie nur einen kleinen, düsteren Teil der Welt kennengelernt hatte, und den weit ausgiebiger, als es eine Frau jemals sollte. Eine Frau? Ein Mädchen. Er erfuhr später, dass sie fast ein Jahr jünger war als er. Sie musste vierzehn gewesen sein, als er sie auf dem Cowgate gesehen hatte. Wie sie in seiner Vorstellung gewachsen war zwischen jenem Moment und dem, als er sie zum ersten Mal besessen hatte: ein Versprechen wahrer Fraulichkeit und all dessen, was er sich davon erträumte.
Ihre Welt war klein und armselig gewesen. Sie verdiente es, einmal eine größere, eine bessere kennenzulernen. Deshalb hatte er ihr das Geld gegeben. Das war nun genauso fort wie sie, und Raven hatte nicht den geringsten Hinweis, wofür er mit seinen Schulden hergehalten hatte.
Einen Augenblick lang war ihm, als würden Tränen kommen, aber ein wachsamer Instinkt ermahnte ihn, sich von diesem Ort zu entfernen, bevor er gesehen wurde.
Er verließ das Zimmer mit leisen Schritten und schloss behutsam die Tür. Als er die Treppe hinabschlich, kam er sich wie ein Dieb und Feigling vor, der Evie zurückließ, um seinen Ruf zu schützen. Von anderswo auf dem Stockwerk hörte er Kopulationsgeräusche, die übertriebenen Schreie einer jungen Frau, die Ekstase vortäuschte, um das Ende herbeizuführen.
Raven fragte sich, wer Evie nun finden würde. Wahrscheinlich ihre Vermieterin: die durch und durch verschlagene Effie Peake. Obgleich sie gern Unwissenheit vorschützte, wenn es ihr nutzte, entging ihr wenig von dem, was unter ihrem Dach geschah, zumindest bevor sie sich am Abend dem Gin hingab. Raven war sich aber sicher, dass es dafür noch zu früh war, weshalb er besonders leise auftrat.
Er ging durch die Hintertür, vorbei am Küchenabfallhaufen, und kam über dreißig Meter von der Vordertür entfernt aus einer Gasse auf das Canongate. Unter dem schwarzen Himmel war die Luft kühl, aber alles andere als frisch. Hier stank es aus allen Winkeln vor Unflat, so viele Leben stapelten sich im schmutzigen Labyrinth der Old Town, ganz wie bei Bruegels Turmbau zu Babel oder Botticellis Karte der Hölle.
Raven wusste, dass er für eine letzte Nacht in sein kaltes, freudloses Zimmer in der Bakehouse Close zurückkehren sollte. Am nächsten Tag stand ihm ein vollständiger Neuanfang bevor, für den er sich ausruhen musste. Nach allem, was er gesehen hatte, würde der Schlaf aber ohnehin ausbleiben. Es war weder eine Nacht für Einsamkeit noch für Nüchternheit.
Das einzige Gegenmittel gegen das Aufeinandertreffen mit dem Tod bestand in einer innigen Umarmung des Lebens, auch wenn es eine übel riechende, verschwitzte und grobe war.
Kapitel 2
Aitken’s Tavern war ein Sumpf aus Leibern, ein Don nerlärm aus Männerstimmen, die einander immer lauter zu übertönen suchten, und das Ganze in einen dichten Pfeifendunst gehüllt. Raven selbst frönte dem Tabak nicht, genoss aber seine Süße in der Nase, ganz besonders in einem Lokal wie diesem, wo er andere Gerüche überdeckte.
Raven stand an der Bar, trank Ale und redete mit niemand Besonderem, allein, aber nicht einsam. An diesem warmen Platz konnte man sich gut verlieren, das Stimmengewirr bot seinen Gedanken einen besseren Hintergrund als jede Stille, aber ihm war auch die Ablenkung durch die verschiedenen Gespräche willkommen, als wäre jedes von ihnen eine winzige Szene, die sich zu seiner Zerstreuung abspielte. Es wurde über den Bau der neuen Caledonian Railway Station am Ende der Princes Street gesprochen, und Sorgen wurden geäußert, dass nun Horden hungernder Iren aus Glasgow einfallen würden.
Jedes Mal, wenn er sich umdrehte, sah er Gesichter, die er kannte, manche schon aus der Zeit, als er ein Lokal wie dieses noch gar nicht betreten durfte. Die Old Town wimmelte von Tausenden von Menschen, die man ein Mal auf der Straße sah und danach nie wieder, und doch hatte sie gleichzeitig etwas von einem Dorf. Wo man auch hinschaute, fand man vertraute Gesichter – und ebenso vertraute Augenpaare, die einem folgten.
Er bemerkte einen Mann mit uraltem, lumpigem Hut, der mehr als einmal einen Blick in seine Richtung warf. Raven erkannte ihn nicht, aber jener ihn offensichtlich schon, und sein Blick zeugte kaum von Zuneigung. Sicher jemand, mit dem er sich einmal geprügelt hatte, wobei das Bier nicht nur den Streit herbeigeführt, sondern auch Ravens Gedächtnis getrübt hatte. Lumpenhuts sauertöpfischer Miene nach zu urteilen hatte er wohl den Kürzeren gezogen.
Womöglich war der Alkohol aber nicht der einzige Grund gewesen, zumindest auf Ravens Seite. Manchmal hatte er ein düsteres Verlangen in sich, auf das er mittlerweile achtgab, wenn auch nicht genug, um es vollkommen zu beherrschen. An diesem Abend hatte er es wieder im Zwielicht der Dachkammer gespürt, und er konnte nicht sagen, ob er hierhergekommen war, um es zu ertränken oder zu bestärken.
Er erwiderte Lumpenhuts Blick noch einmal, woraufhin der zur Tür huschte. Er bewegte sich zielgerichteter als wohl die meisten Männer, die einen Pub verlassen, und warf noch einen letzten Blick auf Raven, bevor er in die Nacht entschwand.
Raven widmete sich wieder seinem Bier und dachte nicht mehr an ihn.
Als er seinen Krug wieder hob, schlug ihm eine Hand auf den Rücken, verweilte und griff seine Schulter. Instinktiv ballte er die Faust, holte aus und fuhr herum.
„Langsam, Raven! Begrüßt man so einen Kollegen? Erst recht einen, der noch genügend Kleingeld in der Tasche hat, um es mit seinem Durst aufzunehmen?“
Es war sein Freund Henry, den er wohl im Getümmel übersehen hatte.
„Entschuldigung“, erwiderte Raven. „Man kann heutzutage im Aitken’s gar nicht mehr vorsichtig genug sein, das Lokal hat nachgelassen. Wie ich höre, lassen sie mittlerweile sogar schon Chirurgen rein.“
„Einen Mann von deinen Aussichten hätte ich auch gar nicht mehr in einer Schenke der Old Town erwartet. Du hast Großes vor dir. Den besten Einstand wird es sicher nicht abgeben, wenn du dich deinem neuen Arbeitgeber nach durchzechter Nacht vorstellst.“
Henry scherzte, das wusste Raven, aber doch war es ein Wink zur rechten Zeit, dass er es nicht übertreiben durfte. Ein, zwei Gläser würden ihm sicher schlafen helfen, aber jetzt, da er Gesellschaft hatte, würde es wahrscheinlich nicht dabei bleiben.
„Und du selbst? Erwarten dich am Morgen denn keine Verpflichtungen?“, erwiderte Raven.
„Doch, in der Tat, aber da ich meinen alten Freund Will Raven verhindert wähnte, ersuchte ich den Beistand meiner beiden Gefährten Hopfen und Malz, um den Kummer meines heutigen Tagewerks abzumildern.“
Henry reichte ein paar Münzen über die Theke, und ihre Krüge wurden wieder aufgefüllt. Raven dankte ihm und sah zu, wie Henry einen großen Schluck trank.
„Eine beschwerliche Schicht also?“, fragte Raven.
„Eingeschlagene Schädel, gebrochene Knochen und ein weiterer Tod durch Peritonitis. Wieder eine junge Frau, armes Ding. Wir konnten ihr nicht helfen. Professor Syme konnte den Auslöser nicht ermitteln, was ihn in äußerste Rage versetzte und natürlich die Schuld aller anderen war.“
„Es wird also eine Obduktion geben?“
„Ja. Zu schade, dass du nicht dabei sein kannst. Klügeren Rat als unser derzeitiger Pathologe wüsstest du mit Sicherheit. Der ist oft ebenso alkoholgetränkt wie die Präparate in seinem Labor.“
„Eine junge Frau, sagst du?“, fragte Raven und dachte an die, die er eben erst zurückgelassen hatte. Evie würde keine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie gefunden wurde.
„Ja, warum?“
„Einfach so.“
Henry trank einen großen Schluck und musterte Raven nachdenklich. Der ahnte, welcher peinlichen Untersuchung er ausgesetzt war. Henry war ein begnadeter Diagnostiker, und das nicht nur im Bereich körperlicher Gebrechen.
„Geht es dir gut, Raven?“, fragte er mit aufrichtigem Ton.
„Besser, wenn ich das hier intus habe“, erwiderte er und gab sich Mühe, fröhlicher zu klingen. Doch Henry ließ sich nicht so leicht täuschen.
„Du hast bloß … diesen Blick, vor dem ich mich schon vor Langem in Acht zu nehmen gelernt habe. Weder teile ich deine krankhafte Hadersucht, noch möchte ich dich später zusammenflicken müssen, wenn ich eigentlich schlafen sollte.“
Raven wusste, dass ihm keine Widerrede zustand. Alle Anschuldigungen waren wahr, auch der Funke dieses düsteren Verlangens, der an diesem Abend in ihm glomm. Doch das Bier würde ihn auslöschen, da war er sich nun, in Henrys Gesellschaft, sicher.
Du hast den Teufel in dir, hatte seine Mutter ihn als Kind oft ermahnt. Manchmal geschah das im Scherz, manchmal weniger.
„Ich habe jetzt gute Aussichten, Henry“, versicherte er, schob etwas Geld über die Theke und bat mit einer Geste, die zwei Krüge nachfüllen zu lassen, „und ich habe nicht vor, sie aufs Spiel zu setzen.“
„In der Tat gute Aussichten“, antwortete Henry. „Doch warum der geschätzte Professor der Geburtshilfe gerade einem Schurken wie dir einen solch begehrten Posten angeboten hat, bleibt mir ein Rätsel.“
So ungern er es zugab, beschäftigte diese Frage auch ihn. Er hatte hart für die Anerkennung des Professors gearbeitet, aber es hatte mehrere gleichermaßen gewissenhafte und arbeitsame Mitbewerber um die Famulatur gegeben. Er hatte keinen festen Anhaltspunkt, warum gerade er den Vorzug bekommen hatte, und er dachte nur ungern darüber nach, ob diese Entscheidung womöglich aus einer flüchtigen Laune heraus getroffen worden war.
„Der Professor kommt selbst aus einfachen Verhältnissen“, sagte Raven, was Henry ebenso wenig zufriedenstellen dürfte wie ihn selbst. „Vielleicht glaubt er, dass derartige Gelegenheiten nicht allein den Hochwohlgeborenen vorbehalten bleiben sollten.“
„Oder er hat eine Wette verloren, und du bist die Schuld.“
Das Bier floss und mit ihm die alten Geschichten. Das half. Evies Anblick flackerte ihm immer wieder vor Augen wie die Kerzen in ihrer Kammer. Aber während er Henry zuhörte, musste er an die Welt denken, die Evie nicht zu sehen bekommen hatte, an die Gelegenheit, die ihn auf der anderen Seite der North Bridge erwartete. Ein Teil seiner Liebe zu diesem Ort und der Old Town im Allgemeinen war an diesem Abend gestorben. Es war an der Zeit, das alles zurückzulassen, und wenn jemand an Neuanfänge glaubte, dann Will Raven. Er hatte sich schon einmal neu erfunden, und er würde es nun wieder tun.
Mehrere Bierkrüge später standen sie draußen vor Aitken’s und sahen ihren Atem in der kühlen Luft zu Dampf werden.
„Es war schön, dich mal wieder zu sehen“, sagte Henry. „Aber ich muss zu Bett. Syme operiert morgen, und er ist hundsgemein, wenn er bei seinen Assistenten noch Tabak und Bier vom Vorabend riecht.“
„Ja, ›hundsgemein‹ passt auf Syme“, erwiderte Raven. „Obwohl mir da noch ganz andere Tiere einfallen würden. Ich kehre einstweilen noch ein letztes Mal in mein Quartier bei Mrs Cherry zurück.“
„Du wirst sie und ihr klumpiges Porridge sicher noch vermissen“, rief Henry, als er in Richtung Infirmary auf die South Bridge einbog. „Ganz zu schweigen von ihrer überschäumenden Wesensart.“
„Die und Syme würden sicher ein gutes Paar abgeben“, rief Raven zurück, ging über die Straße und Richtung Osten auf seine Unterkunft zu.
An gewisse Umstände seiner Zeit hier würde Raven sich wohl einmal voller Nostalgie, ja Wehmut erinnern, aber seine Bleibe zählte nicht dazu. Ma Cherry war ein zänkisches altes Weib, das seinem Namen nur insoweit gerecht wurde, als auch sie rund und rot war, aber süß war an ihr überhaupt nichts. Sie war sauer wie Ohrenschmalz und vertrocknet wie eine Wüstenleiche, aber sie führte eine Pension, die zu den günstigsten der Stadt zählte; in Sachen Komfort und Sauberkeit eine Stufe über dem Zuchthaus.
Der Wind blies ihm einen kalten Nieselregen um die Ohren, als er die High Street hinab Richtung Netherbow ging. Seit er bei Aitken’s aufgebrochen war, waren Wolken aufgezogen, und das Mondlicht war verschwunden. Ihm fiel auf, dass manche der Straßenlaternen dunkel blieben, sodass es fast unmöglich war, den Kothaufen auf dem Trottoir auszuweichen. Im Stillen verfluchte er den Laternenanzünder, der seine doch sicher recht einfache Arbeit nicht getan hatte. Wenn er selbst so nachlässig wäre, würden Menschen sterben.
Das Anzünden der Laternen fiel genauso in den Zuständigkeitsbereich der Polizei wie das Sauberhalten der Gosse. Vorrang vor allem anderen aber hatte für sie die Ermittlung und Rückführung gestohlenen Eigentums. Wenn sie dieser Pflicht ebenso gewissenhaft nachkam wie ihren anderen, konnte jeder Dieb in den Lothian Districts ruhig schlafen, dachte Raven.
Als er sich der Bakehouse Close näherte, trat er in etwas Weiches, und sein linker Schuh füllte sich mit Wasser; zumindest hoffte er, dass es Wasser war. Er hinkte ein paar Meter und versuchte abzuschütteln, was noch an seiner Sohle hing. Dann merkte er, dass eine Gestalt aus einem Eingang getreten war und ein Stück weit vor ihm stand. Er fragte sich, worauf der Bursche wartete und warum er im immer stärkeren Regen verweilte. Bis Raven in der Dunkelheit sein Gesicht erkannte, war er dem anderen so nah gekommen, dass er auch schon den Gestank seiner Zahnfäule roch.
Seinen Namen kannte Raven nicht, aber er hatte ihn schon einmal gesehen: einer von Flints Männern. Raven hatte ihn „das Wiesel“ getauft, weil er verstohlen wirkte und ein Nagetiergesicht hatte. Das Wiesel war sicher niemand, der Raven allein entgegentreten würde, also hatte er vermutlich einen Spießgesellen in der Nähe. Wahrscheinlich den etwas lahmgeistigen Burschen, der auch zuletzt bei ihm war: Stummel, wie Raven ihn nannte, weil ihm nur noch ein einzelner Zahn aus dem ruinierten Kiefer ragte. Wahrscheinlich war Raven ein paar Augenblicke zuvor an ihm vorbeigekommen, ohne es zu merken. Er lauerte sicher in einem anderen Hauseingang, um Raven den Weg abzuschneiden, falls er wegrannte.
Dieses Treffen beruhte nicht auf Zufall. Ihm fiel wieder der Mann ein, der ihn angestarrt und dann so zielstrebig das Lokal verlassen hatte.
„Mr Raven, Sie gehen mir doch nicht etwa aus dem Weg, oder?“
„Da mir nichts einfällt, was mir Ihre Gesellschaft anempfehlen würde, wäre es tatsächlich ein allgemeiner Vorsatz meinerseits, Ihnen auszuweichen, nur ahnte ich nicht, dass ich gesucht werde.“
„Wer Mr Flint etwas schuldet, wird immer gesucht. Aber Sie können sich meiner Abwesenheit gewiss sein, sobald Sie Ihre Schulden beglichen haben.“
„Beglichen? Ich schulde die Summe doch kaum vierzehn Tage! Wie wäre es also, wenn Sie mir schon mal einen Vorschuss auf Ihre Abwesenheit geben und mir aus dem Weg treten?“
Raven schob sich an ihm vorbei und ging weiter. Das Wiesel versuchte weder, ihn aufzuhalten, noch folgte es gleich. Es wartete wohl auf seinen Spießgesellen. Das Wiesel und Stummel waren es gewohnt, bereits gebrochenen Männern auch noch die Knochen zu brechen, und vielleicht hatte irgendein feiger Instinkt gespürt, dass Raven einem Kampf nicht ganz abgeneigt war. Zuvor hatte das Bier vielleicht das Feuer in ihm gelöscht, aber der Anblick dieser Afterblüte ließ es wieder auflodern.
Raven ging langsam und hörte die Schritte hinter sich. Er suchte im Zwielicht nach einer Waffe. Alles konnte als solche dienen – man musste nur wissen, wie. Sein Fuß stieß an etwas Hölzernes, und Raven hob es auf. Es war ein gesplitterter, ansonsten aber recht solider Stock.
Raven fuhr herum, richtete sich gleichzeitig auf und holte mit dem Knüppel in der Rechten aus, als in seinem Kopf etwas explodierte. Alles war Licht und eine Peitschenbewegung, als würde sein schlaffer Körper von seinem Kopf mitgerissen. Zu plötzlich, als dass er sich hätte abfangen können, knallte er auf das nasse Pflaster, dass die Knochen klapperten.
Benommen öffnete er die Augen und sah auf. Der Schlag hatte ihm wohl das Bewusstsein genommen, denn er fantasierte. Über ihm stand ein Monster. Ein Riese.
Von einer weit über zwei Meter großen Kreatur wurde er in eine dunkle Gasse geschleift. Schon der Kopf war doppelt so groß wie der jedes Menschen, die Stirn unmöglich hervorgewachsen wie ein Felsvorsprung an einer Klippe. Raven war gelähmt vor Schmerz und Schock und unfähig, sich zu regen, als dieser Gargantua sich vor ihm aufbäumte und mit dem Absatz auf ihn einstampfte. Ravens eigener Schrei hallte von den Mauern wider, als der Schmerz in ihm aufwallte. Er wand sich und zog alle Gliedmaßen nah an sich, bevor das baumstammartige Bein seines Angreifers noch einmal wie vom Vorschlaghammer getrieben auf ihn niederging.
Gargantua setzte sich rittlings auf ihn, sodass das bloße Gewicht seiner Schenkel Ravens Arme an den Boden heftete. Alles an diesem Monster wirkte gestreckt und außer Proportion, als wären manche seiner Teile einfach weitergewachsen und hätten den Rest zurückgelassen. Als es den Mund öffnete, zeigten sich gleichmäßige Lücken zwischen den Zähnen, also hatten die Kiefer sich wohl noch um sie ausgedehnt.
Der Schmerz war unbeschreiblich, und das Wissen, dass Gargantuas Fäuste jeden Moment ungehindert auf ihn einprügeln konnten, machte ihn noch schlimmer. Kein Alkohol konnte ausreichen, seine Sinne davor zu betäuben, sonst würden die Operationssäle mehr Whisky verbrauchen als Aitken’s.
In seinem Kopf tobte ein Sturm, zusammenhängende Gedanken waren zwischen Qual und Verwirrung kaum zu fassen, aber eins schien klar: Der Versuch war aussichtslos, sich zu wehren. Wollte dieses Monster ihn töten, würde er hier in dieser Gasse sterben.
Gargantuas Gesicht bot einen grotesken Anblick, es war wilder und verzerrter als das jeden Wasserspeiers an einer Kirchenmauer, aber vor allem seine dicken, wurstartigen Finger zogen im Zwielicht Ravens Blick auf sich. Da seine eigenen Hände hilflos fixiert waren, war er allem ausgeliefert, was diese gigantischen Pranken mit ihm anstellen wollten.
Raven war erleichtert, als sie seine Taschen durchwühlten, was aber nur kurz währte, denn ihm fiel ein, dass dort nicht viel zu holen war. Gargantua hatte Ravens wenige verbleibende Münzen in der Hand, als das Wiesel aus dem Schatten trat, das Geld einsteckte und sich neben das Monster hockte.
„Ach, auf einmal sind wir gar nicht mehr so vorlaut, was, Mr Raven?“
Das Wiesel zog ein Messer aus der Tasche und hielt es ins spärliche Licht der Gasse, damit Raven es sah. Es war gut zehn Zentimeter lang, die Klinge dünn und um den Holzgriff ein blutverschmierter Lumpen gewickelt.
Raven betete stumm um ein schnelles Ende seiner Tortur. Vielleicht ein aufwärtsgerichteter Stich unter die Rippen. Das Perikard würde sich mit Blut füllen, sein Herz aufhören zu schlagen, und es wäre vorbei.
„Da ich nun Ihre Aufmerksamkeit habe, lassen Sie uns einmal mit dem gebührenden Ernst über Ihre Schulden bei Mr Flint sprechen.“
Die Masse des Monsters auf sich und die Kehle vor Schmerz zugeschnürt, fand Raven kaum den Atem zum Sprechen. Das merkte das Wiesel wohl, denn es bedeutete dem Riesen, gerade so viel Gewicht von Raven zu nehmen, dass er ein Flüstern herausbekam.
„Wie uns zu Ohren gekommen ist, haben Sie Ihr Licht unter dem Scheffel gehalten. Seit Ihnen die Summe geliehen wurde, erfuhren wir, dass Sie der Sohn eines vornehmen Anwaltes in St Andrews sind. Nach einer neuerlichen Einschätzung Ihres Status hat Mr Flint also das erwartete Rückzahlungsdatum etwas vorgezogen.“
Auch wenn Gargantua ihn nicht mehr erdrückte, spürte Raven nun ein anderes Gewicht auf sich. Es war die Last einer Lüge, die gemäß dem Gesetz der unvorhergesehenen Folgen zum Lügner zurückgekehrt war.
„Mein Vater ist schon lange tot“, keuchte er. „Meint ihr, wenn ich mir etwas von ihm hätte leihen können, hätte ich mich an Wucherer und Halsabschneider gehalten?“
„Das mag sein, aber ein Anwaltssohn dürfte in der Not auch auf andere Bekanntschaften zurückgreifen können.“
„Kann ich nicht. Aber wie ich Flint schon sagte, als ich mir das Geld lieh: Ich habe Aussichten. Wenn ich Geld verdiene, kann ich die Schulden mit Zinsen zurückzahlen.“
Das Wiesel beugte sich ein wenig tiefer zu ihm herab, und der Gestank aus seinem Mund war schlimmer als alles, was in der Gosse liegen mochte.
Schottlands „Erfinder der modernen Anästhesie“
James Simpson ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Krankengeschichte, aber selbst in seinem eigenen Land relativ unbekannt. Im 19. Jahrhundert revolutionierte er die Medizin, indem er in Edinburgh die Anästhesie und die Behandlung bei der Geburt einführte. Er wurde zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten der Krankengeschichte und wurde zum Namensgeber eines Krankenhauses in seiner Heimatstadt, aber er hat nie die gleiche Anerkennung erhalten wie andere große schottische Wissenschaftler. Das könnte sich jetzt ändern, wenn seine Geschichte in einem Roman aus Schottlands neuestem Autorenduo zu lesen ist.
Der renommierte Krimiautor Christopher Brookmyre hat sich mit seiner Frau Dr. Marisa Haetzman unter dem Pseudonym Ambrose Parry für Die Tinktur des Todes zusammengetan, einen Kriminalroman vor der Kulisse von Simpsons historischem Edinburgh zu entwickeln. Während Brookmyre seit bereits seit vielen Jahren für seine witzigen und scharfen Krimis bekannt ist, schreibt seine Frau zum ersten Mal. Aber sie ist die wohl qualifizierteste Person in Schottland, um diese Geschichte zu erzählen. Die Anästhesistin Marisa Haetzman studierte Medizingeschichte und konzentrierte sich auf Simpsons Heldentaten. Dann begann sie, ihren Mann mit Geschichten über den charismatischen Chirurgen zu versorgen.
„Es gab viele tolle kleine Anekdoten und er meinte, es könnte ein Roman in all den Geschichten stecken. So entwickelte sich die Idee mit der Zeit.“
„Je mehr Marisa mir über das Leben von James Simpson erzählte, desto eher klangen all die kleinen Ausschnitte seines Lebens so, als würden sie eine tolle Geschichte ergeben. Es gab keinen Blitzschlag der Eingebung, aber die Idee begann allmählich zu wachsen.“
Simpson lebte von 1811 bis 1870 und war im Alter von zwanzig Jahren Arzt geworden. Er erforschte die Herzschläge von Ungeborenen, entwickelte revolutionäre Geburtshilfsmittel und entwickelte bahnbrechende Anästhetika wie Chloroform und Ether. Er wurde Arzt in Schottland bei Königin Victoria.
„Man könnte sagen, dass die Entstehung der modernen Anästhesie in Edinburgh stattfand. Simpson sollte ein bekannter Name sein. Wir waren auch seinem erstaunlichen Haushalt begeistert. Es gab alle Arten von Würdenträgern, die das Haus besuchten, aber er hat dort auch seine Patienten empfangen. Es gab Geschichten darüber, dass er sich weigerte, Zahlungen anzunehmen. Man kann bei der Recherche schnell einen Eindruck von der Wärme und Menschlichkeit Simpsons bekommen, der zu seinem Wunsch passt, eine Methode zu entwicklen, die Schmerzen beseitigt."
Vier Jahre nachdem Simpson das Team Brookmyre/Haetzman zum ersten Mal zu literarischem Handeln inspirierte, ist Die Tinktur des Todes geboren worden. Während Simpsons Welt den Rahmen bildet, sind die Hauptdarsteller der chirurgische Praktikant Will Raven und Simpsons Hausmädchen Sarah Fisher. Laut Marisa Haetzman sollte das Buch ursprünglich gar kein Kriminalroman werden. Sie hatten eine Familiensaga wie Downton Abbey im Kopf, rangen damit, das Material in den Griff zu bekommen, und haben dann letztendlich doch beschlossen, auf ihre Stärken setzen – Medizin und Kriminalromane.








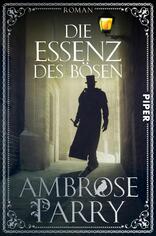
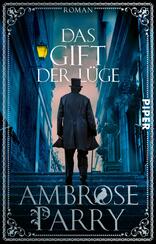












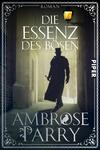


DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.