
Die Verlorenen (Die Spin-Trilogie 2) - eBook-Ausgabe
Roman
„Andrew Bannister bietet in Die Verlorenen alles auf, was die moderne Science Fiction ausmacht, und verpackt das Ganze in eine spannende, in zahlreiche Parallelströme zerfallende Handlung.“ - Fantasia 707e
Die Verlorenen (Die Spin-Trilogie 2) — Inhalt
Die Spin-Galaxie steht vor dem Untergang. Alle Handelsrouten zwischen den ehemals wohlhabenden Planeten wurden abgeschnitten. Als die Sklavin Seldyan das letzte verbliebene Kriegsschiff stiehlt, um in die freie Kolonie zu fliehen, entdeckt sie etwas Sonderbares. Ein neuer grüner Stern erleuchtet den Himmel über der freien Kolonie und entfacht die rasante Verbreitung eines Kults, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesellschaft zu unterdrücken. Unterdessen wird der Hafenmeister Vess damit beauftragt, herauszufinden, wie Seldyan aus der Sklaverei entkommen konnte. Niemand ahnt, dass Seldyans Schiff die wahre Bedeutung des grünen Sterns bereits entschlüsselt hat – und dessen existentielle Bedrohung für das gesamte Spin ...
Leseprobe zu „Die Verlorenen (Die Spin-Trilogie 2)“
1
Der Spin
Achtundachtzig Planeten und einundzwanzig Sonnen, allesamt Artefakte bis zum letzten Partikel.
Vor mehr als zehntausend Jahren wurde ein Pakt geschlossen. Mit ihm begann, was die Menschen das Zeitalter der Stabilität nannten, und es hielt auch dann noch an, als der Pakt bereits in Vergessenheit geraten war.
Aber nicht von allen. Einige wenige erinnerten sich – doch sie hatten vergessen, woran sie sich erinnerten.
Aber wir haben uns erinnert.
2
Dreiviertelringhafen
Belbis war elf Jahre alt gewesen, als er den Langen Marsch zum ersten Mal gegangen [...]
1
Der Spin
Achtundachtzig Planeten und einundzwanzig Sonnen, allesamt Artefakte bis zum letzten Partikel.
Vor mehr als zehntausend Jahren wurde ein Pakt geschlossen. Mit ihm begann, was die Menschen das Zeitalter der Stabilität nannten, und es hielt auch dann noch an, als der Pakt bereits in Vergessenheit geraten war.
Aber nicht von allen. Einige wenige erinnerten sich – doch sie hatten vergessen, woran sie sich erinnerten.
Aber wir haben uns erinnert.
2
Dreiviertelringhafen
Belbis war elf Jahre alt gewesen, als er den Langen Marsch zum ersten Mal gegangen war. Er hatte fast drei größere Monde dafür gebraucht, und in den ersten einundzwanzig Tagen hatten seine Beine vom Aufstehen bis zum Abend gezittert und geschmerzt. Sieben Jahre später war er um einiges kräftiger geworden. Nun würde er kaum mehr als einen größeren Mond brauchen – bei seiner Ankunft wäre er trotzdem erschöpft.
Er ging gleichmäßig, mit den kurzen, kraftsparenden Schritten, mit denen man in seinem Volk aufwuchs, sobald man gehen konnte. Gehen war wichtig, und es musste richtig gegangen werden. In jüngeren Jahren hatte Belbis es so ernst betrieben, dass seine Lehrer schier verzweifelt waren.
Andrerseits betrieb Belbis alles mit großem Ernst. Denn wie sollte man es sonst tun? Die Aufgaben waren dafür da, ernst genommen zu werden. Wie sonst sollten sie erledigt werden? Die meisten anderen schienen das nicht zu begreifen, doch das kümmerte Belbis nicht, denn er wusste ganz genau, dass er wiederum die meisten anderen nicht verstand. Darauf hatten er und seine Lehrer sich immerhin einigen können. Deshalb hatte es auch keinen Zweifel gegeben, welchen Weg er im Leben einschlagen sollte. Alle, er selbst eingeschlossen, waren darüber erleichtert. Außerdem war der letzte Maler des Rings im vorigen Winter gestorben, und die Prediger waren der ehernen Überzeugung, dass ihnen nur eine begrenzte Zeit der Gnade zustand, um einen neuen zu finden. Deshalb war Belbis der Sonderbare ganz schnell und ohne Widerstand zu Belbis dem Maler geworden. Beinahe erleichtert legte er die graue Kutte eines Novizen an – des niedrigsten Rangs im Orden. Allerdings war es auch der höchste, der einem Maler zustand. Schlichte Gewissheiten passten Belbis gut.
Der Verlauf des Langen Marschs war nicht kompliziert. Aus Tradition begann er an der äußersten Stelle des längsten Landungsstegs von Ringhafen. Von dort ging es an Land, vorbei an den Slipanlagen mit ihren lebhaften Gerüchen von Teer und menschlichen Abfällen, vorbei an den Seilerbahnen und Öllagern und vorbei an den Flenshöfen, in denen wertvolle große Finnwalbullen mit klingenbewehrten Spaten zerteilt wurden. Die Überreste troffen an den glitschigen Eingeweiderampen hinunter und landeten wieder im Hafen, wo weniger edle Tiere mit offenen Mäulern warteten. Diese niederen Tiere wurden ihrerseits zur Beute von Kreaturen, die in der gesellschaftlichen Rangordnung noch tiefer standen. Die Hungernden, Kranken und Alten standen mit Keulen und Stecken über ihnen und lauerten auf eine günstige Gelegenheit. Warst du zu krank oder zu alt, um Fische zu fangen, hatte Ringhafen weder Verwendung noch Nahrungsmittel für dich.
Belbis mochte keine starken Gerüche. Den ersten Teil des Marschs brachte er eilig mit gesenktem Blick und zugespressten Lippen hinter sich, um keine Gotteslästerung zu begehen und sich zu übergeben.
Nach den Flenshöfen wich die Route dem Haus des Hafenfeldwebels aus, das wieder anders roch, nämlich nach Gebratenem, nach Rauch, der aus dem Kamin aufstieg, und nach Strunkbräu. Und das war angenehmer. Wenigstens größtenteils angenehmer. Den Teil, der an den großen Wohnhäusern am oberen Ende der Gründerwiese vorbeiführte, mochte Belbis nicht. Hier hatten die Reichen ihre Stadthäuser, große Hallen aus gewaltigen Balken, die auf niedrigen Mauern aus vermörteltem Schiefer ruhten. Die Reichsten hatten auch Dächer aus Schiefer – statt aus Reet oder Torf –, und der Rauch aus ihren Kaminen roch nicht nach Seetang, sondern nach Dufthölzern. Sie mochten so gut riechen, wie sie wollten, doch Belbis hatte das Unsagbare festgestellt, dass nämlich Familien, je reicher sie waren, desto agnostischer wurden. Freilich niemals offen atheistisch, denn das wäre selbstmörderisch gewesen. Und doch blieb es für Belbis höchst verwunderlich, welch große Zweifel man haben konnte, ohne tatsächlich als Ungläubiger zu gelten. Vor allem dann, wenn man reich war.
Seine Verwunderung bewahrte ihn nicht vor Spott und gelegentlichen Steinwürfen. Doch denen konnte er ausweichen. Derlei war schon immer Teil seines Lebens gewesen. Vermutlich würde das auch so bleiben. Der Orden war unbeliebt, und man hatte ihm erzählt, dass die Priesterschaft allgemein gehasst wurde, vor allem in Zeiten, in denen die Fischerei schlechte Erträge brachte. Allerdings begaben sich die Prediger niemals auf Fischfang.
Hinter Gründerwiese führte der Lange Marsch an dem großen öffentlichen Park von Gründerfeld vorbei, knickte ab, wo der Park schmaler wird und um Endort herumläuft. Dort fanden jede Woche einige Verurteilte den Tod durch die Axt des Abfertigers. Verbrecher natürlich, Verräter und auch solche, die zwar weniger zweifelten als die Bewohner der großen Häuser in Gründerwiese, aber auch weniger reich waren.
Der Abfertiger trug eine nachtschwarze Kutte und kam in der Hierarchie damit unmittelbar nach den zehn höchsten Klerikern. Unter den Stadtbewohnern hatte Belbis munkeln hören, dass man auf Schwarz keine Blutflecken sah, aber das war nicht der wahre Grund. Dem Abfertiger unterstanden andere, die sich um das Blut kümmerten, ob auf den Kutten oder anderswo.
Der Kanal von Endort wand sich in die Stadt hinunter, ohne die wohlhabendsten Viertel zu berühren, bis er im Hafen in die Eingeweiderampen mündete. Belbis hatte gehört, dass dem Blut eine Substanz beigefügt wurde, damit es flüssig blieb. Er kannte sich nicht aus, aber die Vermutung leuchtete ihm ein. So etwas war möglich, wie er aufgrund seines eigenen Berufs wusste. Schließlich war es nicht wünschenswert, dass die Kanäle verstopften.
Endort markierte den Stadtrand. Danach verlief der Marsch vorbei an Privatgrundstücken und Ackerland, bis er von den Küstenebenen, die Stadt und Hafen ernährten, aufstieg und sich den Bergen zuwandte. Von Tag zu Tag zog sich die Landschaft ringsum enger zusammen, breite Täler wurden zu schmalen Felsspalten, durch die oft kalte Flüsse rauschten. Nacht für Nacht schlief er, wie man es ihm beigebracht hatte – ausgestreckt unter seinem Mantel, die Wange auf dem Arm abgelegt und die Augen von den Sternen abgewandt. Die Sterne würde er erst wieder sehen, wenn seine Reise zu Ende war. Kein Maler sah vorher zu den Sternen auf.
Gegen Ende des Marschs bekam er stets großen Hunger. Unten in den Ebenen gab es Beeren und gelegentlich auch größere Früchte. Die Tradition gestattete es dem Maler, zehn Schritt links und rechts des Marschs nach Nahrung zu suchen, und die älteren Bauern pflanzten manchmal Büsche innerhalb dieses Bereichs und sahen mit einem Kopfnicken zu, wie ein Maler die Früchte pflückte. Doch je weiter er sich von dem fruchtbaren Land entfernte, desto weniger Essbares fand er. So musste er sich mit dem Gebackenen begnügen, das er in seinem kleinen Beutel mit sich trug. Das reichte nicht, aber es sollte auch nicht reichen. Man sagte, der Maler solle am Wachhaus mit großen Augen und dünnem Blut ankommen.
Belbis erreichte das Wachhaus am dritten Tag vor der vollen Dunkelheit des letzten größeren Mondes des Jahres. Dies war eine Glück verheißende Zeit. Der Himmel war klar, schwarz vom Frost, und die Sterne leuchteten hell.
Das Wachhaus thronte auf einem schmalen Gipfel an der höchsten Stelle der Wirbelsäule, die ihren Namen der Tatsache verdankte, dass sie sich in einer schwach geschwungenen S-Form wie eine Missbildung durch den Kontinent zog. Das Haus war aus Holz gefertigt, eine ramponierte Burg, die wie ein Keil über die Bergspitze aufragte und sich mit mächtigen, groben Stämmen auf dem grauen Fels abstützte. Es besaß nur einen Zugang, einen schwankenden, ungeschützten Holzsteg, der an einem Felsvorsprung endete. Dieser war gerade groß genug, dass man allein darauf stehen konnte, wenn man den Rücken gegen die Felswand presste.
Der Steg – für sich schon eine spirituelle Herausforderung – war zwanzig Schritt lang. Am anderen Ende warteten die drei Haushälter, verschwommen und grau im Licht der Sterne. Sie trugen keine Laternen. Aus Rücksicht auf die Bedürfnisse des Malers blieb das Wachhaus nachts in völliger Dunkelheit, und das galt auch für die Haushälter. Beim Näherkommen erkannte Belbis ihre leeren Augenhöhlen, tiefere Schatten im Grau. Bei ihrem ersten Anblick hatte ihn ein Schauer erfasst.
Maler wurden in jungen Jahren erwählt, Haushälter jedoch schon bei der Geburt.
Belbis verneigte sich vor den Haushältern, wie er es auch in den letzten sieben Jahren getan hatte. Mit den geschärften Sinnen derer, die schon ihr Leben lang blind waren, spürten sie seine Verneigung. Stets fragte er sich, wie sie dies vermochten. Durch die Luftbewegungen? Durch das Rascheln seiner Kutte? Jedenfalls verneigten sie sich ihrerseits, traten zur Seite und luden ihn mit einer Handbewegung ins Wachhaus ein.
Seine Füße kannten den Weg. Er erklomm Stufen, stieg dann weiter hinauf über schmalere Treppen zur Dachkammer des Malers. Die Bank war leer bis auf die beiden Antimonschalen, groß wie seine Handteller. Die übrigen Werkzeuge brachte er selbst mit. Er öffnete seinen Beutel, entnahm ihm die Lederrolle und breitete sie zwischen den beiden Schalen auf der Bank aus. Eins nach dem anderen kamen die Werkzeuge zum Vorschein: die Federn mit ihren unterschiedlich großen Spitzen, von dünn bis breit. Die Pinsel und die anderen Utensilien. Und die Verbände.
Er zögerte einen Augenblick lang, bevor er eine der Glasscherben auswählte. Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger, hob die Kutte, um den Oberschenkel zu entblößen, und nahm einen raschen Schnitt vor.
Dunkle, beerenförmige Blutstropfen quollen hervor. Er legte die Scherbe zurück auf das Leder, nahm eine der Schalen und drückte ihren Rand ein Stück unterhalb des Schnitts gegen den Schenkel. Am Boden der Schale lief das Rinnsal langsam zusammen.
Belbis wartete, bis sich eine zwei Finger breite Pfütze gebildet hatte. Dann stellte er die Schale auf den Tisch und drückte den Verband auf den Schnitt. Es brannte, und er kniff die Augen zusammen. So zählte er auf zehn, um dem Adstringens Zeit zu geben, den Schnitt zu verschließen. Dann griff er zu einer feinen Profilfeder, tunkte sie in die Schale und hielt sie über das Blatt Papier. Dann erst streckte er den anderen Arm aus, um an der Kordel zu ziehen, mit der die Mondläden zu öffnen waren.
Einen Moment lang starrte er mit großen Augen hinaus. Dann schrie er.
Zum ersten Mal in seinem Leben, zum ersten Mal in fünfhundert Jahren wies der Himmel die falsche Anzahl von Göttern auf.
Sein Schrei rief die Haushälter herbei. Erst stammelte er wirr und deutete auf den Streifen Himmel, den er durch die Mondläden sah, doch sie schüttelten die Köpfe und wiesen auf ihre leeren Augenhöhlen. Daraufhin erklärte er es ihnen.
Die alten Männer berieten sich. Dann winkten sie Belbis mit grimmigen Mienen, er möge ihnen folgen. Sie führten ihn unzählige Treppen hinunter, die er kaum wahrgenommen hatte, in einen Teil des Wachhauses, den er noch nie zuvor betreten hatte. Es war eine Kammer, die aus dem Berggipfel herausgemeißelt worden sein musste, denn anders als der Rest des Hauses bestand sie nicht aus Holz, sondern aus Stein, so trocken und staubig wie jahrhundertealte Leichen. Mitten in der Kammer erhob sich eine einzelne schwarze Säule, die einer senkrecht angebrachten, mit der Mündung nach oben weisenden hüfthohen Kanone glich.
Der älteste der Haushälter fuhr mit der Hand über die Mündung. Dann wich er zurück.
Eine Weile geschah nichts. Dann zuckte Belbis zusammen. Aus dem Nichts erklang eine leise Stimme. Zwar hatte sie einen fremdartigen Akzent, doch die Worte waren klar verständlich. „Zündung aktiviert“, sagte sie. „Bitte räumen Sie das Areal!“
Belbis musterte die Haushälter. Sie hatten sich bei den Händen gefasst und bildeten einen Kreis um die Säule. „Das Ding will, dass wir gehen“, sagte er. „Aber wohin?“
Der Älteste antwortete, ohne sich Belbis zuzuwenden. „Geh, so weit du kannst!“ Dann presste er die Lippen fest aufeinander.
Belbis drehte sich um und rannte los. Als er den äußeren Steg erreichte, blitzte hinter ihm geräuschlos das Licht auf.
Unten in den Ebenen sahen die Menschen nach oben und wunderten sich über den grellen grünen Strahl, der in den Himmel stach.



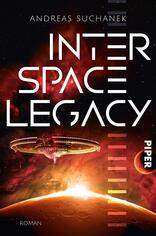



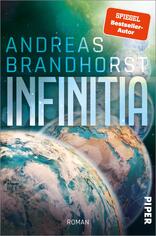




DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags
Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.
Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.
Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.
Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.
Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.